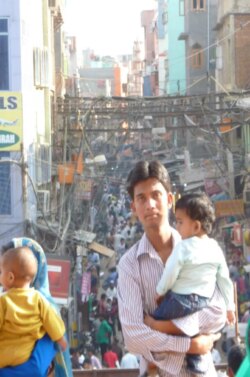Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 201
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Diktat des erinnernden Selbst
ОглавлениеIn dem Maße, in dem die Forschungen und Theorien Daniel Kahnemans und anderer stichhaltig sind, sind Menschen konstitutionell nicht in der Lage, unangenehme Erlebnisse rückblickend in ihrer tatsächlichen – das heißt: von Augenblick zu Augenblick erlebten – Negativität einzuschätzen. Kahnemann differenziert idealtypisch (nicht etwa neurologisch oder hirnanatomisch) zwischen einem erlebenden Selbst und einem erinnernden Selbst. Das erlebende Selbst ist das Ich, das in einem äußerst schmerzhaften Moment einer insgesamt schmerzhaften medizinischen Untersuchung sagen würde: Es tut gerade unerträglich weh oder: Der Schmerz ist jetzt erträglich. Das erinnernde Selbst hingegen ist das Ich, das die Gesamterfahrung rückblickend bewertet. Kahnemann fand heraus, dass die tatsächliche Dauer einer sehr unangenehmen Erfahrung für die rückblickende Bewertung durch das erinnernde Selbst von sehr viel geringerer Bedeutung ist als man ohne Kenntnis seiner Erhebungen oder Experimente annehmen würde. Experimente demonstrierten Kahnemann, dass es für das rückblickende – eine Gesamtbewertung vornehmende – Selbst vornehmlich auf den Gipfel des Schmerzes und dessen zeitliche Situierung im Gesamtablauf einer Erfahrung ankommt sowie auf die Qualität der Abschlusserfahrung.
Während wir als unbefangene Beobachter die Frage „Wer hat am meisten gelitten?“ unter Verweis auf schmerzerfüllte Zeitdauern unter Berücksichtigung ihrer Schmerzintensität beantworten würden, zeigte sich, dass die Leidensdauer für Patienten und Probanden unerheblich war. So konnte Kahnemann experimentell erweisen, dass Probanden, die ihre Hände 60 Sekunden lang in gleichbleibend kaltes Wasser tauchten (Test 1), diese Erfahrung als unangenehmer bewerteten, als eine Erfahrung, bei der sie ihre Hände 90 Sekunden lang in unangenehm kaltes Wasser tauchten (Test 2), wenn die Wassertemperatur in Test 2 nach 60 Sekunden um 1 Grad von 14 auf 15 Grad Celsius erhöht wurde (ohne dass die Probanden davon wussten). Eine Erhöhung um 1 Grad Celsius ist gerade eben als leichte Verringung des Kältegefühls wahrnehmbar, das gleichwohl unangenehm blieb. Wie sich zeigte, waren Kahnemanns Probanden eher geneigt, die 90 Sekunden währende unangenehme Kälteerfahrung zu wiederholen als die nur 60 Sekunden dauernde. Laut Kahnemann aus dem Grund, dass die Abschlusserfahrung (30 Sekunden um 1 Grad wärmeres, wiewohl fortwährend unangenehm kaltes Wasser) geringfügig weniger negativ war. Befragt man das erlebende Selbst, so sagt es in diesem Experiment in jedem Augenblick, dass sich die Hand in unangenehm kaltem Wasser befindet. Nun gibt es ein überwältigendes Einvernehmen dahingehend, dass empfindende Wesen versuchen, unangenehme Erfahrungen abzukürzen und sie keinesfalls zu verlängern suchen. Kahnemanns Experiment demonstriert, dass das erinnernde Selbst sich über das hinwegsetzt, was wir die elementare oder die sinnesphysiologische Rationalität des erlebenden Selbst nennen können und retrospektiv eine objektiv längere unangenehme Erfahrung einer kürzeren vorzieht, bloß weil die längere unangenehme Erfahrung eine kaum merkliche Verbesserung (Temperaturanstieg des Wassers) mit sich brachte.
Erhebungen Kahnemanns belegen, dass diese Tyrannei (besser spricht man vielleicht von seiner Dominanz) des erinnernden Selbst ähnliche rückblickende Bewertungen zeitigt, wo es um unangenehme medizinische Untersuchungen geht: Patienten bewerteten schmerzhafte Untersuchungen rückblickend nicht gemäß deren tatsächlicher Dauer, sondern abhängig davon, wo der schmerzhafteste Augenblick lag und mit welchen Schmerzgraden die Untersuchung endete. Laut Kahnemann bewerten Patienten einer Gruppe A, die eine bestimmte Schmerzintensität im Laufe einer Untersuchung über längere Zeitstrecken erleben als Patienten einer Gruppe B, die gesamte Untersuchung rückblickend als weniger schlimm, wenn der Zeitpunkt größten Schmerzes bei Gruppe A am Anfang, bei B hingegen am Ende der Untersuchung liegt (vgl. Kahneman, S. 378ff).
Zwei weitere Beispiele: a. Auch wenn eine Gebärende unerträglichen Schmerz auszustehen haben mag – sobald sie das Neugeborene in ihren Armen hält, verblasst die Erinnerung und der Glücksmoment als Abschlusserfahrung lässt sie (das erinnernde Selbst) den Geburtsvorgang späterhin mit einiger Wahrscheinlichkeit anders bewerten als das erlebende Selbst ihn erfuhr, das bei einer schweren Geburt für die Dauer von Stunden vielleicht alles gegeben hätte, damit der Schmerz aufhört. b. Und wer kennt nicht diese Urlaube voller Strapazen: Befragte man uns täglich im Abstand einer Stunde, wie wir uns gerade fühlen, so ergäbe sich vermutlich eine deprimierend Summe. Erst retrospektiv konfigurieren wir einen insgesamt positiven Gesamteindruck aus Einzelteilen, die einen solchen Gesamteindruck für sich genommen nicht erwarten lassen.
Aus dieser Rückblicks-Verzerrung dürften sich zu erheblichen Anteilen auch Optimismus und Pronatalismus speisen. Von einer Tyrannei des retrospektiven Selbst können wir hier deshalb reden, weil seine Dominanz unterbindet, dass uns das tatsächliche Ausmaß menschlichen Leidens vor Augen geführt wird. Berücksichtigen wir eine kognitive Verzerrung wie die Dominanz des rückblickenden Selbst, so erhellt, warum Menschen das (eigene) Leben auch dann schön finden können, nachdem sie Monate oder Jahre in einem Konzentrationslager verbrachten. Stand am Ende die Befreiung oder setzte eine andere positive Entwicklung ein, so werden Jahre der Erniedrigung und des Schmerzes ausgeblendet. Im Rückblick erscheint der Aufenthalt im Konzentrationslager erträglicher als er bewertet worden wäre, wenn man die Opfer Tag für Tag befragt hätte.
Für den Antinatalismus ist der Umstand, dass das erlebende Selbst vom erinnernden Selbst dominiert und unterdrückt wird, von herausragender Bedeutung. Belegt doch die Tyrannei der Retrospektive, dass sich hinter positiven Selbsteinschätzungen unserer Lebenswirklichkeit – und somit hinter der optimistischen Psyche – eine andere Wahrheit verbirgt. Konkreter: Wer einen Menschen zeugt, zeugt ein Wesen, dass bio-psychisch so konstituiert ist, dass es vom realistischen Erfassen der eigenen Lebenswirklichkeit durch einen Schutzschirm abgehalten wird.
Froh, geboren zu sein