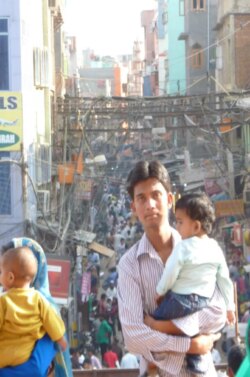Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 257
На сайте Литреса книга снята с продажи.
van der Heijden (*1951)
ОглавлениеAls ein überaus bedeutendes Elternschuldbekenntnis ist van der Heijdens Roman „Tonio“ zu werten. Der „Requiemroman“ bricht gleich mit mehreren gängigen Tabus. Van der Heijden, dessen Sohn tragischerweise als Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, gesteht unumwunden und deutlicher als andere zu, sein Kind dem Tode ausgeliefert zu haben:
„Nach Tonios Geburt am fünfzehnten Juni 1988 galt es, die Konsequenzen zu akzeptieren. Ich musste zuschauen, wie ich den Jungen mindestens bis zum Erwachsenenalter beschützte, wärmte, nährte, kleidete, zur Schule schickte... Er hat mich nicht überlebt. Die Welt ist aus dem Lot, und dennoch muss ich die Konsequenzen meines ‚Kinderwunsches’ aus dem Jahr 1987 akzeptieren... Auch als Toten habe ich ihn voll und ganz zu akzeptieren – und für ihn zu sorgen. Ich wusste, dass ein Kind, das ich mir in den Kopf gesetzt hatte, sterblich sein würde, mochte es auch noch so gesund zur Welt kommen. Diese Sterblichkeit habe ich damals, mit Magenkrämpfen, hingenommen. Einkalkuliert. Ich hatte sogar das Risiko seines frühzeitigen Todes, so klein die Gefahr auch war, akzeptiert... Indem ich Tonio zeugte, war sein früher Tod eine der unwillkommenen Möglichkeiten, denen ich ihn auslieferte. Ich habe mit seinem Leben gespielt, und verloren.“ (van der Heijden: Tonio, S. 242f)
In Kantischer Manier (Natalschuldumkehr) lässt der Autor seine Verantwortung für das Kind nur bis zu dessen Volljährigkeit gelten. Genau dies fechten wir an: Zwar wird ein Erwachsener eher für sich selbst sorgen können als ein Kind. Das Sterbenmüssen indes ist für den Erwachsenen ebenso ein Neganthropikon wie fürs Kind – wobei letzteres sogar zu Lebzeiten tröstender Eltern sterben „darf“, was den meisten Erwachsenen nicht vergönnt ist.
Wie groß die aufgeladene Verantwortung war, zeichnet sich für van der Heijden erst deutlich ab, als er sie nicht länger wahrnehmen kann. Aber, so fragen wir, was ist mit all den anderen „Kindern“, deren Eltern längst aus ihrer Verantwortung herausgestorben sind? In all diesen Fällen steht die Verantwortung gleichsam als nichtwahrgenommene und trägerlose im Raum. Sind sie nicht allesamt Menschen, die der unverbrüchlichen Gewissheit des Sterbenmüssens ausgeliefert wurden?
Aus van der Heijdens Betroffenheit spricht ein kaum je zur Sprache gebrachter Narzissmus. Der Tod eigener Kinder ist nur dann aufrührend, wenn er zu Lebzeiten erschütterter Eltern stattfindet. Müssten nicht alle Eltern permanent verzweifeln und aussprechen, dass das unabdingbare künftige Sterben ihrer Kinder die Wahrheit elterlichen Versagens ist? Oder äußert sich hier jene Altersvergessenheit, die das Leben und Sterben alter Personen zu etwas ethisch Drittklassigem erklärt?
„Nein, ich nehme alle Schuld auf mich. In deinem grundwassertiefen, atemlosen Schlaf machst du mir keine Vorwürfe. Deine Reglosigkeit an sich ist eine große Beschuldigung an meine Adresse, auch ohne dass du das willst, denn du hast nichts mehr zu wollen. Dein Tod ist die Wahrheit über mein Versagen. Dein Tod ist die Summe meiner Fahrlässigkeiten.“ (A.a.O., S. 561)
Unter dem Aspekt ethischer Universalisierung müssten Eltern deklamieren: Deine künftige Reglosigkeit als 70- oder 90-Jähriger ist eine Beschuldigung an meine Adresse!