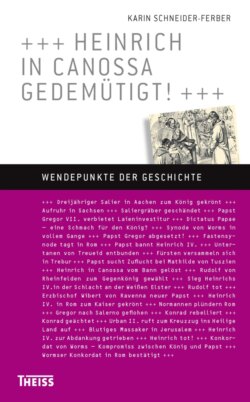Читать книгу Heinrich in Canossa gedemütigt! - Karin Schneider-Ferber - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Streiter mit der Feder – die Chronisten der Salierzeit
ОглавлениеUm das Jahr 1078 spitzte der fromme Benediktinermönch Lampert von Hersfeld den Federkiel und schrieb mit viel Leidenschaft und gestützt auf die Arbeit seiner Vorgänger ein umfassendes Geschichtswerk von den Anfängen der Welt bis in die damalige Gegenwart, seine viel beachteten »Annalen«. Besonderes Augenmerk richtete er dabei auf genau jene unheilschwangeren Jahre, in denen Heinrich IV. sowohl mit den Sachsen als auch mit dem Papsttum in schärfste Auseinandersetzung geriet. Ausführlich schildert Lampert die dramatischen Geschehnisse einschließlich des Gangs nach Canossa, wobei er kein einziges gutes Wort am König lässt: Verschlagen, misstrauisch und hinterhältig sei dieser gewesen. Er formuliert seine Kritik an Heinrichs Amts- und Lebensführung so, wie sie die aufständischen Sachsen in den Verhandlungen mit der königlichen Seite immer wieder vorbrachten, und natürlich gaben für ihn die Vorgänge von Canossa die geeignete Folie dafür ab, den widerborstigen König besonders schlecht aussehen zu lassen. Diese stark subjektiv gefärbte Darstellung warf im Nachhinein die Frage nach der Glaubwürdigkeit der überlieferten Quellen insgesamt auf.
Tatsächlich stammen die meisten historiografischen Werke der Epoche aus der Feder von Klerikern, die der Kirchenreform nahestanden. Neben Lampert gehören die Chroniken Bertholds von Reichenau und Bernolds von Konstanz zu den ausführlichsten zeitgenössischen Quellen. Beide Mönche lebten und arbeiteten im vom Bürgerkrieg schwer heimgesuchten Südwesten des Reiches und bezogen als leidenschaftliche Parteigänger des Reformpapsttums Stellung. Während Berthold, dessen Reichenauer Kloster von Heinrich IV. zwei ungeliebte Äbte aufgezwungen bekam, zuweilen zu polemischer Schärfe neigt, tritt bei Bernold ein stärkeres kirchenrechtliches Interesse hervor, mit dem er die päpstlichen Positionen zu rechtfertigen sucht. Bernold, Sohn eines Priesters und dennoch entschiedener Gegner der Priesterehe, wurde 1084 vom späteren Papst Urban II. zum Priester geweiht. Ab dem Jahr 1077 wandelte sich seine zuvor objektivere Einstellung zu Heinrich IV. in ein recht abschätziges Urteil, das die Verhärtung der Fronten in Schwaben während des Investiturstreits widerspiegelt.
Mit großer Erbitterung schrieb von Anfang an der Magdeburger Geistliche Bruno um 1082 sein »Buch vom Sachsenkrieg«. Da er zur engeren Umgebung Erzbischof Werners von Magdeburg zählte, der einer der erbittertsten Feinde Heinrichs IV. war, berichtet er sozusagen aus dem Epizentrum des sächsischen Aufstands. Dabei zeichnet er ein äußerst negatives Bild vom König, dem er wegen seines ungerechtfertigten Vorgehens gegen die Sachsen, aber auch wegen charakterlicher Mängel und zügelloser sexueller Ausschweifungen die Befähigung zum Herrscheramt rundweg abspricht.
Gegen diese »rabenschwarze Presse« hatten es die Parteigänger des Königs schwer. So machte sich ein unbekannter Dichter nach dem Sieg Heinrichs über die Sachsen 1075 daran, den siegreichen Herrscher in einem lateinischen Gedicht, dem »Carmen de bello Saxonico«, zu glorifizieren. Er rechtfertigt das Vorgehen des Königs, der nach der langen Zeit seiner Unmündigkeit wieder für Ordnung im Reich gesorgt habe, was ihm die Sachsen aber übel genommen hätten. Die eindeutig panegyrische Absicht wiederholt sich in Heinrichs Vita, die von einem unbekannten, vielleicht in Regensburg beheimateten Autor 1106 verfasst wurde, die den König ebenfalls als einen untadeligen Mann preist und die Schuld am Ausbruch der Querelen allein den aufständischen Fürsten zuschiebt. Da die Lebensbeschreibung erst nach dem Tod Heinrichs erschien, behielten Heinrichs Kritiker letztendlich Oberwasser. Das Schweigen der Quellen auf Seiten Heinrichs mag aber auch ein Hinweis darauf sein, wie unbeliebt der Salier bei seinen Zeitgenossen war.