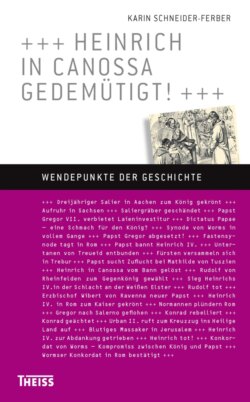Читать книгу Heinrich in Canossa gedemütigt! - Karin Schneider-Ferber - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Canossa als Zäsur
ОглавлениеAm Ende der Machtprobe hatten sich Kirche und Welt ein gehöriges Stück auseinanderbewegt. Vorbei die Zeiten, als Kaiser und Papst noch zusammen Synoden leiteten und die Angelegenheiten der Kirchen in trauter Zweisamkeit zu lösen suchten, wie das zu ottonisch-frühsalischer Zeit zumindest phasenweise noch der Fall gewesen war. Zum großen Gewinner der Auseinandersetzung wurde das Papsttum, das sich als unumstrittene Größe an die Spitze der Kirchenhierarchie gesetzt hatte und seinen geistlichen Primat auf die weltlichen Herrschaftsträger selbstbewusst ausdehnte. Die Zukunft gehörte der päpstlich dominierten Amtskirche, die mit der Ausrufung des Ersten Kreuzzugs 1095 durch Papst Urban II. einmal mehr bewies, welch wirkmächtige und buchstäblich »bewegende« Idee ihr zur Verfügung stand, während das Königtum sich schwer tat, in gleichem Maße zu begeistern und seine Rolle in der Christenheit zu definieren. Das Kräftemessen zwischen den beiden Institutionen hielt das ganze Mittelalter hindurch an und wurde erst zu Beginn der Frühen Neuzeit mit dem Aufstieg der Territorialstaaten zu Gunsten der weltlichen Macht entschieden. Daher gehörten auch die Fürsten des Reichs zu den Gewinnern des Konflikts, die mit großer Beharrlichkeit dafür sorgten, dass das deutsche Königtum bis zum Ende der Epoche eine Wahlmonarchie blieb und ihr eigener Handlungsspielraum durch die Schwäche der Zentralgewalt umso breiter ausfiel.
All dies begann nicht in Canossa und wurde durch Canossa auch nicht entschieden. Aber in der Rückschau erscheinen all diese Entwicklungsansätze in der Szenerie vor dem Burgtor, in der der König als Büßer vor dem Papst auf die Knie sank, aufs Trefflichste fokussiert. Es standen sich eben nicht zwei gleichberechtigte Partner in einer Art Friedenskonferenz gegenüber, um den aus dem Ruder gelaufenen Konflikt zu entschärfen – eine These, die jüngst der Historiker Johannes Fried ins Spiel brachte –, sondern vor den Mauern der stark befestigten Burg traf ein sündiger Mensch auf seinen Seelenhirten, der ihm allein den Weg zum himmlischen Frieden weisen konnte. Die Macht zu binden und zu lösen kam dem Papst zu, nicht dem König, der um Absolution bat. Das Pikante an diesem Moment fiel auch schon den Zeitgenossen auf. Als Bischof Otto von Freising, der Enkel Heinrichs IV., über ein halbes Jahrhundert nach dem Ereignis eine Weltchronik schrieb, wähnte er sich schon am Ende der Zeiten, weil »Gottesstaat« und »Weltstaat« so sehr auseinanderstrebten. Die Kirche, so sein Vorwurf, habe beschlossen, »den König nicht als den Herrn des Erdkreises zu ehren, sondern als ein wie alle Menschen aus Lehm gemachtes, tönernes Geschöpf mit dem Schwert des Bannes zu treffen«. Wo hätte sich der König jemals besser als ein aus Lehm gemachter Mensch präsentiert als just vor dem Burgtor von Canossa?