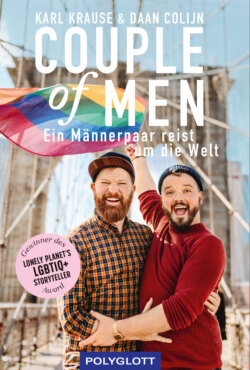Читать книгу Couple of Men - Karl Christian Krause - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schwul im Erzgebirge
ОглавлениеFür mich fühlte es sich immer so an, dass beide, meine Mutter und mein Vater, schon sehr früh eine gewisse Vorahnung hatten. Gleichzeitig schienen sie alles daranzusetzen, dass ich es eben nicht sein würde, schwul. Noch heute verbindet meine Mutter dieses Wort mit Schmerz und Leid und hat Probleme damit, das Kind – ihr Kind – auch so zu benennen. Meine Eltern wollten, dass ihr Sohn ihre eigenen Erwartungen an das Leben umsetzte: Ich sollte studieren, einen Beruf haben, der mich und meine Familie, also eine Frau und Kinder, ernähren konnte. Natürlich wünschten sie sich auch, dass ich glücklich werden würde.
Meine Familie hat es mir nicht immer leicht gemacht, mich selbst zu finden. Im Gegenteil. Mein Großvater zum Beispiel hatte die Angewohnheit, immer dann den Fernsehsender zu wechseln, wenn bei der wöchentlichen Schlager-Hitparade, Patrick Lindner seinen Auftritt hatte. Dieser hatte sich 1999 in der Öffentlichkeit geoutet und musste daraufhin fast seine Karriere beenden. Warum mein Großvater das tat, kann ich bis heute nicht mit Sicherheit sagen. Seine Motivation nahm er mit ins Grab. Und auch wenn er Daan nach meinem Coming-out als meinen Partner akzeptierte, sprach sein damaliges Handeln Bände. Und das hatte er mir auch noch im Alter von fünfzehn Jahren deutlich vor Augen geführt: Was ich fühlte, war nicht normal. Ich war nicht normal. Man musste es wegschalten.
Auch mein Vater tat sich sehr schwer damit, dass ich, sein erstgeborener Sohn, anders war, als er sich vielleicht erhofft hatte. Das war zumindest die Erklärung, die ich mir damals immer einredete. Ich wollte weder ein Motorrad haben, noch lernen, mit Hammer und Säge umzugehen. Und Autos waren mir schnurzegal. Ich hatte andere Interessen, wie zeichnen, singen, tanzen und später Volleyball spielen. Mit diesen Hobbys schien mein Vater nicht viel anfangen zu können, dachte ich jedenfalls, und wollte sie mit ihm daher auch nicht teilen. Das Verhältnis zwischen uns war bis zu meinem achtzehnten Lebensjahr eher angespannt, leider.
Teenager-Karl mit langem, blondem Haar
Meine Mutter hatte vor allem Angst. Angst davor, dass mir etwas passieren würde und dass ich in einer ohnehin so schwierigen Welt noch einen extra schweren Rucksack zu tragen hätte. Überdies träumte sie von Enkelkindern und einer Schwiegertochter, die mein Vater in einem weißen Brautkleid zum Altar führen würde. Und das erwähnte sie auch, in regelmäßigen Abständen, und fragte, ob ich denn endlich eine Freundin haben würde, oder, ganz direkt, ob ich schwul sei. Schließlich hatte ich, bis auf Mädchen, kaum Jungen als Freunde und spielte fast ausschließlich mit meinen Barbie-Puppen. Doch ich zweifelte an mir, hatte weiterhin Angst, es mir selbst einzugestehen, meine Eltern zu verletzen, auch offiziell und mich selbst als unnormal abzustempeln. Und, aus rein praktischer Sicht, scheute ich die Konfrontation. Also war meine Antwort auf die besorgten Fragen meiner Mutter immer: »Nein, natürlich nicht!«
Nachtleben im wiedervereinigten Berlin
ANDERSSEIN IN DER DDR
Natürlich gab es Schwule, Lesben und queere Personen in der Deutschen Demokratischen Republik. Doch ich war noch zu jung, um über diesen wichtigen Teil der queeren Geschichte Deutschlands mehr schreiben zu können. Dokumentationen wie Unter Männern – Schwul in der DDR (2012) oder Out in Ost-Berlin (2013), die auf der Berlinale gezeigt wurden, legen nahe, dass, auch wenn Homosexualität in der DDR ab 1968 per Gesetz nicht mehr verboten war, die Gesellschaft alle »Quertreiber« des sozialistischen Familienbilds (das ein traditionelles war) aus dem sozialen Leben ausgeschlossen hat. Oder sie wurden von der Stasi überwacht. Allerdings konnten sich vorwiegend in den ostdeutschen Großstädten sogenannte Arbeitsgruppen bilden, die zum Ziel hatten, Homosexualität als Teil des kommunistischen Weltbilds in die gesellschaftlichen Strukturen zu integrieren. Dabei stellt sich heute natürlich die Frage, ob es wirklich das Ziel der LGBTQ+-Community sein sollte, sich anzupassen, sich in bestehende heteronormative Gesellschaftsformen ein-, aber vor allem unterzuordnen. Oder sollten queere Menschen danach streben, dass gerade ihre Lebensweisen und Subkulturen für das akzeptiert werden, was sie eigentlich sind: anders und ein mindestens genauso wertvoller Teil einer aufgeschlossenen, vielfältigen Gesellschaft, ohne sich unterordnen zu müssen?