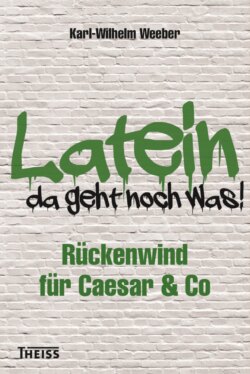Читать книгу Latein - da geht noch was! - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Martial – Ein Spötter als neuer Stern am didaktischen Firmament
ОглавлениеUnd zwar auch deshalb, weil sich der Lektürekanon geändert hat. Cicero und Caesar, Vergil und Tacitus sind nicht ins didaktische Exil geschickt worden, aber sie haben Begleiter an die Seite gestellt bekommen, die das Ganze ausgewogener machen – Vertreter der Musa iocosa, der „scherzhaften Muse“, die zwar leicht geschürzt daherkommt, aber literarisch-künstlerisch keineswegs in der zweiten Liga spielt. Das Gegenteil von „gravitätisch“ ist ja nicht „unseriös“.
Zwei dieser neuen Begleiter sollen in diesem Buch kurz vorgestellt werden. Der eine, Petron, der Verfasser der Satyrica, erhält sogar ein eigenes Kapitel. Sein grandioser Schelmenroman ist ein singuläres Stück Literatur, das Satire und Gesellschaftskritik aufs unterhaltsamste miteinander verbindet. Der andere neue Star im lateinischen Lektüreunterricht, der sich in den letzten Jahrzehnten etabliert hat, ist Martial. Er schrieb im späten 1. Jahrhundert n. Chr. Spottepigramme, die zum Besten zählen, was die Weltliteratur in diesem Genus zu bieten hat. Man hat Martial auch als Schöpfer dieser Gattung bezeichnet. Dieses Urteil findet nicht den Beifall aller Literaturwissenschaftler, wohl aber die Aussage, dass er mit seinen pointensicheren spöttischen Kurzgedichten für spätere Epigrammatiker vorbildhaft gewesen ist. Aufgrund seiner stilistischen Brillanz und seiner geist- und anspielungsreichen Doppelbödigkeit eröffnet er ebenso anregende wie motivierende und intellektuell fordernde Interpretationsspielräume.
Martial nimmt alle möglichen Typen, Marotten und Verhaltensweisen aufs Korn, die nicht nur das pralle Hauptstadtleben seiner Zeit spiegeln, sondern auch unserer heutigen Welt nicht völlig fremd sind. Um eine oder zwei Ecken herum begegnet uns da auch manches Aktuelle. Dabei führt der Epigrammatiker mit seinem beißenden Spott in der Regel keine realen Zeitgenossen vor: parcere personis, dicere de vitiis ist sein Leitmotiv, „(echte) Personen verschonen, statt dessen über Fehleinstellungen sprechen“ (X 33, 10). Da ist zum einen Rücksichtnahme im Spiel. Zum anderen verbaut der Angriff auf bloße fiktive Personen und damit die Konzentration auf reale Marotten, Laster und Schwächen dem Leser den bequemen Ausweg zu glauben, dass er ja gar nicht gemeint sein könne. Unter der Maske des fiktiv Verspotteten verbirgt sich oft genug der eigene innere Schweinehund, dämmert es manch einem Martial-Leser vielleicht. Und das wäre durchaus im Sinne des Moralisten.
Martial ein Moralist? Da wird manch einer, der das liest, tief durchatmen müssen. Denn was diesem Meister des Spottepigramms lange im Weg gestanden hat und viele seine Eignung als Schulautor hat bezweifeln lassen, ist seine ausgesprochene Freude am Obszönen – sowohl in der Sprache als auch in der konkreten Schilderung sexueller Praktiken, Vorlieben und „devianter“ Verhaltensweisen. Da ist er unverblümt, oft regelrecht hemmungslos. Auch wenn die Prüderie vergangener Zeiten gottlob überwunden ist, taugt manches Epigramm auch nach heutigen liberaleren Maßstäben nicht als Unterrichtslektüre – einschließlich der Gewalt verherrlichenden Epigramme aus dem „Buch der Schauspiele“.