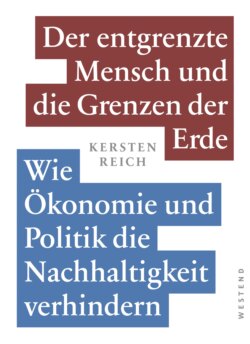Читать книгу Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 2 - Kersten Reich - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Arbeitswelt hat ein Nachhaltigkeitsproblem
ОглавлениеVerausgabte Zeit, so ist es im Alltagsbewusstsein der Moderne verankert, erzeugt Lohn und Einkommen. Zeit erzeugt aber auch Kosten, sofern sie von Tätigkeiten abgezogen werden muss, weil der Haushalt zu führen ist, die Kinder zu erziehen sind oder die freie Zeit gelebt sein will. So ist die Arbeitszeit von der Freizeit unterschieden, obwohl die Menschen auch in der freien Zeit arbeiten. Hier zeigt sich die gesamte kapitalistische Situation auf einen Blick: Es ist nicht die Zeit des Arbeitens, die den entscheidenden Unterschied setzt, sondern für wen und was der Mensch arbeitet. Vor diesem Hintergrund gibt es wichtige Aspekte, die zum Grundwissen der kapitalistischen Lebensweise gehören (obwohl sie kaum in den Schulen unterrichtet werden):
Die Arbeitsteilung erhöht den stofflichen, materiellen Reichtum und die Produktivität einer Gesellschaft. Dies schafft Chancen, sowohl qualitativ wie quantitativ mehr Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Voraussetzung ist die Entwicklung zielgerichteter, organisierter, mehr oder minder planmäßiger Arbeit, die sowohl eine fremde als auch eigene Beurteilung, Überwachung, Bewertung und Selbststeuerung aller Tätigkeiten bedingt. War früher die Aufteilung in körperliche und geistige Arbeit für die Lebenschancen entscheidend, so ist es heute das Spannungsfeld zwischen Spezialisierung mit enger Verwendbarkeit und nachfragebezogener Qualifikation mit zeitlicher Konjunktur. Solche Arbeitsteilung wirkt auch auf das Lernen, die Erziehung und Bildung umfassend ein, wozu eine allgemeine Bildung und berufsspezifische Ausbildungen gehören, aber heute treten immer mehr Konzepte lebenslangen Lernens hinzu, um je nach Nachfragelage umzulernen, umzuschulen und weiterzubilden.
Dies setzt nicht nur fachliche Qualifikationen im Blick auf unterschiedliche Arbeiten voraus, sondern auch Aufmerksamkeit, Konzentration, Durchhaltevermögen, Zeitmanagement und vieles mehr, die jeweils Arbeiten und Nutzungen begleiten. Die Entwicklung und Differenzierung dieser Arbeiten und Nutzungen in der Geschichte des Kapitalismus bis heute geht mit einer steten Erhöhung der Qualifikationen breiter Bevölkerungsschichten einher. Dabei ist eine deutliche Zunahme höherer Qualifikationen vor allem in den letzten Jahrzehnten zu beobachten, wobei daraus keine automatische Erhöhung der Löhne, sondern vor allem eine Erhöhung der gegenseitigen Konkurrenz folgt.
Der Antrieb sowohl für die Produktions- als auch die Qualifikationsseite liegt in einer allgemeinen Gewinnorientierung. Die Märkte einschließlich des Arbeitsmarktes regulieren die Gewinnerwartungen und stimulieren die Beteiligten, ihre eingesetzte Zeit effektiv zu nutzen. Zwar mag es auch immer wieder den Luxus der verschwendeten Zeit – nicht primär auf einen Markt gerichteten Zeit – geben, etwa die Künstlerin, die nur für ihre Kunst lebt, aber dann ist die Voraussetzung, dass durch andere Einkommensarten, Erbschaften oder parasitäre Teilhaben ein solches Leben gesichert wird (vgl. Reich 2018 a, Kap. 3). In der Breite bleibt der zeitliche Luxus stets die Ausnahme, wobei sowohl das Engagement für mehr soziale Gerechtigkeit als auch für Nachhaltigkeit als solcher Luxus verstanden werden, weil sie kein grundlegender Teil der gewinnorientierten Arbeitswelt sind.
Disziplinierungen wandeln sich in Selbstkontrollen, die bis zum Beginn der Moderne noch durch Fremdkontrollen dominiert waren. Die Versachlichung der Unterordnungen nimmt zu; statt sich überwiegend in persönlicher Abhängigkeit und in Hierarchien bewegen zu müssen, treten nun Sachverhalte und Prozeduren nach Regeln, Gesetzen, Ausführungsbestimmungen in den Vordergrund. Dies sind die Gesetze einer Leistungsgesellschaft, was ökonomisch meint, sich in der konkreten Arbeit (mit Fleiß, Ordentlichkeit, Pünktlichkeit und anderen Tugenden) aktiv angepasst zu verhalten. In der Gegenleistung durch Lohn bzw. höheren Lohn oder Einkommen bei höherer Qualifikation liegt die motivationale Voraussetzung einer Höherqualifizierung mit entsprechendem Aufwand.
Seit Beginn der Moderne ist zu beobachten, dass die Arbeiten und Nutzungen in einer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft vielfältiger, komplexer und vernetzter durchgeführt werden. Diese Vielfalt führt zu einer Steigerung der Unterschiedlichkeit, der Kompliziertheit und Spezialisierung. Zeitlichkeit wird zu einem Anspruchsprofil: Wo früher eng begrenzte Berufe ein Leben lang praktiziert wurden, da steht heute ein flexibles, disponibles und mobiles Anforderungsprofil mit breiter Grundbildung und persönlich möglichst umfassenden Kompetenzen im Vordergrund. Entsprechend steigt das Anforderungsprofil an die Lernarbeit. Zielgerichtete, planmäßige, organisierte, systematische und analytische Tätigkeiten nehmen zu, ihnen stehen verstärkt kooperierende, kommunikative und selbstreflexive Momente zur Seite. Unterschiedliche Entlohnungen haben den Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital verwischt, weil nun auch die Arbeitenden in unterschiedlichen Lohn- und Einkommensklassen unterschieden sind.
Die Arbeitsgegenstände und Nutzungsmöglichkeiten verändern sich. An die Stelle von Naturstoffen rücken immer mehr künstliche, synthetische Produkte, und die Arbeitsmittel, die Werkzeuge, Maschinen und Produktionsprozesse wandeln sich stark. Während der Industrialisierung finden unterschiedliche Revolutionen der Arbeit statt, die vom Fließband bis hin zur Teamarbeit reichen, die von der Taylorisierung der Einzelarbeit über die Halbautomation bis zur Vollautomation führen. Im Hintergrund steht hier eine Verwissenschaftlichung und Technologisierung der Arbeit, die zu einer enormen Erhöhung der Arbeitsproduktivität und zur kreativen Entwicklung neuer Arbeitsgegenstände und Verfahren beigetragen hat. Gleichwohl erzeugen Differenzierungen der Arbeiten eine sehr unterschiedliche Wertigkeit und Entlohnung bei gleicher Arbeitszeit. Dies führt insbesondere zu einer Benachteiligung von Frauen, Menschen mit sozialen Berufen, besonderen Begabungen oder Benachteiligungen.
Nachhaltigkeit in sozialen Fragen, wobei auf eine angemessene Entlohnung, eine gute Gesundheitsvorsorge, eine Vorsorge im Hinblick auf die Heranwachsenden, eine Beachtung der Umweltfolgen geachtet wird, das muss im Kapitalismus immer erst erstritten werden, weil solche Kosten von den Gewinnen abgehen. Dies gilt ebenso für alle Kosten der Nachhaltigkeit, die nur dann widerwillig in der Gewinnmaximierung geleistet werden, wenn sie selbst zur Kostensenkung beitragen oder gar nicht zu vermeiden sind.
Eine wesentliche Basis für die Wirksamkeit der Gewinnmaximierung ist es, dass die Kosten für Verkehr und Verkehrswege, Elektrizität, Wasser, Verwaltung, Militär und Schulen auf den Staat übertragen sind, der sie wiederum durch unterschiedliche Steuern von allen Menschen eintreibt. Obwohl der kapitalistische Unternehmer mehr als andere Menschen von solcher Infrastruktur profitiert, trägt er von Anbeginn an in der Relation nicht den gleichen Kostenanteil wie die Mehrheit der Menschen, womit auch die Nachhaltigkeitskosten im wesentlichen Maße vom Staat auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Der Staat holt sich seine Ausgaben von den Bürgerinnen und Bürgern auf der Basis von Gleichheitsgrundsätzen zurück, obwohl gerade durch solche formale Gleichheit die Ungleichheit der Abgaben untermauert wird. Wenn beispielsweise ein Manager das 1000-Fache eines Arbeitenden verdient, wieso sollte dann nicht auch diese Relation bei der Besteuerung von CO2-Kosten herangezogen werden? Eine solche Denkweise liegt dem kapitalistischen System grundsätzlich fern, weil es auf vermeintlichen Leistungsprinzipien und Gleichheitsgrundsätzen beruht. Allerdings hat niemand bisher nachweisen und begründen können, warum eine Leistung mit hohen Faktoren wie 100 oder 1000 besser als eine andere sein soll und was dies noch mit Gleichheit zu tun haben könnte.