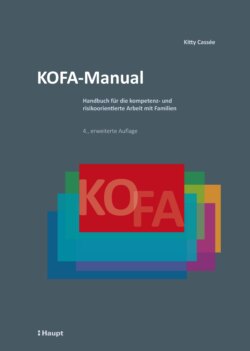Читать книгу KOFA-Manual - Kitty Cassée - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. KOFA: Kompetenz- und risikoorientierte Arbeit mit Familien 1.1 Paradigmawechsel in der Arbeit mit belasteten Familien
Оглавление[19] Familien befähigen statt Familien ersetzen: unter diesem Motto fand in den letzten Jahren ein tiefgreifender Wandel in der Hilfe für belastete Familien statt (Cassée, 2019). Dieser Paradigma-wechsel vollzog sich im deutschsprachigen Raum in großem Stil – aus fachlichen Gründen, aber auch beschleunigt durch die Finanzknappheit der öffentlichen Hand. Für den Zeitraum 1997 – 2007 berichtet Frindt (2010) von einer Verdreifachung der Fallzahlen in Deutschland: 1997 erhielten 17 von 10 000 Familien Unterstützung durch Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), 2007 waren es 52. Für die Schweiz liegen keine vergleichbaren Zahlen vor – es ist aber von einer ähnlichen Zunahme auszugehen.
SPFH wird im deutschsprachigen Raum in unterschiedlichen Formen und mit verschiedenen Konzepten angeboten (Beckmann & Schrödter, 2006; Fröhlich, 2006; Helmig et al., 1997, Helmig, 2004). Es liegen nur wenige Evaluationsstudien zur aufsuchenden Familienarbeit vor (Erzberger, 2004; Frindt & Wolf, 2009; Cassée et al., 2010). Die als Programm strukturierte, dokumentierte und evaluierte Arbeit mit Familien ist im deutschen Sprachraum wenig bekannt, in den USA, in England, Australien und in den Niederlanden haben solche Programme hingegen eine lange Tradition. Es entstanden verschiedene Programme, in denen das Kind auch bei hoher Problembelastung (Delinquenz, Drogenkonsum der Eltern und/oder der Kinder, Kriminalität, Schulversagen, psychischer Erkrankung etc.) in der Familie belassen und intensiv und hoch strukturiert im Familiensystem gearbeitet wurde. Diese Programme, die z.B. in Holland als «Families First» (Berger & Spanjaard, 1999), in Deutschland als «FamilienAktivierungsManagement» (Pieper, 2013), oder «Homebuilders-Model» (Kinney et al., 1991) und jüngeren Datums als «Multisystemic Therapy» (MST, Henggeler & Lee, 2003; Swenson & Henggeler, 2005) und «Functional Family Therapy» (FFT, Sexton & Alexander, 2005) angeboten werden, wurden systematisch evaluiert und zeigen im Vergleich zu einer stationären Unterbringung gute Resultate bei bedeutend tieferen Kosten. 1 Alle Interventionsformen in dieser Tradition leisten möglichst wenig invasive und möglichst kurze und strukturierte Hilfe, bei der die Familienmitglieder aktiv einbezogen werden.
In den Niederlanden wurden einige dieser Programme (v.a. aus den USA) ab 1990 eingeführt, allerdings erweitert um entwicklungspsychologische und lerntheoretische Theoriebausteine und um die Instrumente aus dem Kompetenzmodell (Berger & Spanjaard, 1999; van Vugt & Berger, 1999; Spanjaard & Haspels, 2005). Die holländischen Weiterentwicklungen orientieren sich explizit an den Entwicklungsaufgaben von Kindern, Jugendlichen sowie deren Eltern (vgl. Cassée, 2019). Sie überwinden die stärker familientherapeutisch geprägte Ausrichtung der englischsprachigen Programme, die in den meisten Fällen von psychologisch geschulten Fachpersonen durchgeführt werden. In Deutschland erfolgte etwas später die Einführung von Programmen in Anlehnung an die [20] amerikanischen Vorbilder unter Bezeichnungen wie «FamilienAktivierungsManagement», «Familien im Mittelpunkt» oder «Familienkrisenhilfe». Es handelt sich dabei um Adaptationen amerikanischer Vorlagen ohne die expliziten entwicklungspsychologischen Erweiterungen der holländischen Programme (vgl. EREV, 1997; Klein & Römisch, 1996, 1997; Römisch, 1998).
«KOFA – kompetenz- und risikoorientierte Arbeit mit Familien» nimmt die hier skizzierten Entwicklungslinien auf und betont ein strukturiertes und alltagsorientiertes Vorgehen. KOFA wurde als weiteres Spezifikum in Kooperation mit Praxispartnern im Bereich aufsuchender Familienarbeit als manualisierte Methodik entwickelt, implementiert und evaluiert. Das Modell nennt sich kompetenzorientiert, weil es Eltern und Kindern diagnosegestützt befähigen und aktivieren will, die Aufgaben des Alltags gelingend, d.h. kompetent, zu bewältigen (siehe ausführlicher Kap 3). Neu ist der Blick auf die Risikoorientierung (Kapitel 4), die im Zuge der Ausdifferenzierung der Kindesschutzmaßnahmen und der Professionalisierung der Kinderschutzbehörden an Bedeutung gewonnen hat.