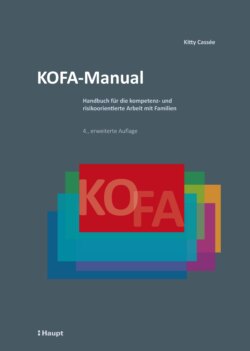Читать книгу KOFA-Manual - Kitty Cassée - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 KOFA ist kompetenzorientiert
ОглавлениеKOFA ist eine kompetenzorientierte Methodik. Die Kompetenzorientierung ist die auf den deutschsprachigen Kontext adaptierte und erweiterte Version des Kompetenzmodells, wie es vor allem vom PI-Research – einem Institut für die Entwicklung und Evaluation von Programmen für die Kinderund Jugendhilfe aus den Niederlanden – entwickelt wurde. Das Kompetenzmodell hat sich in den Niederlanden in den letzten 30 Jahren als fachliche Grundlage für eine Reihe von Methodiken durchgesetzt. Das Modell ist theoretisch fundiert in einer entwicklungspsychologischen, systemischen sowie kognitiv-verhaltenstheoretischen Tradition und hat sich – neben anderen Theorieansätzen, die sich sinnvoll verknüpfen lassen – in der Praxis bewährt, wie viele niederländische Evaluationsstudien zeigen (siehe www.nji.nl). Aus unserer Sicht stellt die Kompetenzorientierung die Arbeit mit Familien auf eine neue Basis, die uns im deutschsprachigen Raum bisher gefehlt hat. KOFA orientiert sich deshalb für die Arbeit mit belasteten Familien an diesem Modell (vgl. Spanjaard & Haspels, 2005), das wir in den letzten Jahren weiterentwickelt haben.
Der Begriff Kompetenz wird in der Fachliteratur nicht einheitlich bestimmt. Eine Definition aus dem deutschen Sprachraum zu Beginn:
Definition 1
[26] Unter Kompetenz verstehen wir die Verfügbarkeit und die Anwendung von kognitiven, emotionalen und motorischen Ressourcen, die in konkreten sozialen Situationen zu einem langfristig günstigen Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen für den Handelnden führen und die von der sozialen Umwelt als akzeptabel bewertet werden (Hinsch & Pfingsten, 2002, S. 5).
In der holländischen Literatur finden wir sehr «handliche» Definitionen – die folgende übernehmen wir für dieses Manual:
Definition 2
Kompetenz heißt: Personen verfügen über genügende Fähigkeiten und nutzen diese, um die Aufgaben, mit denen sie im Alltag konfrontiert sind, adäquat zu bewältigen (nach Slot & Spanjaard, 2009, S. 40). Kompetenz ist gelingendes Tun in konkreten Situationen.
Kompetenz hat demnach eine normative Komponente: Kompetenz bemisst sich an der Beurteilung der Angemessenheit von Verhalten in konkreten Situationen des alltäglichen Lebens. Was adäquat und inadäquat ist, ist keine Eigenschaft einer Person und ist nicht objektiv festgelegt. Kompetenz hat demnach mit den Normen und Erwartungen der Gesellschaft, der sozialen Umgebung und den Besonderheiten der jeweiligen Situation zu tun. Jemand wird als kompetent beurteilt, wenn ein Gleichgewicht besteht zwischen den Aufgaben, vor die er gestellt wird, und den Fähigkeiten und Ressourcen, die er besitzt, um diese gelingend zu bewältigen (vgl. ausführlich dazu Cassée, 2019).
Kompetenz als gelingendes Tun kann gut als Balance zwischen Aufgaben und Fähigkeiten dargestellt werden.
Abbildung 2: Grundmodell der Kompetenz
Aufgaben – Entwicklungs- und Erziehungsaufgaben
[27] Für die Aufgabenseite greift die Kompetenzorientierung auf das Konzept der Entwicklungsaufgaben zurück (siehe Kap. 2.2). Damit das Modell im Alltag einer Familie vergleichbar eingesetzt werden kann, sind die Entwicklungsaufgaben für verschiedene Altersabschnitte sowohl für die Kinder als auch für die Eltern im Instrument Kompetenzprofil konkret beschrieben. Diese Kompetenzprofile (KP) wurden mit Hilfe von Leitfragen konkretisiert, die im direkten Klientenkontakt für Gespräche oder Beobachtungen genutzt werden können. Die Entwicklungsaufgaben mit Leitfragen sind Bestandteil des Werkzeugkastens.
Fähigkeiten
Unter Fähigkeiten verstehen wir alles, was eine Person denken, fühlen, wollen und tun kann. Darunter sind auch Begriffe wie Fertigkeiten und Motivation subsummiert. Wir unterscheiden soziale, emotionale, kognitive, volitive und physische Fähigkeiten, die in den KOFA-Instrumenten ausdifferenziert und in der Diagnostikphase auf Seite der Eltern und der Kinder nach Entwicklungsalter erfasst werden. In der nachfolgenden Tabelle sind die Fähigkeiten anhand von Beispielen konkretisiert. Diese müssen pro Altersphase weiter ausdifferenziert werden: die Denkfähigkeit eines Dreijährigen wird an anderen Indikatoren sichtbar als jene eines 15-Jährigen, die physischen Fähigkeiten eines Schulkindes unterscheiden sich von jenen eines Jugendlichen.
Tabelle 2: Konkretisierung von Fähigkeiten: einige Beispiele
| Fähigkeiten | Konkretisierungen |
| soziale | Situationen und Personen angemessen wahrnehmen |
| sich einfühlen/Perspektivenwechsel | |
| verbal und nonverbal adäquat kommunizieren | |
| mit anderen zusammenarbeiten/Konflikte lösen in einer Gruppe mitmachen | |
| emotionale | eigene Gefühle erkennen, benennen und steuern |
| über gute Strategien für die Emotionsregulation verfügen Gefühle zeigen | |
| warten können | |
| Bedürfnisse aufschieben können schwierige Emotionen ertragen | |
| kognitive | gedankliche Fähigkeiten (im IQ abgebildet) |
| sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten | |
| schulisch-berufliches Wissen/schulische Leistungen Lernfähigkeit/Lernstrategien | |
| methodische Fähigkeiten | |
| volitive | Willenskraft |
| Selbstmotivation | |
| Sachmotivation | |
| Ehrgeiz/Leistungswillen | |
| [28] physische | körperliche Kraft |
| Geschicklichkeit | |
| Beweglichkeit | |
| Gesundheit |
Kompetenz als gelingendes Tun
Unter Kompetenz verstehen wir den Gebrauch von Fähigkeiten in konkreten Situationen, um anfallende Aufgaben zu bewältigen, so dass dies für die Umgebung akzeptabel ist. Kompetenz kann kurz als «gelingendes Tun» bezeichnet werden. Kompetenzorientierung beinhaltet folglich alle Bestrebungen, Kinder und deren Eltern zu gelingendem Tun zu befähigen.
Das Zusammenspiel von Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenz ist ein dynamischer Kreislauf: aus vorhandenen Ressourcen entwickeln sich in einer konkreten Umwelt und unter Einfluss externer Schutz- und Risikofaktoren Fähigkeiten, die sich als Kompetenz manifestieren können. Erlebte Kompetenz wird als Ressource über Bahnungen und neue Verdrahtungen der neuronalen Netze im Gehirn abgespeichert. Das Gleiche gilt für misslingendes Tun: fehlende Kompetenz wird als Scheitern abgespeichert und kann entmutigen und die Selbstwirksamkeit beeinträchtigen.
Die nachfolgende Abbildung illustriert den dynamischen Prozess der Kompetenzentwicklung unter den Umweltbedingungen im Lebenslauf
Abbildung 3: Zusammenhang von Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenz
Ein Kompetenzproblem – misslingendes Tun bzw. problematisches Verhalten – kann demzufolge aus ganz unterschiedlichen Gründen entstehen resp. aufrechterhalten werden:
> Neben Ressourcen bzw. Schutzfaktoren können in der Person Belastungen und Einschränkungen (Risikofaktoren) existieren. Ein Kind, das z.B. mit leichten hirnorganischen [29] Beeinträchtigungen geboren wird, hat u.U. größere Schwierigkeiten, seine kognitiven und emotionalen Ressourcen zu Fähigkeiten zu entwickeln.
> Vorhandene Ressourcen können nicht zu Fähigkeiten werden, weil Lernanregungen fehlen. So können gute Intelligenz und Lernmotivation unter ungünstigen Bedingungen nicht zu relevanten Fähigkeiten werden, weil externe Schutzfaktoren weitestgehend fehlen (z.B. Unterstützung durch Eltern oder Lehrpersonen).
> Vorhandene Fähigkeiten können aus internen oder externen Gründen nicht als Kompetenz manifest werden. Gute Fähigkeiten in einer Fremdsprache können z.B. dann nicht als Kompetenz erkannt werden, wenn ein Schüler sich im Unterricht nicht beteiligt, oder wenn eine Lehrperson ihn nicht zu Wort kommen lässt.
> Fehlende Kompetenzerfahrungen resp. Erfahrungen von Kompetenzmängeln werden als Entmutigung bzw. als Versagen abgespeichert und belasten als Risikofaktor die weitere Entwicklung.