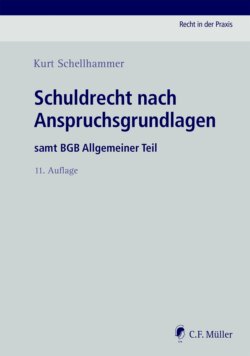Читать книгу Schuldrecht nach Anspruchsgrundlagen - Kurt Schellhammer - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Das Menschenbild des BGB einst und jetzt
Оглавление9
Das BGB ist ein Kind seiner Zeit, das Produkt der Pandektenwissenschaft vom römischen Recht und des wilhelminischen Kaiserreichs. Erklärte Ziele waren die Rechtseinheit und die Rechtsgleichheit im bürgerlichen Recht. In deutschen Landen galt erstmals ein einheitliches Zivilrecht. Die feudale Gesellschaft des Mittelalters wurde rechtlich durch die bürgerliche Gesellschaft der Freien und Gleichen abgelöst. § 1 drückt dies verschämt so aus, dass die Rechtsfähigkeit des Menschen mit Vollendung der Geburt beginne. Gemeint ist die Rechtsfähigkeit aller Bürger ohne Ansehen der Person, ihres Alters, Standes oder Geschlechts, das späte Ergebnis der französischen Revolution und des napoleonischen code civil. Das Vertrags- und Vermögensrecht des BGB gründet auf dem wirtschaftlichen Liberalismus. Vertrags-, Eigentums- und Testierfreiheit sind die höchsten Werte. Sie sind zugeschnitten auf den freien und gleichen, vernünftigen und selbstverantwortlichen Bürger, der sich selbst zu helfen weiß und im freien Spiel der Marktkräfte nicht nur sein eigenes Glückt findet, sondern auch noch dem allgemeinen Wohl dient. An der sozialen Lage seiner Zeit hatte das BGB nichts auszusetzen. Der Unternehmer war noch Herr im eigenen Haus. Mit den abhängigen Lohnarbeitern schloss er gewöhnliche Dienstverträge nicht anders als mit seinem Anwalt oder Arzt. Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und Arbeitsgericht waren noch Fremdwörter. Für die Armen und Schwachen hatte das BGB kein Herz. Ihnen halfen von Fall zu Fall allenfalls die Generalklauseln von den „guten Sitten“ und von „Treu und Glauben“ (§§ 138, 242).
Das BGB hat nicht nur Kaiserreich, Weimarer Republik und Drittes Reich, sondern auch noch zwei verheerende Weltkriege überlebt, im Kern erstaunlich unversehrt. Offenbar kann ein technisch ausgefeiltes Gesetz vielen Herren dienen, ganz wie der Jurist, der es formuliert, auslegt und anwendet. Seit 1900 ist das Zivilrecht innerhalb wie außerhalb des BGB immer wieder reformiert worden. Verschont geblieben ist, sieht man vom Verjährungsrecht ab, der Allgemeine Teil. Allem Anschein nach ist er gegen Reformen immun. Wie soll man auch unverzichtbare allgemeine Rechtsbegriffe reformieren. Das Schuldrecht ist kurzlebiger. Kauf, Miete, Gesellschaft und unerlaubte Handlung gibt es zwar nach wie vor, aber soziales Mietrecht, Verbraucherschutz und Schuldrechtsreform haben sein Gesicht verändert. Das behäbige Sachenrecht, ergänzt durch WEG und ErbbauRG, hat die Zeitläufe im Kern unbeschädigt überstanden, das Erbrecht nicht minder. Im Familienrecht dagegen blieb kein Stein auf dem anderen. Man wundert sich fast, dass es die Ehe zwischen Mann und Frau noch gibt.
10
Der Geist des BGB hat sich aber auch dort gewandelt, wo sein Text noch immer der alte ist. Das Menschenbild des Grundgesetzes färbt auch auf das BGB ab. Die Grundrechte sind zwar keine Privatrechte, sondern Abwehrrechte des Bürgers gegen staatliche Willkür[5]. Als verfassungsrechtliche Grundentscheidungen aber bilden sie eine objektive Wertordnung höchsten Ranges, an der das einfache Recht zu messen ist[6]. Auch Zivilrechtsnormen sind „im Lichte“ des Grundgesetzes verfassungskonform so auszulegen, dass die Grundwerte der Verfassung zur Geltung kommen[7]. So ist die Vertragsfreiheit als Teil der allgemeinen Handlungsfreiheit des Art. 2 I GG im Kern unantastbar[8]. Vor allem die Generalklauseln der §§ 138, 157, 242, 826 mit ihren weiten, ausfüllungsbedürftigen Begriffen wie „gute Sitten“ oder „Treu und Glauben“ sind die Einfallstore für die Grundrechte der Verfassung[9]. Dass die Zivilgerichte das BGB verfassungskonform auslegen und anwenden, überwacht auf Verfassungsbeschwerde einer Prozesspartei das Bundesverfassungsgericht (Art 93 I Nr. 4a GG).
Beispiele
| - | Die öffentliche Hand muss die Bürger nach Art. 3 GG auch dann gleich behandeln, wenn sie am Privatrechtsverkehr teilnimmt (BGH 65, 284; 91, 84; NJW 59, 431; 69, 2195; 85, 197; 85, 1892; zum AGG: RN 1896). |
| - | Was „gute Sitten“ (§ 138) seien, und was Treu und Glauben (§ 242) bedeuten, bestimmt weithin die Wertordnung des Grundgesetzes (RN 1172, 2358). |
| - | Im sozialen Mietrecht prallen das Eigentumsrecht des Vermieters (Art. 14 I 1 GG) und das Recht des Mieters auf sozialen Bestandsschutz und effektiven Rechtsschutz (Art. 20 III GG) derart hart aufeinander, dass das Bundesverfassungsgericht zunehmend in die Rolle eines obersten Mietgerichts gedrängt wird (RN 250 ff.). |
| - | Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das als „sonstiges Recht“ nach § 823 I absoluten Deliktsschutz genießt, hat man direkt aus Art. 1 und 2 GG abgeleitet. Da es auch die persönliche Ehre einschließt, ist der zivilrechtliche Ehrenschutz nicht mehr auf § 823 II mit §§ 185 ff. StGB angewiesen, sondern lässt sich unmittelbar auf § 823 I stützen. Aber man muss das Persönlichkeitsrecht des Beleidigten nach subtilen Regeln gegen das Recht des Beleidigers auf freie Meinungsäußerung nach Art. 5 GG abwägen (BVerfG NJW 95, 3303). |