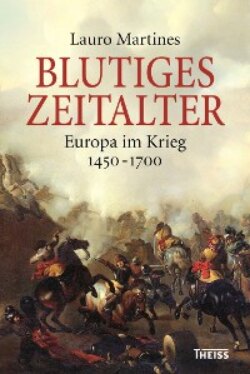Читать книгу Blutiges Zeitalter - Lauro Martines - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Florenz gegen Pisa (1406)
ОглавлениеAnfang 1406 näherte sich eine Armee von Söldnern dem Hafen von Pisa, die mit ihren Booten Vorräten für die Belagerer heranbrachten. Bezahlt wurden die Söldner von Europas gebildetster Stadt, der Republik von Florenz, 80 Kilometer östlich von Pisa.
Pisa war einst ein wichtiger Akteur im Seehandel gewesen, ein Rivale der Seefahrerrepubliken Genua und Venedig. Im 12. und 13. Jahrhundert waren Schiffe aus Pisa, mit Waren und Kaufleuten beladen, regelmäßig über das Mittelmeer nach Akkon gesegelt, nach Konstantinopel, nach Alexandria und Tunis, nach Sardinien und Sizilien. Nun aber war eine alte Feindschaft wieder ausgebrochen, die die zwei Nachbarstädte gegeneinander aufhetzte. Die Zwergrepublik Pisa war von ihren temporären Lehnsherren de facto verkauft worden; im Spätsommer 1405 hatte Florenz für Pisa einen Teil der von den Stadtherren verlangten 206.000 goldenen Florine ausgezahlt.
Aber der Käufer hatte mit einem nicht gerechnet: dem Stolz und Mut der Pisaner. Florenz hatte die Festung am Rande der Stadt besetzt, sah sich aber aufgrund eines Überraschungsangriffs seiner Ansprüche beraubt; bisher war es dem neuen Besitzer nicht gelungen, seinen Besitzanspruch geltend zu machen. Die Florentiner sahen sich bereits als rechtmäßige Eigentümer von Pisa, auch wenn niemand die Pisaner gefragt hatte, was sie davon eigentlich hielten.
Zwischen November 1405 und Juni 1406 gelang es den entschlossenen Pisanern immer wieder, die Belagerer abzuwehren, den großen Wassergraben zu überqueren und über die Mauern zu klettern. Mitte Mai war die umkämpfte Stadt komplett von der Lebensmittelversorgung abgeschnitten. Weder zu Lande noch zur See konnten Vorräte den Ring aus Kavalleristen und Infanteristen überwinden. In der Hafenstadt herrschte bitterer Hunger. Man aß Katzen, Hunde, Ungeziefer, Wurzeln und jedes bisschen Grün, das man in der Stadt fand: „Das Gras auf den Plätzen hatte man ausgerissen, getrocknet, gemahlen, und aus dem pulverartigen Staub buk man Brot.“ Für Pisa bestimmte Schiffe mit Getreideladungen aus Sizilien wurden nahe der Mündung des Arno gestoppt und ihre Ladung statt an die Pisaner an den Feind, die Florentiner, verkauft. Der Getreidepreis in Pisa kletterte in solche Höhen, dass Schmuggler aus Lucca, wenn sie versuchten, sich nachts an den Wachen vorbei in die Stadt zu schleichen, für winzige Mengen Korn ihr Leben riskierten.
Immerhin bestand stets die Chance, dass Florenz die Belagerung abblasen würde, da auch diese immense Kosten verursachte. Doch zunächst beschlossen die Kommandanten von Pisa Ende April im verzweifelten Versuch, noch länger durchzuhalten, „mittellose und nutzlose Menschen“ (sprich: Bettler und arme Leute) aus der Stadt zu werfen, damit das bisschen, was an Nahrung verblieb, den Bewaffneten und den Wohlhabenderen zugutekäme. Denn trotz der rasch schrumpfenden Vorräte teilte man noch immer Almosen an die Hungernden aus.
Die „Kommissare“ von Florenz – die zivilen ‚Bosse‘ im Feld – reagierten auf die Entscheidung der Pisaner mit einer ähnlich drastischen Maßnahme: Sie beschlossen, dass jeder, der die Stadt Pisa verließ, gehängt würde. Diese Verordnung wurde vor Pisas Stadttoren durch Fanfarenstöße angekündigt und dort, so laut es nur ging, verlesen. Die Belagerer bauten darauf, dass der Hunger Pisa zur raschen Kapitulation zwingen würde. In der Stadt war man bereits Zeuge drastischer Grausamkeiten geworden. Einige Wochen zuvor hatte man einen Pisaner Soldaten gefangen genommen; er war verschnürt und „wie ein Stein“ per Katapult über die Stadtmauer geschleudert worden. Auf der Straße fand man seine zerschmetterte Leiche, ein Schild um den Hals: „Dieser Tod erwartet alle, die Pisa verlassen.“
Keine der beiden Seiten gab nach. Als die erste Gruppe armer Frauen aus Pisa vertrieben wurde und vor den Stadtmauern erschien, verzichteten die Söldner aus Florenz darauf, sie zu töten – ein Akt der Barmherzigkeit. Stattdessen zerschnitten sie ihnen am Rücken die Kleidung und entblößte ihre Hintern, auf die man mit einem Brandeisen die Fleur-de-lis einbrannte, eines der Symbole im Wappen von Florenz. Dann jagten die Söldner sie zurück in Richtung Stadtmauer. Als klar wurde, dass das Brandmarken den Strom armer Frauen nicht aufhalten konnte, schnitt man ihnen die Nase ab, bevor man sie zurückschickte. Es wurden auch ein paar Männer aus der Stadt geworfen, und diese hängte man, entweder direkt vor Ort oder dort, wo man sie von den Verteidigungsanlagen der Stadtmauer gut sehen konnte – eine Lektion für alle Pisaner.
Doch die Florentiner setzten nicht nur auf den Hunger, sondern auch auf Tod und Verderben durch Geschosse, die sie hin und wieder in die Stadt regnen ließen. Zum ersten Mal war die verhängnisvolle Kombination aus Schießpulver und Artillerie in Europa in den 1340er-Jahren zur Anwendung gekommen. So vernahmen die Pisaner im Jahr 1406 das Geräusch der „Bombarden“, auch wenn diese neue Waffe erst um 1450 herum einigermaßen zielgenau funktionierte. So tödlich wie eh und je waren jedoch die riesigen Steine schleudernden Wippkatapulte oder Perriers. Damit gelang es den Belagerern besonders gut, die Bewohner Pisas in Angst und Schrecken zu versetzen. Und der Kriegsterror machte nicht an den Stadtmauern Halt: Die ganze Gegend wurde von den Söldnern terrorisiert; Felder, Dörfer und kleine Städte wurden nach Lust und Laune geplündert und in Brand gesetzt. Ein Großteil der Beute, beispielsweise Getreidevorräte, landete in Florenz.
Laut dem zivilen Befehlshaber im Feld, dem Florentiner Politiker Gino Capponi, hatten die Söldner von Florenz eine goldene Zukunft vor sich: Bei einer erfolgreichen Eroberung von Pisa – so war ihnen versprochen worden – würden sie doppelten Sold erhalten, die Stadt plündern dürfen, und obendrein würden Prämien von insgesamt 100.000 Florin ausgezahlt. Doch im Sommer, als langsam klar wurde, dass man Pisa regelrecht würde aushungern müssen, verabschiedet Florenz sich von der Idee, die Stadt zu plündern und damit das Hab und Gut der Pisaner in die Hände von Freibeutern fallen zu lassen.
Die Motive dafür waren alles andere als altruistisch: Warum sollte man den ganzen Reichtum irgendwelchen Söldnern überantworten, wenn man den Großteil davon später selbst würde verwenden oder zumindest besteuern können?
Deshalb gaben die Kommissare nun strikte Anweisungen aus. Wenn Pisa fiel, dürfe es keine Plünderungen geben, und zwar unter Androhung der Todesstrafe. Die Einnahme der Stadt sollte diszipliniert vor sich gehen und den Anschein der Großmütigkeit erwecken. Bereits einige Monate zuvor hatte es sich gezeigt, dass der befehlshabende Kommandant des Angriffs auf den Hafen, der römische Adlige Bertoldo degli Orsini, ein viel größeres Interesse daran hatte, das Umland zu plündern, als Pisa einzunehmen; deshalb wurde er mit seinem kleinen Truppenverband aus Florentiner Diensten entlassen.
Am Ende fiel Pisa aufgrund eines Verrats des ehrgeizigen Bürgers Giovanni Gambacorti, der sich dafür mit 20.000 Florin und mehreren Immobilien in Florenz belohnen ließ. Teil des Deals war zudem, dass er das Florentiner Bürgerrecht erhielt, ohne Steuern zahlen zu müssen. Alle diese verräterischen Machenschaften wurden im Verborgenen eingefädelt und abgewickelt. Am 9. Oktober 1406 wurden noch vor Morgengrauen (die meisten Pisaner schliefen noch) die Stadttore geöffnet, und die Florentiner Armee marschiert ein. Die Bürger werden unter dem Klang der Trommeln erwacht sein. Fassungslos sahen sie aus ihren Fenstern. Die Auswirkungen des Hungers konnten sie indes kaum verbergen – ein Florentiner berichtete, dass die Pisaner „abstoßend und erschreckend aussahen, ihre Gesichter waren vom Hunger ausgehöhlt“. Einige der Soldaten brachten Brot mit und warfen es den halb verhungerten Einwohnern zu, vor allem den Kindern; die Reaktion war schockierend: Sie glaubten, „gefräßige Raubvögel“ vor sich zu sehen, Geschwistern rissen einander Stücke des Brotes aus den Händen, Kinder kämpfen darum mit ihren Eltern.
Daheim in Florenz sorgte die Nachricht von der Kapitulation für wahre Freudenfeste. Zahlreiche Kirchenglocken erklangen in der Stadt, und drei Tage lang gab es Freudenfeuer, Prozessionen, Feste, Ritterspiele und eine feierliche Messe im Baptisterium San Giovanni, wo man Gott dafür dankte, dass er den Florentinern vom Himmel herab ein so glückliches Geschick gesandt hatte. Jetzt endlich besaßen sie eine große Hafenstadt, der, wenn man so will, ihren literarischen Möglichkeiten entsprach. Die Stadt Florenz hatte bereits um 1400 Literatur produziert, auf die eine ganze Nationen hätte stolz sein können: Man denke nur an Dantes Göttliche Komödie, Petrarcas große Sonettsammlung Canzoniere oder Boccaccios Decamerone. Machiavelli, Michelangelo und viele weitere Berühmtheiten kannte Florenz da noch gar nicht!
Pisas brennender Hass auf die Florentiner loderte noch mehr als hundert Jahre, und 1494, als die Italienkriege (1494–1559) ausbrachen, kam es sofort zu einer Revolte der Stadt gegen Florenz.