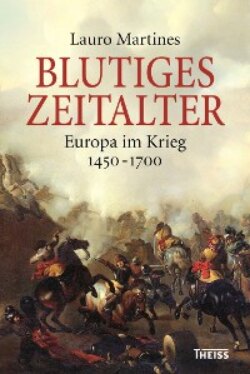Читать книгу Blutiges Zeitalter - Lauro Martines - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Thesen
ОглавлениеBevor wir zum „Kriegsmosaik“ kommen, möchte ich kurz die wichtigsten Thesen und die Themen vorstellen, die durch dieses Buch führen.
Die Staaten des frühneuzeitlichen Europa gaben ihr Geld mit Abstand am liebsten für Kriege aus, und die dafür verfügbaren Geldmittel gingen ihnen niemals aus. Die Steuersysteme waren mitunter hochkomplex, aber zugleich auffallend ineffizient und leicht korrumpierbar. Als Folge davon waren die großen kriegführenden Staaten chronisch verschuldet und rangierten nicht selten immer wieder an der Grenze zur Insolvenz. Doch selbst wenn sie mehr oder weniger zahlungsfähig waren, erreichten die lebensnotwendigen Gelder (oder Kredite) die Soldaten in den Kriegswirren manchmal überhaupt nicht. In diesem Fall kam es öfter vor, dass die verzweifelten Truppen sich an der Zivilbevölkerung schadlos hielten, allein um nicht zu verhungern.
Die massive Aufzehrung der finanziellen Ressourcen, die durch die Truppenbewegungen herbeigeführt wurde, veränderte nach und nach die sich entwickelnden Nationalstaaten – erst Spanien und Frankreich, dann die Niederlande, Schweden, das habsburgische Österreich, Russland und Brandenburg-Preußen. In Kriegszeiten geriet die Schuldenmasse dieser Länder geradezu außer Kontrolle, selbst wenn sie neue Steuern erhoben, mehr Vertragspartner und Verwalter beschäftigten, neue Ministerien schufen und so schrittweise einen Beamtenapparat modernen Zuschnitts entstehen ließen. Aber die treibenden Kräfte im Staat waren und blieben der Krieg und die Ambitionen der Fürsten, und finanzielle Engpässe oder die Klagen ihrer verzweifelten Armeen hielten sie da nur kurzzeitig im Zaum.
Nach 1500 verschärften sich zwischen den Fürsten die Rivalitäten und die miteinander konkurrierenden Gebietsansprüche. Die Kriege wurden intensiver, die Armeen wurden größer oder blieben länger im Feld. In Europas bevölkerungsreichsten Regionen sah man sie fast täglich auf den Straßen und entlang der Flüsse. Im 16. Jahrhundert tauchten immer mehr Söldner, Wehrpflichtige und gegen ihren Willen eingezogene Soldaten auf; die Zahl der traditionell ausgehobenen Freiwilligen konnte die große Nachfrage nicht mehr befriedigen – die Kriege dezimierten sie zu stark. Zwar waren diese Männer nicht annähernd so gut ausgebildet wie die früheren Profis, aber dafür waren sie auch nicht so teuer. Die besseren Soldaten waren aber nach wie vor das Rückgrat dieser Armeen und konnten höhere Löhne fordern.
Durch ihre überraschende Fähigkeit, eine so große Zahl von Soldaten ins Feld zu schicken, gewannen die Staaten an Macht, und diese Macht verwendeten sie dazu, sich gegenüber den institutionellen Kirchen, gegenüber regionalen Bürgerversammlungen und der Privatwirtschaft, gegenüber dem Bürgertum und dem niederen Adel zu positionieren. Der Hochadel behielt noch eine ganze Zeitlang besondere Privilegien, aber gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurden auch diese stark beschnitten. Und manchmal setzte man auch Soldaten dazu ein, diese neuen Machtverhältnisse durchzusetzen.
Die meisten der vorstehenden Ausführungen finden sich hier und da in diversen Studien über die Kriege zwischen 1450 und 1700. Aber nur sehr selten (wenn überhaupt jemals) hat man sich darum gekümmert, welches Gesamtbild das Ganze ergibt. Ich entnehme sie einer reichen Forschungsliteratur, die ich oft in den Anmerkungen zitiere, und ich schulde ihren Autoren einiges an Dank. Im Laufe der letzten 25 Jahre hat sich die Sozialgeschichte der Kriege langsam davon verabschiedet, immer speziellere militärische Belange zu untersuchen, und sich mehr um den größeren Kontext gekümmert, um die Masse der einfachen Soldaten und um die Stimme der Zivilisten, die unter den Kriegen zu leiden hatten. Aber es bleibt noch viel zu erforschen, vor allem in Bezug auf den Umfang der Gewalt, den Ausbruch von Krankheiten, die Praxis der Einquartierung von Soldaten in zivilen Haushalten, die Stellung der Frauen im Verband von Wagenkolonnen, die Beziehungen zwischen Offizieren und ihren Mannschaften sowie wichtige logistische Fragen. Diese großen Forschungslücken rechtfertigen die Behauptung, dass es im Moment bei der Beschäftigung mit Krieg und Armeen noch immer zu sehr um die feinen Details der großen Schlachten geht und um die großen außenpolitischen Strategien – zumindest für meinen Geschmack. Keine einzige selbst der wichtigsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges war politisch von entscheidender Bedeutung, und für die Italienischen Kriege (1494–1559), die Hugenottenkriege (1562–1598) und die Kriege der spanischen Krone in den Niederlanden (1567–1648) kann man Ähnliches konstatieren.
Doch was ist denn dann so neu oder anders an diesem Buch?
Bedenkt man die damaligen Versorgungs- und Transportbedingungen, so war es ein geradezu erstaunliches Unterfangen, eine Armee von 20.000 Mann aufzustellen. Zunächst mussten hunderte von Hauptleuten, Obersten und lokalen Kontakten ausschwärmen, um überhaupt Rekruten zu finden. Als Nächstes mussten die Mannschaften von A nach B bewegt und versorgt werden, und das benötigte eine sorgfältige Organisation sowie schnellen Zugriff auf immense Mengen von Arbeitskraft und Kapital. Nur ein großer Fürst oder eine wohlhabender Republik (Venedig oder die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen) konnte ein solches Unternehmen starten.
Den Bildern, die sich in diesem Buch entfalten, sind Überlegungen wie diese nie ganz fern. Dabei geht es um die Tatsache, dass die großen Armeen im Europa der Frühen Neuzeit letztendlich zerbrechliche Monster waren, die von Krankheiten, Fahnenflucht, ausbleibendem Sold und Meuterei in Mitleidenschaft gezogen wurden – und oft genug mit heftiger Gewalt reagierten.
Daneben möchte ich auf ein merkwürdiges Paradox hinweisen: das Kuriosum, durch welches Staaten in der Lage waren, Armeen auszuheben, die andere Staaten vernichten konnten, dadurch aber zugleich im Zentrum ihrer finanziellen Existenz veritable Schwarze Löcher unterhielten. Um diesen Widerspruch zu überwinden, bediente man sich (wie wir sehen werden) ausgeklügelter Hilfsmittel und Kreditmechanismen. Zu dieser Zeit traten als neue Schlüsselfiguren im Kriegsgeschäft die Bankiers auf den Plan.
Wenn wir als Kriegsschauplatz jene Orte definieren, an denen es zu militärischer Gewalt kommt, dann sollte sich die Geschichte der Kriege im 16. und 17. Jahrhundert auf die Beziehungen zwischen Soldaten und Zivilisten konzentrieren – insbesondere auf die eher unschönen Begegnungen dabei. Denn die europäische Kriegführung jener Zeit richtete sich in der überwältigenden Mehrheit gegen die Zivilbevölkerung in Stadt und Land. Deshalb konzentriert sich dieses Buch in erster Linie auf die Belagerung und Plünderung von Städten, auf Vorfälle von Raub und Mord auf dem Lande, auf den desolaten Zustand der einfachen Soldaten, auf die Schrecken der Zwangsrekrutierung sowie auf die grassierenden Krankheiten und Seuchen. In einem gewissen Sinne soll eine solche breitere Sicht auf die Dinge es ermöglichen, von der abstrakten gesellschaftlich-politischen Analyse zu den tatsächlichen Ergebnissen der blutigen Kriege zu gelangen und zu verstehen, was sie für die Menschen tatsächlich bedeuteten.
Diesem Gewebe aus Angst und Schrecken eine erzählerische Struktur zu verleihen, wird eine Frage des Tempos und der Akzentsetzung sein. Dies war für mich der schwierigste Aspekt beim Verfassen dieses Buches. Der Krieg bringt auch einen Sachbuchautor an seine Grenzen.
Anmerkung der Redaktion
Im vorliegenden Band verwendet der Autor anachronistisch moderne Länderbezeichnungen (z.B. Deutschland, Österreich, Italien etc.). Zur leichteren Verortung für den heutigen Leser wurden diese geographischen Angaben originalgetreu übersetzt.