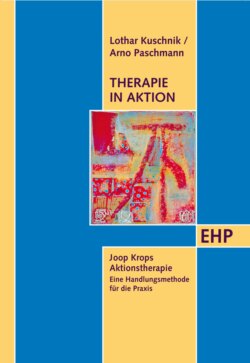Читать книгу Therapie in Aktion - Lothar Kuschnik - Страница 10
Оглавление| B | B | Biographie I |
| 1. | Einleitung |
Es ist Freitag, der 8. April 2011. Wir drei Freunde, Arno, Gertrud und Lothar, sitzen in einem typisch amerikanischen Frühstücksrestaurant. „Southern Kitchen“ in Los Gatos. Wir kämpfen mit der Speisekarte, dem schnellen, routinierten amerikanischen Englisch der Bedienung und den Anstrengungen der Reise. Ach ja, und ein bisschen aufgeregt sind wir auch. Um 10 Uhr sind wir mit Joop Krop verabredet. Als wir mit Joop am Telefon über dieses Projekt gesprochen hatten, erzählte er, dass er in einem Rollstuhl sitzt, kaum noch Kontrolle über seine Beine hat und seine Sprache nach einem Schlaganfall verlangsamt ist. Die Zeit drängte, wenn wir mit ihm sprechen wollten. Also Flüge gebucht, Technik klar gemacht und auf in die USA. Zehn Tage Kalifornien und die Geschichte eines ganzen Lebens erwarten uns. Deshalb sind wir aufgeregt. Wir hatten Joop schon vorab gebeten, uns sein Leben in groben Zügen zu schildern. Was wir da lesen, macht uns immer neugieriger. Wir verabreden, jeden Tag zwei Sitzungen mit ihm zu machen, wissen aber nicht, ob das überhaupt klappt, ob seine Kräfte das zulassen.
Das Frühstück, amerikanisch üppig, ist verzehrt. Jetzt geht es los. Wir suchen die Straße, in der Joop wohnt. Das ist in dem kleinen Ort Los Gatos, eine Autostunde von San Francisco entfernt, nicht sehr schwierig. Um 10 Uhr stehen wir vor einem Holzhaus in einer ruhigen Nebenstraße. Vor der Haustür steht ein älterer SUV mit dem Aufkleber „WAR is NOT the ANSWER“ vom Friends Commitee on National Legislation (FCNL). Wir ziehen am Stab, der eine Klinge betätigt. Sofort ertönt Joops Stimme: „Kommt mal rein“, ruft er auf Deutsch. Das tun wir.
Nach einer herzlichen Begrüßung mit Joop lernen wir Truus kennen, seine Frau. Hellwache Augen, gebeugte Gestalt und ein umwerfender Humor. Wir sind etwas geschockt, als sie gemeinsam mit der mexikanischen Haushaltshilfe den großen und immer noch kräftigen Joop aus seinem Rollstuhl in seinen Sessel hebt. Er hat einen breiten Riemen um seinen Bauch. An dem heben ihn die beiden Frauen hoch, so dass er mit schleifenden Beinen in seinen Sessel sinken kann. Seine Arme kann er kaum noch gebrauchen, sie zittern und sind sehr eingeschränkt in ihren Bewegungsmöglichkeiten. Lothar muss noch eine schwierige Klippe meistern. Joop hatte mit uns als Viererteam gerechnet. Lothars Frau Susanne, ebenfalls Gestalttherapeutin und seinerzeit Trainerin bei dem niederländischen Institut HEEL, ist im Oktober letzten Jahres an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Das wollten wir Joop nicht am Telefon mitteilen. Jetzt sagt Lothar es ihm, und wir sehen, wie seine Gesichtszüge entgleisen. Das Schicksal von Susanne füllt für einige Augenblicke den Raum. Nur 14 Wochen nach der Diagnosestellung am 2. Juli stirbt sie am 17. Oktober. Hinter nüchternen Fakten scheint ein Leben auf, sie ist plötzlich ganz präsent. Wir spüren alle fünf, wie fragil menschliches Leben ist, und Joop spürt es besonders.
Dann beginnen wir mit unserer ,Sitzung‘. Das Aufnahmegerät und die Kamera laufen, und wir stellen die ersten Fragen.
| 2. | Joops Geburt und Kindheit im Amsterdam der zwanziger Jahre. |
„Ich wurde am 5. Januar 1924 geboren, und es war kalt“, sagt Joop. „Ich hätte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen können“, erzählt er weiter. Seine Mutter - Wilhelmina (Mien) van der Kruyf - ist erst 18 Jahre alt. Sie arbeitet in der Kantine einer Zigarettenfabrik. Sein Vater Marinus (Rinus) Krop arbeitet dort bis zu seiner Entlassung als Tischler. Die beiden jungen Leute lernen sich kennen und lieben. Als Rinus aufgrund der Wirtschaftskrise entlassen wird, bemerkt Mien, dass sie schwanger ist. Das ist ein Schock und in der damaligen Zeit eine Schande. Für die Vorhaltungen der zahlreichen Verwandtschaft hat Mien nur eine lakonische Bemerkung: „Wenn du so zusammen bist, bleibt es nicht beim Händchenhalten, und Rinus schien es zu mögen“. Ganz so leicht nehmen die beiden jungen Leute die Schwangerschaft aber nicht. Es ist Wirtschaftskrise. Mien arbeitet inzwischen als Putzfrau, um etwas Geld zu verdienen. Rinus ist arbeitslos. Mien ist verzweifelt und will das Kind abtreiben. Zunächst versucht sie es allein. „Aber schon damals war ich beharrlich und blieb drin“, sagt Joop. Dann gehen die beiden zu einem Mann, der Abtreibungen vornimmt. Doch weder der Mann noch sein schmutziges Haus flößen ihnen Vertrauen ein. Als sie wieder auf der Straße sind, sagen sie: „Nein, das nicht. Wir müssen heiraten“. So geschieht es, und das junge Paar bezieht eine Mansardenwohnung in der Simon Willem Straat 1. Die Verwandten helfen mit Möbeln. 1924 ist ein strenger Winter. Die einzige Heizmöglichkeit ist ein tragbarer Kerosinofen. Oft ist der Inhalt des Toiletteneimers morgens gefroren. Anfang Januar steht Mien auf einer Leiter, um die Fenster bei Juffrow Oud, der Besitzerin des Milchgeschäftes, zu putzen. Sie will „eben noch fertig machen“, als die Wehen einsetzen. Juffrow Oud schickt sie ins Krankenhaus. Eigentlich kommen Kinder damals meistens zu Hause mit Hilfe einer Hebamme zur Welt. Aber Mien und Rinus müssen ins Krankenhaus, weil sie kein Geld für die Hebamme haben. Doch als sie zu Fuß im Wilhelmina Ziekenhuis ankommen, schickt sie der Doktor wieder nach Hause. Joop will noch nicht das Licht der Welt erblicken. Nach zwei Tagen geht das junge Paar wieder ins Krankenhaus, weil die Wehen schlimmer werden. Der Arzt sagt: „Wir geben Ihnen eine Spritze, und wenn sie wach werden, ist das Kind da.“ So geschieht es. Joop wird mit einer Zange auf die Welt geholt. „Als Andenken habe ich einen platten Kopf“, meint er mit einem Lächeln. Jetzt lebt die junge Familie zu dritt in der Mansarde. Vater Rinus bemüht sich erfolglos um Arbeit. Rinus wird die Arbeitslosenunterstützung verweigert. Impulsiv wirft er einen Stein durch das Fenster des Arbeitsamtes. Er wird verhaftet und zu 9 Tagen Gefängnis verurteilt. Aber er bekommt seine Unterstützung und die Geschichte wird später in der Familie als kleine Heldentat erzählt, wie Joop sich erinnert.
Die Wirtschaftskrise in Europa wirft ihre Schatten voraus. In Holland gehen die Textilarbeiter in einen langen Streik. Sie wollen eine Lohnsenkung von 10 Prozent nicht kampflos hinnehmen. Es ist die zweite Kürzung in zwei Jahren. Sie sollen entweder die Kürzung akzeptieren oder anstatt 48 jetzt 53 Wochenstunden arbeiten.
Ein Textilarbeiter verdient zu der Zeit 20 Gulden pro Woche. Baron Van Heek, ein echter Baron, erklärt sein Jahreseinkommen auf 1.248.177 Gulden, so viel verdienen 1200 Arbeiter.
Die Textilarbeiter verlieren den Kampf.
Ein ähnliches Schicksal haben die Metallarbeiter. Die hohe Arbeitslosigkeit und die damit verbundene Hoffnungslosigkeit schaffen eine gedrückte Stimmung.
| 3. | Joop ordnet seine Geburt in das Jahr 1924 ein |
Lenin stirbt und wird nicht von Trotzki beerbt, wie er es gewünscht hat, sondern von Stalin, dem Mann aus Stahl.
Hitler wird zu 5 Jahren Festungshaft wegen eines geplanten Umsturzes verurteilt. In seinen Verteidigungsreden betreibt er seine Nazi-Propaganda. Bevor das Jahr 1924 zu Ende geht, ist er wieder frei.
In Italien bekommt Mussolini 65 Prozent der Stimmen. Sein sozialistischer Gegenspieler Matteotti wird von den Faschisten ermordet.
Nach einer schweren Operation, die sein Leben bedrohte, ist Ghandi wieder frei.
Carson City in den USA erwirbt den zweifelhaften Ruf, „die humanste und schnellste Art“ der Hinrichtung eines Gefangenen zu praktizieren.
Die Olympischen Sommerspiele finden in Paris statt und der Läufer Paavo Nurmi, der fliegende Finne, gewinnt 5 Goldmedaillen. Der Schwimmer Johnny Weißmüller (später der erste Tarzan-Darsteller) ist der Liebling des Publikums und vor allem der Frauen.
Genauso geht es Rudolf Valentino und Douglas Fairbanks. Die Welt lacht über die Komiker Buster Keaton, Charlie Chaplin und Felix the Cat.
1924 werden Männer wie Jimmy Carter, George Bush sen., Marlon Brando, Sidney Poitier, Marcello Mastroianni geboren. Der Sänger Johnny Jordaan begeistert und lässt die Herzen der Amsterdamer und besonders des Wohnviertels „Jordaan“ schmelzen.
| 4. | Leben im Jordaan |
Ein großer Teil der Familie von Joop lebt im „Jordaan“, einem Wohnviertel in Amsterdam. Er selbst lebt mit den Eltern am Rande des Jordaan. Aber er identifiziert sich in Kindheit und Jugend mit dieser eigenen Welt und spricht auch „Jordaans“. „Der Name Jordaan ist wahrscheinlich vom biblischen Fluss Jordan abgeleitet: So wie dieser die Grenze Israels markierte, bildete die Prinsengracht die Grenze zwischen dem Viertel der Reichen und der Armen. Der Jordaan wurde nicht völlig neu angelegt, vielmehr entsprach die Lage der Straßen und Grachten dem Verlauf schon bestehender Entwässerungskanäle. Die Straßen verlaufen dadurch eigenartig schräg zur Prinsengracht“. (Christoph Driessen S. 47) „Als wollten sie dadurch verdeutlichen, dass hier auch immer ein ganz besonderer Menschenschlag gelebt hat, meint der Schriftsteller Cees Nooteboom.“ (ebd.) Diese Schilderungen beziehen sich auf das 17. Jahrhundert. „In dem relativ kleinen Bezirk wohnte bald jeder vierte Amsterdamer. Auch luftverpestende Industriebetriebe wurden dort angesiedelt, zum Beispiel Brauereien, Färbereien, und Seifensiedereien, Zucker-, Salpeter- und Schwefelraffinerien.“ (ebd.) Auch ein Vergnügungspark fand dort seinen Platz. „Er ist bereits auf den ältesten Plänen des Jordaan von 1625 eingezeichnet.“ (ebd.)
Durch die Jahrhunderte hat der Jordaan seine besondere Rolle im Konzert der Amsterdamer Wohnviertel gespielt. Heute wohnen dort Künstler, Intellektuelle und andere Menschen, die das Flair im Herzen Amsterdams lieben. Zu der Zeit von Joops Geburt war es noch das Viertel der armen Leute, Paradiesvögel gab es aber auch damals schon. (s. u. „Tante Ka und Ome Huub“)
10 Blocks in der Länge und Breite bietet der Jordaan seinen Bewohnern einen Ort, ihren Zusammenhalt zu pflegen. Sie haben alle nicht viel an materiellen Möglichkeiten, aber ihre Solidarität ist groß. Man kennt sich im Jordaan. Man redet mit- und übereinander. Klatsch ist akzeptiert. „Besser eine schlechte als gar keine Geschichte“. Man spricht sogar einen eigenen Dialekt: Jordaans. Im Rest des Landes wird diese Sprache belächelt, aber wer im Viertel nicht Jordaans spricht, macht sich zum Außenseiter. Joops Mutter Mien und eine ihrer Schwestern weigern sich, Jordaans zu sprechen. Sie bezahlen den Preis, lächerlich gemacht und als Snobs bezeichnet zu werden. Manchmal schämte sich Mien für die Mitglieder ihrer Familie, die betrunken auf der Straße laut lachten und in ihrem Jordaans-Dialekt derbe Scherze machten.