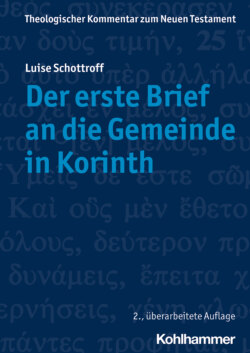Читать книгу Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth - Luise Schottroff - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Sozialgeschichte
ОглавлениеIn der Einleitung schreibt Luise Schottroff 2013, dass sie den ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth aus sozialgeschichtlich-theologischer Perspektive darstellen wird. Sie geht davon aus, dass das Schreiben an konkrete Menschen gerichtet ist, die Paulus so beschreibt: „nicht viele Weise, Mächtige und durch Geburt Privilegierte“, stattdessen „Ungebildete …, Schwache, von Geburt Benachteiligte, Verachtete, ‚Nichtse‘“ (1 Kor 1,26-28). Diese Perspektive bestimmt das weitere Vorgehen: So legt sie ihrer Auslegung eine detaillierte Untersuchung der Lebenssituation der korinthischen Gemeinde im Kontext der römisch-hellenistischen Gesellschaft des 1. Jahrhunderts zugrunde, die aus Menschen unterschiedlicher Völker und Sprachen zusammengesetzt war, aus Versklavten und Freien, Frauen und Männern. Diese gehörten nach ihrer Analyse mehrheitlich zu den Unterschichten. Die im Brief angesprochenen Probleme versteht sie nicht als Konflikte mit „Gegnern“, sondern als Auseinandersetzungen um Fragen der Lebenspraxis, deren Hintergründe sie in Form von „Basisinformationen“ entfaltet, zu Themen wie Sklaverei, Scheidung, Opfer/Fleischkonsum, Sexualität/Prostitution, Körpertheologie, Eschatologie. Dabei bezieht sie die offene und subtile Gestalt der Gewalt im römischen Reich durchgehend in ihre Auslegung ein: Kreuzigungen als Mittel politischer Abschreckung, „Spiele“ als Massenveranstaltungen, in denen Menschen gefoltert und getötet wurden, Sklaverei als Struktur der Bemächtigung über Menschen und ihre Körper. Dem setze Paulus das Bild der Gemeinde als „Körper des Messias“ entgegen, die Vorstellung eines kollektiven Körpers, mit dem Gott befreiend in der Welt handelt (1 Kor 12,12-27) und der nicht rein metaphorisch zu denken sei. Die Gemeinde verkörpert den Auferstandenen. Die vielfältigen sozialgeschichtlichen Informationen des Kommentars, die sich auf aktuelle historische, religionsgeschichtliche und archäologische Forschungen stützen, richten zum einen den Blick auf die harten Lebensbedingungen einer Gemeinde in den Strukturen der römisch-hellenistischen Welt, auf die bedrängte Lage von Frauen, Kindern, der Armen und Versklavten und eröffnen zugleich ein Verständnis für die Attraktivität der Botschaft des Evangeliums. Die Menschen erfahren sich in ihrer Gemeinschaft als messianischer Körper, der ihnen die Würde als Gottes Geschöpfe zuspricht und eschatologische Visionen von der gerechten Welt Gottes entwickeln lässt.
Die theologischen Grundlagen für diese sozialgeschichtliche Arbeit hat Luise Schottroff bereits 1979 in einem programmatischen Aufsatz dargelegt: „Die Schreckensherrschaft der Sünde und die Befreiung durch Christus nach dem Römerbrief des Paulus“.1 Darin zeigt sie, dass den Aussagen des Paulus zur Sünde, zur Bedeutung der Tora und dem befreienden Handeln Christi eine politische Analyse des Imperium Romanum zugrunde liegt. Die Kraft der Texte entfalte sich dann in besonderer Weise, wenn sie in diesem Kontext gelesen werden und nach der Bedeutung für den Alltag der Menschen in den Städten des Imperiums gefragt wird. Ihre Analyse zeigt, dass der für Paulus leitende Gedanke sei, dass die Sünde über alle Menschen wie über Sklav:innen herrsche und Christus die Befreiung aus dieser Herrschaft bringe. Der Herrschaftsraum der hamartia ist der kosmos, ihr Herrschaftsinstrument der Tod. Für die Ausübung ihrer Herrschaft bediene sie sich des nomos. Nach Schottroff ist damit nicht die Tora gemeint, sondern der Zwang, der es unmöglich mache, den Willen Gottes zu tun. Paulus denke die Weltherrschaft der Sünde in den Dimensionen des Imperium Romanum, die erst von den Glaubenden durchschaut werde. Sie erkennen, dass sich die Weltherrscherin sogar der Tora bedient. Luise Schottroff fragt weiter danach, was die Befreiung aus der Macht der Sünde konkret für die Menschen bedeutet habe. Paulus gehe es nicht in erster Linie um eine Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen, er denke apokalyptisch: Seine Hoffnung richte sich auf Gottes endgültiges Eingreifen, das mit der Auferstehung Jesu bereits begonnen habe. Diese Hoffnung auf einen endgültigen Herrschaftswechsel habe tiefgreifende politische Konsequenzen gehabt. Die Menschen fühlen sich nicht zuerst dem römischen Kaiser als dem Kyrios und seinen Institutionen gegenüber loyal, sondern dem Gott Israels und dem von ihm gesandten Messias.
Mit diesem Deutungsrahmen, in dem sie auch die anderen Briefe des Paulus liest, bereitete Luise Schottroff den Weg für weiterführende Studien sozialgeschichtlicher Exegese im deutschen Kontext und international im Kontext der Studien zur imperiumskritischen Paulusforschung, die aktuell unter dem Stichwort „Paul and Empire“ geführt werden. Von ihr selbst liegen eine Vielzahl von Veröffentlichungen im Bereich sozialgeschichtlicher Bibelauslegung vor.2 2009 hat sie zusammen mit alt- und neutestamentlichen Fachkolleg:innen das „Sozialgeschichtliche Wörterbuch zur Bibel“ herausgegeben.