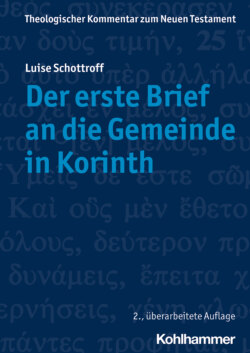Читать книгу Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth - Luise Schottroff - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Basisinformation: Zeitvorstellungen und Eschatologie
ОглавлениеDie Zeitvorstellungen der Alten Welt und der Bibel müssen aus ihrem Kontext heraus verstanden werden. Sie können nicht unreflektiert mit heutigen Zeitvorstellungen identifiziert werden. Ein wichtiger Unterschied ergibt sich schon daraus, dass heute normalerweise Zeit als objektiv messbar verstanden wird und als linear – von einem nicht mehr erkennbaren Anfang in eine Zukunft, die unendlich ist, eine Zeit, die immer so weitergeht. In der Antike gab es noch keine entsprechenden Uhren, die tags und nachts gleichmäßig weiterlaufen. Sie sind Voraussetzung heutiger Zeitvorstellungen.
In den paulinischen Briefen werden die biblischen Zeitvorstellungen vorausgesetzt: Die Zeit ist gestaltet und gegliedert durch Gottes Handeln. Schöpfung und Exodus sind göttliches Handeln, das in die Vergangenheit gehört, von der die Menschen der Gegenwart lernen können. Auch die Zukunft ist von der Gottesbeziehung bestimmt: Sie ist das „Kommende“ (ta mellonta 3,22), sie bringt das „Ende“ / telos (1,8; 10,11; 15,24). Mit dem Ende wird jedoch nicht ein Ende der Zeit erwartet, sondern das Ende der Leiden der Menschheit. In 15,24 wird das Ende beschrieben: Gott entmachtet jede Herrschaft, Gewalt und Macht. Daran ist auch in 10,11 gedacht. Die gegenwärtige Gemeinde ist die Gemeinschaft derer, „auf die das Ende der Aionen gekommen ist“, also das Ende des „Aions dieser Welt“. Diese Wendung bezeichnet nicht eine Zeitspanne, sondern einen Machtraum, in dem Herrschende im Interesse einer lebensfeindlichen Macht agieren (2,7.8; 1,20; 3,18). Dieses „Ende“ wird ersehnt, es bedeutet das Ende der Gewalt und der Leiden und die Zeit, in der „Gott alles in allem“ ist (15,28). Das deutsche Wort Ewigkeit versucht diese Vorstellung umfassenden Friedens bei Gott wiederzugeben. Diese Entmachtung der lebensfeindlichen Gewalten hat mit der Auferstehung des Messias begonnen, darum sind sie schon im Untergang begriffen (2,7), und die Gemeinde erfährt schon ihr „Ende“ (10,11; vgl. 3,22). So kann Paulus auch sagen: „die Jetztzeit / kairos ist bedrängend, sie gerät aus den Fugen“ (7,29). Doch Gottes Zukunft ist nahe und sie verändert jetzt schon die Praxis des Lebens für die Glaubenden (vgl. Röm 13,11). Die Gegenwart ist die Zeit der Beziehung zu Gott und zu göttlichem Handeln in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Zu dem zukünftigen Handeln Gottes gehört das gerechte Gericht über die ganze Menschheit und die Vollendung (15,24). Darum sind die Glaubenden Wartende (1,7). Sie warten auf die endgültige Offenbarung, das Kommen des Messias (1,7). Die Auferstehung Christi ist Beginn des Heils; der Messias ist gegenwärtig und er ist der Kommende. „Solange aus diesen Aussagen nicht ideologische und dogmatische, von Erfahrungen abgeschottete Konzepte werden, bleibt es aber naturgemäß bei einem Ineinander von Erwartung und Gegenwart.“33 In der Gegenwart warten die Glaubenden auf die Vollendung (15,24), aber sie erwarten auch das gerechte Richten Gottes (s. dazu 3,13–17; 4,5 u. ö.). Der „Tag“ des Richtens (1,8; 3,13; 5,5) nimmt die alttestamentliche Vorstellung des Tages Adonajs auf. Er wird bei Paulus auch Tag des Befreiers Jesus Christus genannt (1,8; s. auch 5,5 in Teilen der handschriftlichen Überlieferung). Ob Paulus an den Messias als endzeitlichen Richter denkt, bleibt dabei offen.34
Es sind vor allem zwei Deutungsmuster, die die Wahrnehmung dieser Zeitvorstellungen seit ca. 1970 geprägt haben: 1. das Konzept Naheschatologie / „Parusieverzögerung“; 2. das Konzept einer nicht-dualistischen Eschatologie.
Die erstere Vorstellung ist seit Ende des 19. Jahrhunderts bis ins ausgehende 20. Jahrhundert vorherrschend gewesen. Sie deutete die Eschatologie Jesu und des Paulus als Naherwartung, die das Reich Gottes in Jahren, aber nicht Jahrzehnten erwartet. Die „Nähe“ des Reiches Gottes wird dabei also in linearer Zeit gedacht. Da das Reich Gottes nicht kam, habe die enttäuschte Naherwartung dazu geführt, dass die Glaubenden sich in der Welt dauerhaft einrichteten.35 Durch die Vorstellung eines Gottesreiches am Ende von Zeit und Geschichte entsteht ein Dualismus von Geschichte und Ewigkeit, Diesseits und Jenseits.
Ein zweites demgegenüber grundsätzlich verändertes Deutungsmuster entstand vor allem in Befreiungstheologien. Hier wird die Relevanz der Zukunftshoffnungen für die Gegenwart betont und die Zeit als Zeit in Beziehung zu Gott gedeutet. Der Satz „das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen“ redet hier von der Nähe Gottes in der Gegenwart, aus der Hoffnung für die Zukunft entsteht.36 Dieses Konzept bezieht die Lebenssituation der Menschen, die in den biblischen Texten zu Wort kommen, in die Deutung ein. Für den 1 Kor bedeutet das, dass die Lebenssituation des Paulus und seiner Adressatinnen und Adressaten im Kontext des römischen Reiches zu berücksichtigen ist. Hier warten Menschen auf die Offenbarung des Messias (1,7), die ein Ende der Gewalt in ihrem Alltag herbeisehnen.
Zusammenfassend lässt sich für die Eschatologie des Paulus sagen: Sie ist Deutung der Gegenwart aus der Beziehung zu Gott.
1,7.8 1,7.8 Geistgewirkte Begabungen und das öffentliche Zeugnis vom Messias erhalten ihre Stärke auch durch die Erwartung, dass der Messias kommen wird, um der Gewalt der gottfeindlichen Mächte ein Ende zu setzen (1,8 vgl. 15,24). Die Gemeinde wird auf dem schwierigen Weg in der Realität der Gesellschaft durch Christus (oder Gott?) gestärkt, sodass die Glaubenden fähig werden, nach der Tora zu leben (s. zu 7,19). Von diesen Schwierigkeiten ist in 1 Kor vielfach die Rede, z. B. von den Schwierigkeiten, nur dem Einen Gott zu gehören in einer Stadt, die vielfach religiöse Ansprüche an die Menschen stellt (Kapitel 8–10). Die stärkende Gemeinschaft mit dem Messias wird sie behüten und im Gericht Gottes vor der Anklage bewahren. Am Tag des Gerichtes wird der Messias seine Arbeit für die Festigung der Gemeinde am Ziel sehen. Sie werden nicht angeklagt, so wird der Tag des Gerichtes zum Tag der Befreiung.37
1,9 1,9 Während Paulus bisher über sein Dankgebet (1,4) und damit über die Gemeinde und zu der Gemeinde geredet hat, spricht er hier eine andere Sprache, die des Trostes: Er vergewissert die Gemeinde der Treue Gottes, die sie in der Gemeinschaft mit dem Messias bereits erfahren haben. Von der Osten-Sacken betont zu Recht, die Liebe / agape untereinander als Erfüllung der Tora sei die „vorrangige Manifestation […] der Treue Gottes“38 und sei auf die konkreten Gemeindeverhältnisse bezogen. Das zeigt auch der Fortgang des Briefes.