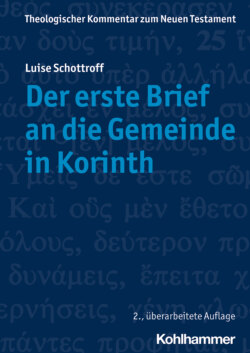Читать книгу Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth - Luise Schottroff - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1,26–31
Оглавление26 Seht doch auf euch, Geschwister: Ihr seid gerufen. Es sind nämlich unter euch nicht viele Gebildete von ihrer Herkunft her, nicht viele Mächtige, nicht viele aus den Elitefamilien. 27 Vielmehr hat Gott die Ungebildeten der Welt erwählt, um die Gebildeten zu beschämen; und die Schwachen der Welt hat Gott erwählt, um die Starken zu beschämen. 28 Und die Geringen und die Verachteten der Welt hat Gott erwählt, die, die nichts gelten, um denen, die etwas sind, die Macht zu nehmen. 29 Das geschieht, damit kein Mensch vor Gott überheblich ist. 30 Durch Gott seid ihr mit dem Messias Jesus verbunden, der uns von Gott her zur Weisheit befähigt und zur Gerechtigkeit und Heiligung und Befreiung. 31 So geschieht, was geschrieben steht: Wer groß sein will, preise die Größe der Ewigen.
Die Biografie der geschwisterlichen Gemeindeglieder in Korinth ist selbst ein Zeugnis der Auferweckung des Gekreuzigten. „Seht doch“ beginnt der Text: An euch selbst ist das Eingreifen Gottes in die Gewaltstrukturen sichtbar. Gott hat diejenigen gerufen, die in der Stadt Korinth unten sind: Ungebildete, politisch Machtlose und Menschen, die schon durch ihre Herkunft auf die Verliererseite der Gesellschaft gehören; „Nichtse“ aus der Perspektive von oben – so fasst 1,28 zusammen. Die Verwandlung, die Gottes Eingreifen gebracht hat, bedeutet für diese „Nichtse“, dass sie Leib Christi geworden sind (1,30a) und Christi Weisheit in ihnen Gestalt gewonnen hat. Er hat ihnen Bildung, Gerechtigkeit, Heiligung und Befreiung gebracht (30b; s. schon 1,5). Die Gebildeten und Mächtigen verlieren in diesem Geschehen ihre Macht (1,27–29). Sie können sich nicht mehr wegen ihrer Besitztümer brüsten (1,29). Was bedeutet das konkret?
Paulus greift in diesem Text auf die biblische Tradition zurück: Die Erwählung der Armen durch Gott und die Erwählung des kleinen Israel (s. nur 1 Sam 2,7–10; Dtn 7,6–8). Er legt die Schrift für die Gegenwart aus; er bezieht sie auf die Erfahrungen der Menschen in der korinthischen Gemeinde. Explizit bezieht er sich auf Jer 9,22.23 (in 1,29.31), implizit auf den breiten Traditionsstrom des Evangeliums der Armen in der Schrift (in 1,26–28).
1,26 1,26 Gott hat Menschen in Korinth gerufen (klesis), er hat sie erwählt (1,27.28). Sie sollen auf Gottes Handeln schauen, auf Gottes Rufen und Erwählen. Wie im biblischen Sprachgebrauch beziehen sich „rufen“ und „erwählen“ auf denselben Akt Gottes (s. z. B. Jes 41,9). Das Rufen Gottes setzt einen Prozess der Verwandlung in Gang und gibt den Gerufenen einen Auftrag. Sie sind gerufen wie auch Paulus selbst gerufen ist (s. 1,1). In der Auslegungsgeschichte von 1,26 ist oft versucht worden, das Wort klesis statisch zu deuten, so dass es den sozialen Status der Gemeindeglieder festschreibt. Wer arm und ungebildet ist, bleibt auch arm und ungebildet.100 Diese Deutung wird durch die Deutung desselben Wortes in 7,20 verursacht. In 7,20 gehe es um die Festschreibung des sozialen Status, an dem die Zugehörigkeit zum Leib Christi nichts ändert („Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat“, Einheitsübersetzung 1982). Diese Übersetzung von 7,20 wie die entsprechende Deutung von 1,26 dient dem politischen Inter esse an einer sozialen Status-quo-Theologie und trifft den biblischen und paulinischen Gedanken nicht (s. zu 7,17–24).
Paulus verwendet drei Begriffe für eine Skizze der sozialen Zusammensetzung der Gemeinde in 1,26: nicht viele Weise, Mächtige und durch Geburt Privilegierte. Diese und ähnliche Begriffe (s. 1,27–28) und ihre Gegenbegriffe werden biblisch und außerbiblisch in unterschiedlichen Reihungen zur Beschreibung gesellschaftlicher Unterschiede benutzt.101 Als Gegenbegriffe benutzt Paulus: Ungebildete (mora), Schwache, von Geburt Benachteiligte, Verachtete, „Nichtse“ (1,27–28).
Die Begriffe sind ungenau und auch untereinander austauschbar. Hier in 1 Kor 1,26–31 wird der ökonomische Aspekt (arm – reich) nicht explizit erwähnt, er ist jedoch implizit präsent. Es ist möglich, dass mit diesen Reihungen von Gegensatzbegriffen der Gegensatz zwischen der kleinen Oberschicht, z. B. der städtischen Führungsschicht und der Mehrheit der Bevölkerung bezeichnet werden soll. Die Mehrheit lebt in Armut, hat kaum Zugang zu Bildung und ärztlicher Versorgung und wird von der Führungselite auch noch verachtet.102 Diese ungenauen Begriffe des Paulus sind also durchaus sozialgeschichtlich verifizierbar. Eine Mittelschicht gibt es nicht. Ob tatsächlich einige wenige aus der korinthischen Führungselite der Messiasgemeinde angehören, ist schwer zu beurteilen.103
Die Lebensbedingungen der Bevölkerungsmehrheit in den Städten des römischen Reiches sind ungesund und hart. Die Wohnungen der Armen in Mietshäusern haben keine Küche und keine Abwasserversorgung, manche sind fensterlos. Der stinkende Schmutz auf den Straßen und die Gewalttätigkeit im Alltagsleben machten das Leben gefährlich. Kinder wuchsen unter solchen Bedingungen zwischen den Erwachsenen auf. Nur die Hälfte der Neugeborenen erreichte das 10. Lebensjahr.104 Im 1. Korintherbrief werden diese Lebensbedingungen vorausgesetzt und sind direkt oder indirekt erkennbar.105
Für die Deutung dieses Textes ist es jedoch weniger entscheidend, wieviele Menschen mit Wohlstand und Bildung – oder relativem Wohlstand – der Gemeinde angehören, sondern welche Rolle ihnen in der Gemeinde zugeschrieben wird. In der westlichen Exegese des 20. Jahrhunderts hat sich im Zusammenspiel mit der Ideologie des Kalten Krieges gegen den sozialistischen Osten ein „neuer Konsens“ herausgebildet, der egalitäre Organisation des gewaltförmigen Kommunismus verdächtigt. Nach diesem „neuen Konsens“ wurde die Einschätzung vertreten, dass in der Gemeinde Arme und Reiche zusammenlebten.106 Dabei wird den Reichen und Gebildeten die Führung der Gemeinde zugewiesen. So entstand das Deutungsmuster des „Liebespatriarchalismus“. Es besagt, dass das Christentum überleben konnte, weil es ein harmonisches und hierarchisches Zusammenleben von Reichen und Armen, Männern und Frauen ermöglichte. Die in der gesellschaftlichen Hierarchie oben Angesiedelten wendeten sich in Liebe denen unten zu, die sich ihnen in Gehorsam unterordneten.107 Inzwischen ist die egalitäre Struktur frühchristlicher Gemeinden stärker in den Blick geraten.108
1,27.28 1,27.28 In den zwei folgenden Versen skizziert Paulus die Veränderung, die das Zusammenleben in der Gemeinde für die gesellschaftliche Differenz von oben und unten bedeutet. Die Erniedrigten werden von Gott erwählt und die Weisen, Starken und Angesehenen werden entmachtet. Was bedeuten die Verben, die Paulus für diese Entmachtung verwendet, kataischynein / beschämen und katargein / außer Geltung setzen? Beide Verben beziehen sich auf Gottes endzeitliches Gericht (s. zu 1,7 und Basisinformation Zeitvorstellungen und Eschatologie), das noch nicht geschehen ist, aber schon die gegenwärtige Situation verändert. Es entzaubert und entmachtet die Leute, die in der Gesellschaft Privilegien haben – auch die wenigen, die vielleicht der Gemeinde angehören. Damit öffnet sich auch für sie ein Weg der Befreiung von ungerechten Strukturen. Paulus steht hier in der Tradition des biblischen Evangeliums der Armen, wie es z. B. viele prophetische Texte und Psalmen vertreten. Sein Text enthält Bezugnahmen auf 1 Sam 2,1–10 (LXX). In 1 Sam 2,10 LXX ist der Text von Jer 9,22.23 mit dem Hannalied verknüpft, in dem die Entmachtung der Starken und die Erhöhung der Erniedrigten besungen wird. Es zeigt sich, dass Paulus auch dann die Schrift wiedergibt, wenn er nicht explizit darauf hinweist (das geschieht erst in 1,31) oder zitiert. 1 Kor 1,26–31 kann als Neuformulierung des Hannaliedes bezogen auf die Situation in Korinth bzw. im römischen Reich der Zeit des Paulus verstanden werden.