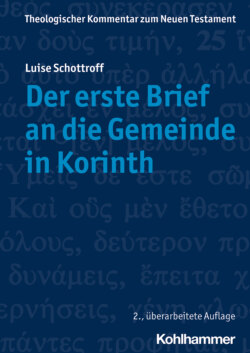Читать книгу Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth - Luise Schottroff - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Basisinformation: Verleugnung der Kreuzigung
ОглавлениеIn 1,18 muss Paulus sich mit Menschen innerhalb der Gemeinde in Korinth auseinandersetzen, die es eine moria / Torheit, Dummheit, Unklugheit finden, von der Kreuzigung Jesu und damit auch von den Kreuzigungen solidarisch zu reden. Der Druck war so groß, dass immer wieder Menschen ihre Zugehörigkeit zu Jesus verleugneten (aparneo oder arneo z. B. Mt 26,34.70). Ein anderes griechisches Wort dafür ist skandalizo / Anstoß nehmen. In der Gestalt des Petrus haben die synoptischen Evangelien dieser Erschütterung und Gefährdung der Solidarität mit Jesus und miteinander ein einfühlsames Denkmal gesetzt. Petrus hat Jesus verraten, obwohl er es nicht wollte. Die Angst war zu groß (Mk 14,66–72 mit Parallelen). Diese Erzählung ist lange nach Jesu Tod aufgeschrieben und weitererzählt worden, nicht weil Petrus als ein schwacher Charakter erinnert werden sollte, sondern weil es Mut machte, dass er der Angst unterlegen war und dann doch wieder aufstand und an der Seite des Auferstandenen zu finden war. In den Evangelien spielt die Gefährdung durch politischen Druck eine große Rolle, s. die Flucht aller Jüngerinnen und Jünger nach Jesu Verhaftung (Mk 14,50) oder auch Mk 4,17; Mk 8,34–38 (mit Parallelen). Diese Traditionen werden nicht mit dem Bewusstsein erzählt: Uns kann das nicht passieren. Die Beteiligten wussten, dass die Angst vor brutalen Hinrichtungen und Folter nicht fern von ihnen war. Wenn Paulus sich mit Menschen in der korinthischen Gemeinde auseinandersetzt, die es töricht oder unklug finden, den Auferstandenen als Gekreuzigten in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, dann hat er nicht „Gegner“ oder Häretiker vor sich, die eine andere Glaubenslehre verfolgen, sondern Menschen, die fragten, ob die Gemeinschaft mit dem Messias nicht auch ohne die politische Gefährdung möglich sei.
Aus den Zeugnissen über Verfolgungen christlicher Gemeinden geht hervor, dass Gläubige im Gerichtsverfahren oder schon vorher abtrünnig wurden und ihre Geschwister dann sogar verraten haben.61 Neben diese Zeugnisse über Ereignisse 64 bzw. ca. 110 n. Chr. treten Berichte über innergemeindliche Diskussionen aus dem 2. Jahrhundert. Hier findet sich auch das Argument, die Gefährdung durch den Gekreuzigten auf sich zu nehmen, sei „dumm“. So berichtet Tertullian, es habe „Gegner des Martyriums“ gegeben, die argumentierten, es sei „zwecklos“, das eigene Leben zu opfern, weil man sich als dem gekreuzigten Messias Jesus zugehörig öffentlich bekennt. „Ach die guten, einfältigen Seelen wissen nicht, was geschrieben steht und wie es gemeint ist, wo, wann und vor wem man das Bekenntnis abzulegen habe – aber leider ist es nicht Einfalt, sondern Dummheit, ja sogar Wahnsinn, für Gott zu sterben, denn dieser will mich ja erretten.“62 Die „Torheit“, in Korinth von der Kreuzigung zu erzählen, wird aus diesem Text verständlich, auch wenn er aus der Zeit um 200 n. Chr. stammt. „Die Haltung zum Martyrium steht immer in Einklang mit der Interpretation von Christi Leiden und Tod.“63
Wenn es so deutlich geworden ist, warum Menschen Christus untreu wurden, ist weiter zu fragen, warum andere es nicht wurden, warum sie dem Druck standhielten. Was haben sie durch ihre Zugehörigkeit zum Messias gewonnen? Die Messiasgemeinschaft hat gemeinsam die Kraft entwickelt, der gesellschaftlich vorgegebenen Lebensweise eine Alternative entgegenzusetzen. So wurden „die Weisheit der Welt“ und die Macht der Gewalten dieser Welt überwunden. Der Christ Justin schreibt über seine Gemeinschaft (vor 165 n. Chr.): „Obwohl wir uns so gut auf Krieg, Mord und alles Böse verstanden hatten, haben wir alle auf der weiten Erde unsere Kriegswaffen umgetauscht, die Schwerter in Pflugscharen […] und züchten Gottesfurcht, Gerechtigkeit, Menschenfreundlichkeit […]. Wenn wir nämlich auch mit dem Schwert hingerichtet, wenn wir gekreuzigt, […] werden, so fallen wir […] doch nicht von unserem Bekenntnisse ab.“64 Von dem greisen Polykarp (hingerichtet am 22.2.156 n. Chr.) wird legendenhaft erzählt, dass er nach seiner Verhaftung in eine Rennbahn gebracht wurde, in der die wilden Tiere schon darauf warteten, Menschen zu zerreißen. In dieser Situation wird er aufgefordert, seine Haut zu retten: „Schwöre beim Glück des Kaisers! Gehe in dich, sprich: Weg mit den Gottlosen.“65 Mit den Gottlosen sind die Feinde Roms gemeint, die wegen ihrer Ablehnung der römischen Loyalitätsreligion als atheistisch oder gottlos galten. „Polykarp aber schaute mit finsterer Miene über die ganze Masse der in der Rennbahn versammelten heidnischen Scharen hin, streckte die Hand gegen sie aus, seufzte, sah gen Himmel und sprach ‚Weg mit den Gottlosen‘! Der Prokonsul drang noch mehr in ihn und sprach: Schwöre und ich gebe dich frei, fluche Christo!“66 Der Prokonsul hat sich also von Polykarps List nicht täuschen lassen. Polykarp konnte ehrlichen Herzens die Menschen in der Rennbahn, die auf das Morden warteten, gottlos nennen. Der Prokonsul jedoch verlangte die Verfluchung Christi, die Distanzierung von Feinden Roms (Gottlose) und die Anerkennung der römischen Loyalitätsreligion. Polykarp ist gestorben; es ging ihm um seine eigene Befreiung von den Gewalten und um die Befreiung seiner Geschwister.67
Der logos vom Kreuz ist das Erzählen von der Kreuzigung und den Kreuzigungen, von der Gewalt im Alltag der Gesellschaft. Dieses Erzählen macht die Gewalt sichtbar und bezeugt, dass Gott dieser Gewalt ein Ende setzt. Die Auferweckung des Gekreuzigten hat ihn zur Lebensmacht werden lassen. Dadurch dass die Glaubenden des Gekreuzigten gedenken, vollziehen sie Gottes Auferweckungstat neu. Die dynamis 1,18b ist zugleich die Kraft Gottes, die den Messias nicht dem Tod überließ und die diejenigen verwandelt, die sich dem gekreuzigten und auferstandenen Messias anvertrauen. Damit definiert sich nicht eine Gruppe (die Glaubenden) als solche, die schon Gerettete im Sinne des kommenden Gottes und seines Richtens sind. Sie sind vielmehr befreit zum neuen Leben und zugleich Wartende; Auferstehende, die sich nach Gottes Heil für die ganze Erde sehnen (s. Basisinformation vor 1,7.8). Ihr verändertes Leben ist jetzt schon Erfahrung zukünftigen Heiles – darum die präsentische Formulierung (sozomenoi).68 Es kommt darauf an, die theologische Füllung der paulinischen Rede vom „Wir“ der Gemeinde zu bedenken (s. Basisinformation vor 2,6). Das „Wir“ sind die Menschen, die die real existierende Gemeinde ausmachen und in dieser Realität die Vollkommenheit der Zukunft Gottes erkennbar werden lassen.
Paulus selbst hat die Bedrohung und den Kampf um ihre Überwindung immer wieder am eigenen Leib erlebt (s. 15,30–34; 4,9–13).