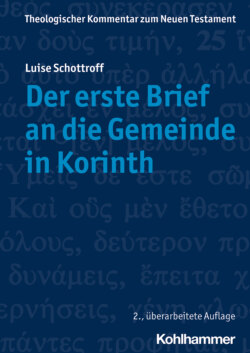Читать книгу Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth - Luise Schottroff - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1,19.20
ОглавлениеEr beginnt mit einem Schriftwort (Jes 29,14). Für ihn ist die Schrift nicht eine formale Autorität, die von oben Debatten beendet.69 Die Schrift spricht für ihn wie für andere jüdische Menschen unmittelbar in die eigene Gegenwart, ist Weisung für die Gegenwart (s. zu 10,1). Jes 29,14 sagt, was durch die Auferweckung des Gekreuzigten geschah: Gott hat der „Weisheit der Welt“, dieser umfassenden gesellschaftlichen und politischen Macht (s. zu 1,17), eine Grenze gesetzt. Dieses göttliche Handeln benennt Paulus mit starken Worten. Er nennt es zerstören / apollymi und ins Unrecht setzen / für ungültig erklären (atheteo; hier setzt er ein destruktiveres Wort als Jes 29,14 – krypso ein) und weiterhin: als Dummheit / Kurzsichtigkeit erweisen (moraino). Vergleichbar sind diese Worte dem katargeo, das die Entmachtung der Herrschaften und Gewalten benennt (2,6; 15,24.26). Er fragt in 1,20 wie nach einem radikalen politischen Umbruch (in Anlehnung an Sprache der Schrift70): Wo sind sie geblieben, die Vertreter der Weisheit der Welt? Es sind die Weisen, d. h. die Bildungselite, die schriftkundigen Verwaltungsleute (grammateus – in diesem korinthischen Kontext sind nicht speziell jüdische Schriftgelehrte gemeint, s. Apg 19,35). Sie haben das Sagen in entscheidenden Fragen der Organisation des städtischen Lebens und des Handels. Weiterhin nennt Paulus mit dem griechischen Wort syzetetes Leute, die öffentlich argumentieren und u. U. auch Entscheidungsmacht haben (s. eine solche Szene Apg 17.19.20).71 Öffentliche Rede wurde seit Augustus überwacht.72 Tacitus berichtet über eine Diskussion wohl aus dem Jahre 75 n. Chr., in der der Niedergang der Rhetorik beklagt wird: Die Rede habe die nötige libertas / Freiheit verloren und die rhetorische Ausbildung bringe nur wirklichkeitsferne Sachverhalte zur Diskussion.73 Aufgeschrieben hat Tacitus diese Klagen erst zu einer späteren Zeit, als er weniger Repression befürchten musste.
1,21 1,21 In der ersten Hälfte dieses Verses bereitet die Deutung der präpositionalen Wendung en te sophia tou theou Schwierigkeiten. Ist gemeint, dass Gott aufgrund seiner Weisheit die Erkenntnis verhindert hat? 1,20 sagt: emoranen, Gott hat die Kurzsichtigkeit bewirkt. Das en in 1,21a wäre also kausal zu deuten. Eine andere Deutung versteht das en lokal. Die Welt ist umgeben von Gottes Weisheit, seiner Schöpfung und seiner Tora, und erkennt dennoch Gott nicht. Diese Deutung nimmt die Gedanken von Röm 1,18–31 auf.74 Eine eindeutige Klärung ist nicht möglich. In 1,21b gibt moria / Unklugheit Fragen auf: Erscheint die Botschaft vom Kreuz denen, die die Kreuzesnachfolge überflüssig finden (s. 1,18), als dumm? Dann wäre sie nur vermeintlich unklug. Oder: Ist die Botschaft vom Kreuz unklug / kurzsichtig / dumm / töricht? Ein Blick auf 1,26–31 hilft bei der Entscheidung. Durch die Auferweckung des Gekreuzigten ergreift Gott Partei für die Erniedrigten. Sie werden für dumm gehalten – von denen, die sie von der Bildung möglichst ausschließen. Viele können tatsächlich nicht lesen und schreiben. Gott hat viele Ungebildete in Korinth berufen. Paulus will deutlich machen, dass diese Berufungen inhaltlich mit der Auferweckung eines Gekreuzigten zusammengehören. Deshalb spricht er von der moria / Unklugheit der Verkündigung. Die Wortwahl ist durch das ablehnende Urteil über die Kreuzigung verursacht (s. 1,18). Hier nun nimmt Paulus es positiv auf: Ja, Gott ist so unklug, er erwählt die Erniedrigten, den Gekreuzigten und die Ungebildeten. Paulus spielt also hier (und 1,25) rhetorisch mit dem Wort moria / Unklugheit.
1,22–24 1,22–24 Paulus benutzt hier Begriffspaare: Joudaioi und Hellenes bzw. Joudaioi und ethne. Wer ist mit diesen Bezeichnungen gemeint und wie sind sie zu übersetzen?
Joudaios ist in dieser Zeit und weit darüber hinaus75 ein ethnisch-regionaler Begriff, der mit „Judäer / Judäerin“ übersetzt werden müsste.76 Dieser ethnisch-regionale Begriff schließt den Kult mit ein. Wie andere ethne / Völker teilt das jüdische Volk z. B. Land, Blutsbande, Geschichte, Recht, Kultus, Sitte. Als Beispiel aus den Quellen kann Josephus, contra Apionem I 6 dienen:77 Das jüdische Volk ist anderen Völkern vergleichbar. Der regionale Sinn des Wortes bleibt auch erhalten, wenn jüdische Menschen weit außerhalb des Mutterlandes leben. Entsprechendes gilt auch für andere Völker. Dieser Befund deckt sich mit dem paulinischen Sprachgebrauch, auch in 1 Kor. Joudaioi sind ein ethnos, auch wenn dieser Sprachgebrauch nicht explizit vorkommt (aber z. B. Joh 11,48), denn er assoziiert mit dem Jüdischsein: Beschneidung (7,18), Tora / nomos (7,19) und Opfer / Altar (10,18) in Jerusalem. Der Begriff Israel kata sarka (10,18) / das real existierende Israel mit dem Tempel in Jerusalem entspricht dem Begriff jüdisches ethnos. Die Anhängerschaft des Messias Israels, die nicht jüdischer Herkunft ist, ordnet sich dem Gott Israels zu (s. u. Basisinformation zu „Messiasgläubige“ zu 1,24), sie werden aber nicht zu Juden und Jüdinnen, wie 1,24 zeigt. Zu dieser Zeit gibt es keinen Begriff, der ein Volk über eine „Religion“ definiert. Ein Begriff von Religion, der den materiell-körperlichen Bereich nicht einschließt, ist modern.78 Für Paulus und seine Zeit gehört zum Jüdischsein eine Lebenspraxis, eine Geschichte, das Land Judaea und der Gott Israels. Die Frage, wer ist Joudaios und wer nicht, spielt keine institutionelle Rolle – weder aus der Innensicht noch von außen.79 Erst der spätere Fiscus Judaicus, eine römische Steuer, die jüdische Menschen ausbeuten und demütigen soll, bringt römische Untersuchungen hervor, wer denn nun eigentlich jüdisch sei.80 Wie kann das Wort Joudaios also übersetzt werden? Historisch korrekt wäre „Judäer / Judäerin“, da deutsche Wörter wie „Jude / Jüdin“ und die Vorstellung von „Judentum“ primär eine Religion assoziieren. Der Begriff „Judentum“ und „Religion“ im modernen Sinne existiert zu dieser Zeit nicht.81 Doch die Kontinuität der jüdischen Geschichte über Jahrhunderte würde heute unsichtbar, wenn die historisch korrekte Übersetzung benutzt würde. Deshalb wird hier weiterhin mit „Jude / Jüdin“ übersetzt. Im deutschen Kontext mit der Geschichte der Shoah, der Verfolgung und Ermordung von Millionen jüdischer Menschen durch Deutsche, muss die Kontinuität der Geschichte des jüdischen Volkes damals und heute sichtbar bleiben.82
Hellenes bezeichnet das griechische ethnos / Volk ganz analog zur Vorstellung vom jüdischen Volk. Hier in 1,22–24 sind speziell korinthische Messiasgläubige aus den Völkern im Blick, wenn sie die Kreuzesnachfolge ablehnen, wie 1,23 zeigt. Es geht in 1,22 nicht um eine generalisierende Charakterisierung des griechischen und jüdischen Volkes als solche, die Weisheit suchen und Zeichen „fordern“, wie oft übersetzt wird (s. dazu u.), sondern um konkrete Menschen und ihre Einwände gegen die Solidarisierung mit einem Gekreuzigten. In diesen Versen ist zu unterscheiden, was Paulus über konkrete Menschen – bzw. zu ihnen – zu sagen hat und was der Text an darüberhinausgehenden Voraussetzungen zu erkennen gibt. Zunächst zu den Voraussetzungen:
1. Paulus benutzt die Begriffe Hellenes und ethne hier und 1 Kor 10,32; 12,13 als austauschbar. Ihre Bedeutungen in damaligem gesellschaftlichem Lebenszusammenhang überschneiden sich, doch die Begriffe sind nicht deckungsgleich. Hellenes werden griechisch sprechende Menschen genannt, auch wenn wie hier anzunehmen ist, dass sie zwar Griechisch als Verkehrssprache sprechen, aber ethnisch nicht aus dem griechischen Volk stammen.83 Ethne sind aus der Perspektive Roms die Völker, die sich das Imperium Romanum unterworfen hat oder unterwerfen sollte.84 Aus jüdischer Perspektive sind ethne die nichtjüdischen Völker, die den falschen Göttern dienen und nicht nach der Tora leben. Dieser jüdische Sprachgebrauch findet sich in 1 Kor (5,1; 10,20; 12,2).
Davina Lopez macht mit guten Argumenten deutlich, dass für das Verständnis des Evangeliums für die ethne / Völker bei Paulus nicht nur die jüdische Perspektive zu berücksichtigen ist, sondern auch die römische.85 Gottes Berufung sendet Paulus (Gal 1,16) zu den Völkern, die von Rom mit Gewalt beherrscht werden. Gott hat den Messias auferweckt, um dem Volk Israel und den Völkern Befreiung zu eröffnen. Wie Gott einst Jeremia als Prophet zu den Völkern gesandt hat (Jer 1,5),86 werden nun Paulus und andere jüdische und nichtjüdische Menschen zu den Völkern im Imperium Romanum gesendet. Davina Lopez zeigt an römischen öffentlichen Kunstwerken, wie die Völker in der römischen Propaganda als minderwertig, weibisch und bedrohlich dargestellt werden, um so den Massen einzuprägen, wie sinnvoll und notwendig ihre Unterwerfung durch Rom ist. Zu den Voraussetzungen, die 1 Kor 1,22–24 zu erkennen gibt, gehört also das Völkerevangelium, s. besonders 1,24. Die Gemeinde in Korinth besteht aus jüdischen und griechisch sprechenden Menschen aus den Völkern, die Gott in die Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferweckten Messias gerufen hat.
2. Die konkrete Auseinandersetzung, die Paulus in 1 Kor 1,22–24 anspricht, betrifft die Solidarisierung mit dem Gekreuzigten. Es gibt jüdische Menschen, die Zeichen erbitten, dass ein Gekreuzigter tatsächlich der Messias sei. Es geht nicht darum, dass generell jüdische Menschen Zeichen „fordern“ (so häufig in der Übersetzungstradition von 1,22). Es geht auch nicht darum, dass Paulus Zeichen grundsätzlich ablehnt (s. nur Röm 15,19). Vielmehr ist die Auferweckung des Messias durch Gott dieses Zeichen (vgl. Mt 12,38–42), es muss erkannt werden. Doch es gibt Menschen, die es nicht verstehen und die Kreuzigung für einen Sieg römischer Gewalt halten, dem Gott nicht widersprochen hat. Darum wird die Kreuzesnachfolge ihnen zum skandalon. Kreuzesnachfolge erscheint ihnen nur noch als verfängliches Verhalten, das unnötig römische Gewalt provoziert (vgl. Joh 11,48).
Im Blick auf die Bedrohung mit römischer Gewaltausübung im Alltag Korinths sollte aus heutiger Perspektive die Angst dieser jüdischen und nichtjüdischen Anhängerschaft des Messias Jesus ernst genommen werden.
Die von Gott in die messianische Gemeinschaft Gerufenen (1,24) sind für Paulus uneingeschränkt Teil ihrer unterschiedlichen Herkunftsvölker. Indem der Messias für sie als Gekreuzigter Gottes Kraft und Weisheit offenbart, bejahen sie Christi Auferweckung nicht nur in ihren Köpfen, sondern vollziehen sie in ihrem Leben.
1,25 1,25 Mit der Auferweckung des Gekreuzigten hat Gott die gesellschaftlichen Strukturen „der Menschen“ entwertet. Stärke / Macht und Weisheit geschieht durch die Auferweckung Gottes im Leben und nicht durch Erfolg in einer Gesellschaft, die auf Gewalt aufgebaut ist (s. auch Basisinformation „Weisheit dieser Welt“). „Das Unkluge, das zu Gott gehört, …“ bezieht sich auf die Kreuzigung, aber auch auf Menschen, s. 1,26–28. Der Genitiv bezeichnet die Zugehörigkeit.