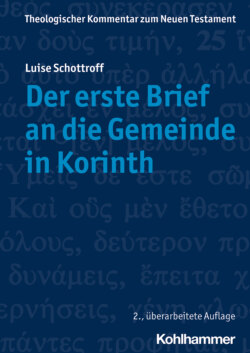Читать книгу Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth - Luise Schottroff - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIn 1,28 klingt die Schöpfung aus dem Nichts (vgl. Röm 4,17) an: Gott hat das Nichtseiende erwählt (1 Kor 1,28), er hat es ins Dasein gerufen (Röm 4,17). Gott macht die Toten lebendig, er schafft Leben aus dem Nichts. Paulus denkt bei der Schöpfungskraft Gottes nicht nur an die Erschaffung des Lebens in der Vergangenheit, sondern genauso auch in der Gegenwart. Was in Korinth geschah, als Gott Erniedrigte der Stadt zum Leib Christi zusammenfügte, ist Schöpfung aus dem Nichts, Auferstehung der Toten, Erhöhung der Erniedrigten. Damit soll nicht Gottes vergangenes und zukünftiges Handeln unwichtig werden, sondern das gegenwärtige Geschehen mitten ins volle Licht der Zuwendung Gottes gestellt werden. Wenn die ungebildeten und machtlosen Männer und Frauen in der Gemeinschaft mit dem Messias ihr Leben neu gestalten, geschieht Schöpfung aus dem Nichts, Rechtfertigung derer, die in Unrecht verstrickt sind (Röm 4,5). Bei dieser Deutung wird Rechtfertigung nicht mehr auf das Individuum in Beziehung zu Gott eingeengt, sondern Gottes Handeln auf das Leben der Menschen als Teil ihrer Welt und Gesellschaft. Gottes Handeln schließt die Mächtigen ein. Auch sie werden an einen neuen Platz gestellt.109
In 1,28 erwähnt Paulus noch einen weiteren Aspekt der gesellschaftlichen Situation derer, die unten sind: Sie werden verachtet. Hier nimmt er deutlich Bezug auf die Verachtung der Menschen, die mit Handarbeit ihr Brot verdienen müssen, durch die, die sich ihrer Bildung und Wohlhabenheit rühmen. Cicero schreibt: „Alle Handwerker befassen sich mit einer schmutzigen Tätigkeit, denn eine Werkstätte kann nichts Edles an sich haben. Am wenigsten kann man die Fertigkeiten gutheißen, die Dienerinnen von Genüssen sind: ‚Fischhändler, Metzger, Köche, Geflügelhändler und Fischer‘ […]“110
Lukian erzählt in seinem „Traum“ von zwei Frauen, die ihm erschienen: „die eine eine Arbeiterin, kräftig und derb wie ein Mann, mit struppigem Haar, die Hände voller Schwielen, mit aufgeschürztem Gewand, voller Kalkstaub“.111 Sie ist Steinmetzin, ein Gewerbe, das in Korinth häufig vorkam.112 Eine zweite Frau erschien Lukian im Traum: die Bildung (paideia). Sie bewertet die Steinmetzarbeit und rät ihm davon ab, Steinmetz zu werden: „Du wirst ja nichts als ein Arbeiter sein, der sich körperlich plagen und darauf die ganze Hoffnung seines Lebensunterhaltes setzen muss, selber unscheinbar, mit geringem und gemeinem (agenne) Verdienst, mit niedriger Gesinnung, eine minderwertige Person in der Öffentlichkeit […] eben nichts weiter als ein Arbeiter und einer aus der großen Menge, der jedesmal vor dem gerade Mächtigen sich duckt, dem guten Redner scherwenzelt, ein Hasenleben führt und die Beute der Mächtigen ist.“113 Cicero und Lukian zeigen, wie sehr Handarbeit und Bildung voneinander getrennt sind und dass die Gebildeten sich die Bildung finanziell leisten können und Selbstbewusstsein beziehen aus der Verachtung derer, die mit der Hand arbeiten.114
Auf diesem Hintergrund wird verständlich, welche Befreiung die Berufung Gottes für die Ungebildeten und Verachteten bedeutete. Sie waren nun Teil einer Gemeinschaft, in der ihre Würde als Heilige im Zentrum stand und in der ihnen Fähigkeiten und Klugheit zuwuchsen.
1,29 1,29 Das Überlegenheitsbewusstsein der Gebildeten und Wohlhabenden auf Kosten der Ungebildeten und Armen ist vor Gott nichts wert. Sie haben sich ihrer Weisheit, ihrer Macht und ihres Reichtums wegen (s. Jer 9,22) gerühmt / gebrüstet. Es geht um das Überlegenheitsbewusstsein und die damit verbundenen Handlungsmöglichkeiten der Elite. Zwar wird die Stadt noch von ihnen beherrscht, aber für die Messiasgemeinde sind sie entmachtet. Die „Weisheit der Welt“ bringt Strukturen des Sich-brüstens / kauchasthai hervor (s. o. Basisinformation zu „Weisheit dieser Welt“ bei 1,17).
Es wäre unangemessen, dieses Sich-Brüsten oder Prahlen moralisch zu bewerten. Es gehört zur Aufgabe der Elite, die hierarchische Struktur der Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Darum fängt schon bei den Körpern der Neugeborenen der Elite eine Formung für die Aufgabe der Überlegenheit an.115
Die in der Auslegungsgeschichte häufige Ontologisierung des „Sich-Rühmens“116 geht an den gesellschaftlichen Realitäten vorbei und auch an ihrer Zerstörungskraft für die Gemeinde in Korinth, die Paulus in 1,10–17 aufzeigt. Diese Ontologisierung des „Sich-Rühmens“ ist häufig auch für den christlichen Antijudaismus genutzt worden: Die Hybris „des frommen Juden“ repräsentiere die Hybris „des Menschen“ vor Gott.117
1,30 1,30 In 1,30 breitet Paulus den ganzen Reichtum aus, in dem die Messiasgläubigen als Gemeinschaft leben. Diesen Reichtum haben sie von Gott erhalten, der sie zum Leib Christi machte. Die bei Paulus häufige Wendung en Christo Jesu blickt gleichzeitig auf Gottes Handeln, der einen von Rom Gekreuzigten auferweckt, und auf das Ergebnis des Handelns Gottes: Die Gegenwart des Messias in Gestalt einer Gemeinschaft von Menschen an einem konkreten Ort, Korinth, und an vielen anderen. Die Wendung ist fast gleichbedeutend mit der paulinischen Rede vom Leib Christi (soma Christou). Die ungebildeten und erniedrigten Menschen, die in Korinth Leib Christi sind, haben nun Weisheit von Gott (vgl. 1,24; s. zu 1,5 und Basisinformation nach 1,25): Sie erkennen Gottes Handeln in Korinth, sie leben nach der Tora (s. zu 7,19) und sie bilden eine Tora-Auslegungsgemeinschaft von großer Kompetenz, auch wenn sie mehr oder weniger Analphabeten und Analphabetinnen sind.
Gerechtigkeit – die „uns“ Gott als Geschenk zuwendet, obwohl auch die Hafenarbeiter und Straßenhändlerinnen in Korinth sehen, wie sehr sie in Strukturen des Unrechts verstrickt sind. Sie erleiden Unrecht durch Machtmissbrauch, sind also Opfer. Aber sie sind selbst auch Täter und Täterinnen. Das Geschenk der Gerechtigkeit führt die Messiasgläubigen in die Erfüllung der Tora. Zwischen „unserer“ Gerechtigkeit und der Gerechtigkeit Gottes zu unterscheiden, verhindert, den Zusammenhang von beiden zu erkennen. Gottes Gerechtigkeit ist sein befreiendes Handeln, dass die Messiasgläubigen fähig macht zum Halten der Tora.
Heiligung – durch die Gemeinschaft mit Christus werden die Menschen zu Heiligen (s. o. zu 1,2).
Befreiung – vgl. Röm 3,24. Das hier verwendete Wort apolytrosis bezieht sich in der gesellschaftlichen Realität auf den Loskauf von Gefangenen durch Lösegeld,118 aber das Wort bringt zugleich die Befreiung des versklavten Volkes Israel aus Ägypten in Erinnerung.119 Das zeigt sich daran, dass die Metapher nicht an der Frage orientiert ist, was denn nun der Kaufpreis war. Gottes Handeln hat die Messiasgläubigen aus der Sklaverei befreit. Im Zusammenhang von 1 Kor 1,30 ist dabei an die Befreiung von den Strukturen dieser Welt zu denken, die im Römerbrief „Sünde“ genannt werden. Das Leben unter den Bedingungen des römischen Reiches wird auch für Freigeborene als Sklaverei bezeichnet.120 Dass der korinthischen Gemeinde Sklavinnen und Sklaven angehören ist eindeutig, auch wenn der Nachweis im Einzelnen schwierig ist. Personennamen und Gruppenbezeichnungen (die Leute der Chloë 1,11; das Haus des Stephanas 1,16) können auf Versklavung hindeuten.121
Wenn also die Zugehörigkeit zum Messias in 1,30 apolytrosis bringt, dann ist Befreiung von der Sklaverei im Sinne der strukturellen Sünde und des Lebens in einem System der Gewalt gemeint. Befreiung vom rechtlichen Status der Versklavung für Sklavinnen und Sklaven ist damit nicht gemeint, wohl aber ein Leben als „Freigelassene Christi“ (7,22). Sie sind den Freigeborenen in der Gemeinde gleichgestellt. Die Gemeinde arbeitet gemeinsam für eine Lebensgestaltung in der Gemeinde und darüber hinaus, die der Weisheit der Welt und ihrer Lebensfeindlichkeit ein Ende setzt.
1,31 1,31 Paulus führt einen Satz, der in Anlehnung an Jer 9,23 (LXX) bzw. 1 Sam 2,10 (LXX) formuliert ist, als Schriftzitat ein. Paulus hat andere Vorstellungen vom Zitieren als die gegenwärtige historische Wissenschaft (s. Basisinformation bei 7,19). Die Einführung des Zitates ist ebenfalls ein Kürzel, er sagt nur hina kathos und deutet seine Schrifthermeneutik an: Gott rede in der Schrift „unseretwegen“ (Röm 4,23.24; 1 Kor 9,10). Gottes Wort in der Schrift soll von „uns“ (s. Basisinformation vor 2,6) gelebt werden. Sich des kyrios rühmen / den kyrios preisen – hat zu unterschiedlichen Deutungen geführt: Ist Gott oder Christus gemeint? Paulus hat den Satz als Schriftzitat verstanden wissen wollen, deshalb sollte er auf Gott gedeutet werden und kyrios als Platzhalterwort des Tetragramms.122 Gott zu loben ist die wahre und unerschöpfliche Kraftquelle – nicht aber eigenen Besitz oder Bildung gegen Andere auszuspielen.