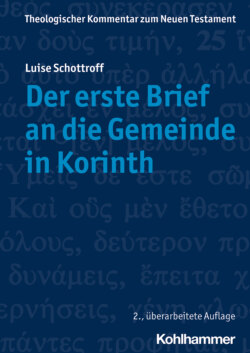Читать книгу Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth - Luise Schottroff - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Basisinformation: Die Weisheit dieser Welt
ОглавлениеPaulus benutzt in seiner Erörterung der Weisheit der Welt eine Rhetorik der Negationen und Antithesen.48 Die negativ qualifizierte Seite ist häufig als paulinische Darstellung der Lehre oder Meinung der „Gegner“ gelesen worden. Auch die feministische Diskussion bleibt meist in diesem Deutungsmuster; sie hält die Gegner des Paulus für korinthische Prophetinnen mit einer Weisheitsbotschaft, die ihnen Stärke und Statusgewinn in der Gemeinde verschafft.49 Mit solchen Vorstellungen von Gegnerinnen oder Gegnern ist oft die Annahme verbunden, sie verträten eine radikale präsentische Eschatologie (so wird dann besonders 4,8 gedeutet), seien also „enthusiastisch“.50 Betrachtet man jedoch die paulinischen Angaben, wer denn nun diese Weisheit vertritt, so zeigt es sich, dass er nicht konkrete einzelne Menschen im Blick hat. So kann er von „Weisheit des Wortes“ (1,17) reden, auch von „Weisheit der Menschen“ (2,5 vgl. 1,25; 2,9; 2,4 in einer abweichenden Textlesart) oder von „Weisheit dieser Welt“ (1,20; 3,19, s. ähnlich: 1,21; 3,20) bzw. von der Weisheit „dieses Aions“ (2,6; 3,18). Paulus zeichnet hier Strukturen „der Welt“ (kosmos). Es ist nicht anzunehmen, dass irgendwer sagt: „ich verfüge über die Weisheit der Welt“, wohl aber, dass es für die meisten Menschen attraktiv ist, als weise zu gelten. Paulus sieht eine Gesellschaft vor sich, in der sophia / Weisheit strukturell denen zuzuordnen ist, die in ihr etwas darstellen, die anerkannt sind.
Die gesellschaftlichen Strukturen der Welt, die nach Paulus durch Weisheit gekennzeichnet ist, lassen sich in groben Konturen nachzeichnen. So sieht Paulus diese Weisheit:
Die Weisheit hat einen Aspekt von Bildung und Beredsamkeit (s. 1,17.19.20; 2,4.13; 3,20).51
Das Weisheitsstreben bringt Konkurrenz und kauchasthai / sich in die Brust werfen / prahlen / überlegen sein wollen hervor (1,12; 3,18–22; 4,7.8).
Die Weisheit verhindert die Solidarität mit dem gekreuzigten Jesus / Messias und anderen Gekreuzigten (1,18).
Die Weisheit hat zur Kreuzigung Jesu durch die „Archonten“ geführt (2,6–8).
Die Weisheit wird in gesellschaftlichen und gleichzeitig mythischen Vorstellungen beschrieben. Die alte Frage, ob mit den „Archonten“ in 2,6–8 Dämonen oder Herrschende gemeint sind,52 beantworte ich mit „sowohl als auch“. Paulus spricht in dieser Frage die Sprache der apokalyptischen und gnostischen Mythologie,53 doch finden die dämonischen Mächte auch Verkörperungen in Herrschaftsmächten, z. B. in politischen Machthabern. Die Herrschenden sind die sichtbare Spitze des unsichtbaren Eisbergs der Mächte. Irdisch, unterirdisch und im Himmel arbeiten Herrschaftsmächte daran, sich die Menschen zu unterwerfen und sie zu Instrumenten des Todes zu machen. Für Paulus ist diese Vorstellung von Mächten wichtig, s. 15,24; 3,22; Röm 8,38.39; Phil 2,10.
Die Biografien der Gemeinde und des Paulus selbst sind Zeugnis dafür, dass der Weisheit der Welt und ihren Mächten Gottes Macht entgegentritt: 1,26–31; 2,1–5; 4,8–13; ebenso ist die Auferweckung eines von Rom Gekreuzigten der machtvolle Widerspruch Gottes gegen die tödlichen Strukturen dieser Welt (1,18–31). Teil dieses Zeugnisses ist auch die „counter-rhetoric“ des Paulus,54 die den Zielen antiker Elite-Rhetorik entgegensteht.55 Während die Elite-Rhetorik ein Mittel zur Herrschaft über Menschen sein will und die Ideologie imperialer Macht vertritt, ist die paulinische Rede an Gerechtigkeit für die Armen und die Opfer der Gewalt orientiert.
Die biblische Tradition spricht in die Gegenwart dieser Erfahrung von Weisheit der Welt und ihrer Überwindung: In 1,18 bezieht Paulus sich dafür auf Jes 29,14, in 1,31 auf Jer 9,22.23; in 2,9 auf eine unbekannte Schrift; 3,19.20 auf Hiob 5,12.13 und Ps 94,11. Hier in 3,20 ersetzt Paulus das Wort „Menschen“ im Schriftwort durch „Weise“, um den aktuellen Bezug unmissverständlich zu machen. Die zentralen Stichworte – „Weisheit“ der Menschen, die Gott zunichtemacht (Jes 29,14), Begrenztheit des Herzens / Verstandes „der Menschen“ (2,9 unbekanntes Zitat) und das „prahlen“ / kauchasthai (Jer 9,22.23) der paulinischen Darlegungen – korrespondieren mit der Schrift.
1,18 1,18 Was ist mit dem logos vom Kreuz, meist mit „Wort vom Kreuz“ übersetzt gemeint? Wer spricht hier das Wort zu wem und was ist sein Inhalt?
Mit dem Kreuz ist die Kreuzigung Jesu in Jerusalem gemeint. In den Jahren, als Pilatus Präfekt von Judaea war (26–36 n. Chr.), ist Jesus durch die römische Armee öffentlich hingerichtet worden. Paulus nimmt auch in 2,6–8 auf die Kreuzigung Bezug. Das römische Imperium hat die Kreuzigung zur politischen Disziplinierung der Bevölkerung, vor allem der versklavten Menschen aus den unterworfenen Völkern, benutzt.56 Es gab römische Kreuzigungen, manchmal als Massenkreuzigungen, vor Jesu Tod und lange danach. Als dieser Brief nach Korinth geschrieben wurde, war Kreuzigung eine reale Bedrohung für die Menschen, zumal für die unteren Klassen der Gesellschaft. Die Angst aufzufallen und der Druck, sich anzupassen, waren groß und hielten die Bevölkerung unter Kontrolle. Ein solidarisches Wort über einen Gekreuzigten oder Tränen der Trauer in der Öffentlichkeit konnten zu Verhaftung und der eigenen Hinrichtung führen.57 Einen Gekreuzigten als von Gott Auferweckten zu verehren, bedeutete eine riskante politische Kühnheit, die jederzeit lebensgefährlich werden konnte, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. Solange das römische Reich Kreuzigungen durchführte, hätte das Kreuz niemals ein Symbol sein können, es sei denn ein Symbol der Gewalt (s. Basisinformation bei 11,23).
Seit Augustus verfolgte Rom eine umfassende und politisch motivierte Religionspolitik. Es gab eine wohldurchdachte Staatsreligion oder besser Loyalitätsreligion, die den ideologischen Zielen der pax romana diente.58 Sie war in den Tempelgebäuden der Großstädte unübersehbar präsent, auch in Korinth (s. 8,10). Die von Rom unterworfenen Völker konnten weiter mit ihren angestammten Religionen leben, solange sie nicht mit der staatlichen Loyalitätsreligion in Konflikt gerieten. Jüdische Menschen sind immer wieder in solche Konflikte geraten.59 Neben dieser fragilen Duldung nichtrömischer Religionen gab es gesellschaftlich abweichenden Gruppierungen gegenüber eine kontinuierliche Unterdrückungspolitik durch Kaiser und Senat. In diese Linie gehört ein Edikt im Jahre 19 n. Chr., das u.a. die jüdische Bevölkerung Roms traf:
„Der Einführung fremder Religionsgebräuche, namentlich der ägyptischen und jüdischen Kulte, gebot er [Tiberius] Einhalt. Er zwang die Leute, die sich zu solchem Aberglauben bekannt hatten, die zu ihrem Gottesdienst gehörigen Kleider samt allem Kultgerät zu verbrennen. Die jungen Juden ließ er als Soldaten zum Kriegsdienst ausheben und unter diesem Vorwand über die Provinzen mit ungesundem Klima verteilen. Die übrigen Angehörigen dieses Volkes und die Anhänger judaisierender Sekten wies er aus Rom aus.“60 Zwar sind im Jahr 19 n. Chr. die „judaisierenden Sekten“ noch nicht auf Jesus-Messias-Gruppen zu beziehen, doch zeigen sich hier die religionspolitischen und rechtlichen Voraussetzungen, mit denen die Gemeinde in Korinth rechnen musste.