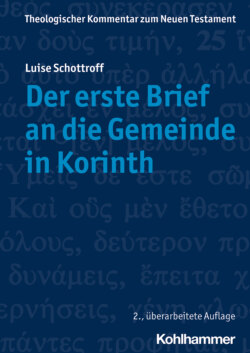Читать книгу Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth - Luise Schottroff - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Christlich-Jüdischer Dialog
ОглавлениеAuf die grundlegende Frage, die Luise Schottroff 2013 in der Einleitung stellt: „Wer war Paulus?“ folgt als erstes die Überschrift: „Paulus der Jude“. In ihren Veröffentlichungen wird deutlich, dass der christlich-jüdische Dialog maßgeblich ihr Denken bestimmt. Im Kommentar zum Brief an die korinthische Gemeinde liest sie Paulus konsequent als jüdischen Autor, der seinen theologischen Traditionen treu geblieben ist, als er zum Glauben an Jesus als den Messias Israels kam. Damit positioniert sie sich innerhalb einer international geführten Debatte, die unter dem Stichwort „Paul within Judaism“ jüdisch- und christlich-theologische Forschungen zu Paulus bündelt.3 Ein zentrales Anliegen ihrer gesamten exegetischen Arbeit ist die Überwindung des christlichen Antijudaismus. Im Rahmen einer Theologie nach Auschwitz sieht sie es als wichtige Aufgabe an, antijüdische Stereotype und Denkschemata zu erkennen und Alternativen zu entwickeln – in dem Bewusstsein, dass es im deutschen Kontext bisher keine vollständig nicht-antijudaistische christliche Theologie gibt.
Seit Mitte der 1960er Jahre entstanden in der neutestamentlichen Wissenschaft erste Ansätze, die Schriften des Paulus im Kontext des antiken Judentums zu deuten, die aktuell unter der Überschrift „New Perspective on Paul“ bzw. „Post-New Perspective on Paul“ oder „Paul within Judaism“ diskutiert werden. Für die Debatte im deutschsprachigen Raum war das Buch von Krister Stendahl „Paul among Jews and Gentiles“ (1976) grundlegend, das 1978 unter dem Titel „Der Jude Paulus und wir Heiden“ übersetzt erschien. Dieses Verständnis des jüdischen Paulus nahm Luise Schottroff schon sehr früh auf und entwickelte es in ihrer eigenen Arbeit konsequent weiter.
Ende der 1980er Jahre wurde im Kontext deutschsprachiger Feministischer Theologie die Frage nach dem Antijudaimus in der christlichen Theologie in einer breiten Öffentlichkeit geführt, angestoßen vor allem von jüdischen Theologinnen. Sie kritisierten, dass auch Feministische Theologien unreflektiert antijüdische Stereotype christlicher Theologien fortschrieben, wie z.B. die Darstellung Jesu als dem „neuen Mann“, der Frauen aus einem patriarchalen, frauenunterdrückenden Judentum befreie. Der Band „Von der Wurzel getragen. Christlich-feministische Exegese in Auseinandersetzung mit Antijudaismus“, der 1996 von Luise Schottroff und Marie-Theres Wacker herausgegeben wurde, bildet die daraufhin entstandenen exegetischen Diskussionen und deren Ergebnisse ab. Der von ihr in diesem Buch veröffentlichte Aufsatz stellt Alternativen zum (oft antijüdisch konnotierten) Konstrukt „gesetzesfreies Heidenchristentum“ dar.4 Programmatisch fasst sie diese 2013 in der Einleitung des Kommentars zum ersten Brief an die Gemeinde in Korinth zusammen: „Paulus ist durch seine Berufung nicht Christ geworden, sondern ein göttlicher Bote, der die befreiende Botschaft von der Erweckung Jesus verbreitet. Paulus hat Befreiung vom Tun der Ungerechtigkeit unter der Herrschaft der Sünde verkündet, nicht Befreiung von der Tora und der Erfüllung ihrer Weisungen. Es geht also um die Befreiung zur Tora und nicht von der Tora.“
Luise Schottroff liest nicht nur die Briefe des Paulus, sondern auch die Evangelien im theologischen Kontext des Judentums. In ihrem Buch über die Gleichnisse Jesu, das 2005 erschienen ist und mittlerweile in 3. Auflage 2010 vorliegt, werden die neutestamentlichen Gleichnisse im Vergleich mit rabbinischen Gleichnissen konsequent von ihrem jüdischen Hintergrund her gedeutet.5 Posthum veröffentlicht wurden 2019 ihre Auslegungen zum Matthäus-Evangelium.6