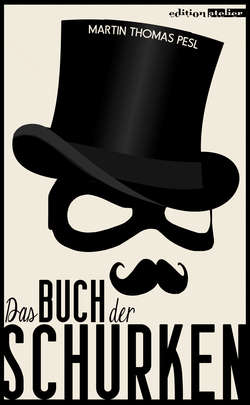Читать книгу Das Buch der Schurken - Martin Thomas Pesl - Страница 3
VORWORT
ОглавлениеVon 2008 bis 2015 hatte ich den Auftrag des Magazins WIENER, in jeder Ausgabe einen Klassiker der Weltliteratur in einem unterhaltsamen Kurztext für Menschen zu behandeln, die das Werk nicht gelesen, wahrscheinlich aber davon gehört haben. Ich – ein leidenschaftlicher Leser, der nicht versteht, warum manche Leute sich nicht für Bücher interessieren, und umgekehrt keine Begründung braucht, wenn jemand Bücher mag – war also jahraus, jahrein mit der Frage beschäftigt, was einen Romanklassiker ausmacht und warum man ihn auch eine signifikante Zeit nach seinem Erscheinen noch genießen kann.
Sarah Legler und Jorghi Poll vom Verlag Edition Atelier luden mich daraufhin ein, dieser Frage auch in Buchform nachzugehen, und zwar mit Blick auf ein ganz bestimmtes Detail: der Figur des Schurken in der Weltliteratur. Was das ist, fanden wir in weiterer Folge für uns heraus. Die Definition von Schurke umfasst natürlich Schurken und Schurkinnen, Bösewichte, Unsympathen, Antagonistinnen, Fieslinge, Gauner, Egomanen, üble Hunde und sonstige widrige Mächte. Sie wollen jemandem Böses oder sich selbst – und nur sich selbst – Gutes. Sie richten Schaden an und entschuldigen sich nicht sofort ehrlich dafür. Sie begehen Verbrechen und wissen dabei genau, was sie tun. Viele wünschen sich einfach, sie wären nicht da – bis auf die Leserinnen und Leser, die diese Figuren meistens am spannendsten finden und daher zum Kult erhoben haben.
Meine Vorgehensweise war ähnlich wie bei der WIENER-Klassikerrubrik: Lektüre von und zu den entsprechenden Werken (wir beschränkten uns auf Romane, weil die Schurkenflut sonst allein schon dank Shakespeare nicht zu bewältigen gewesen wäre) und Verfassen eines Textes – so entstanden genau 100 Lexikoneinträge zu den nicht so netten Figuren aus Büchern.
Wer schafft es auf die Liste?
Bis es so weit war, machte unsere Liste mehrere Fassungen durch: Manche Schurken disqualifizierten sich nach erfolgter Lektüre; auf andere stieß man erst durch zwanglose Plaudereien (danke, Crowd!). Das finale Verzeichnis ist natürlich nicht vollständig und kann es niemals sein, und doch erhebt die Liste Anspruch auf 1.) absolute Subjektivität und 2.) den Versuch einer Ausgewogenheit zwischen bekannten und unbekannten Figuren, männlichen und weiblichen, den Regionen und Sprachen der Welt und den Epochen. Vor allem aber: 1.) absolute Subjektivität, die beispielsweise zuließ, dass aus dem Harry-Potter-Universum nicht der Dunkle Lord selbst unter die Lupe genommen wurde, sondern die kitschige Mitläuferin Dolores Umbridge. Eine weitere selbst auferlegte Regel im Sinne der Diversität: nur ein Schurke / eine Schurkin bzw. nur ein Artikel pro Autor bzw. Autorin.
Schurke ist nicht gleich Schurke
Die 100 Schurken fallen in zwölf Kategorien. Diese Kategorien wurden der Liste im Nachhinein auferlegt; denn die Gründe, die jemanden oder etwas schurkisch sein lassen, sind natürlich noch mannigfaltiger. Bücher, die wir verschlingen und die zu Klassikern werden, leben von Handlungen. Handlungen leben von Konflikten. Konflikte kann es auch geben, wenn alle es gut meinen. Konflikte können innere Konflikte sein. Und doch kommt es oft genug vor – im anglophonen mehr noch als im deutschsprachigen Raum –, dass uns Schreibende mit Figuren locken, die dagegen sind, die es zu bekämpfen gilt, mit denen wir uns nicht identifizieren können oder wollen. Oder mit denen wir uns durchaus identifizieren, obwohl sie gegen das Gesetz, die Moral oder die nervige Hauptfigur agieren.
Zivilisation als Gradmesser
Der älteste Schurke aus unserem Pool stammt aus einer Zeit, als die Bewertungsmechanismen der Menschen für lebende Wesen noch in den Kinderschuhen steckten – ganz zu schweigen von der Abstraktion in fiktive Sphären. Enkidu aus dem 4000 Jahre alten Gilgamesch-Epos wird erst allmählich zum Menschen, sein impliziertes Schurkentum ist das der noch fehlenden Zivilisation. Auf der anderen Seite des Zeitstrahls tobt Adam Stensen aus T. C. Boyles 2015 erschienenem Roman Hart auf Hart. Er läuft nackt durch die Wohnung seiner Freundin und barfuß durch den Wald, voller Sehnsucht nach einem pureren, raueren Leben mit weniger sinnloser, verderbter Zivilisation.
Auf den ersten Blick scheint sich also nicht viel verändert zu haben in Tausenden von Jahren der Menschheits- und Kulturgeschichte. Der Bogen ist aber denkbar weit gespannt. Auf wütende Wilde wie Enkidu oder auch Grendel aus der Beowulf-Saga folgten in den Epen und Sagen von mythologischen Götterwelten die Trickster (englisch für »Gauner, Betrüger«, aber irgendwie liebevoller), die mit kindischen Scherzen die bestehende Ordnung durcheinanderbringen – Loki aus der Edda ist das perfekte Beispiel. Je menschlicher die Helden wurden, desto mehr galt das auch für ihre Gegner. Die Trennlinien zwischen Gut und Böse wurden dabei besonders durch christliche Moralvorstellungen geprägt.
Der Moralapostel als Schurke
Das tun sie auch heute noch, wenn auch gelegentlich unter umgekehrten Vorzeichen. Nicht selten stehen seit der Aufklärung die Klerikalen und Moralapostel am literarischen Pranger: der Baron von Innstetten etwa mit seiner letztlich tödlichen Überreaktion auf das Affärchen seiner Effi Briest oder der mörderische Mönch aus Der Name der Rose auf seinem Kreuzzug gegen das Lachen.
Und es müssen nicht gleich Mord und Totschlag sein (dass die nicht grundsätzlich wünschenswert sind, diese Haltung hält sich übrigens recht konstant in der Weltliteratur). Die negative Energie kann mit zunehmender Schärfung des möglichen Autorenweltblicks auch einfach von den Erwachsengewordenen, den Angepassten, eben den übermäßig Zivilisierten ausgehen. Das Fräulein Rottenmeier zum Beispiel meint es gewiss nicht böse mit der strengen Frisur und dem Unverständnis für Menschen, deren Welt nun einmal die Berge sind.
Die Industrialisierung
Die Schurken des 19. Jahrhunderts sind oft solche, die entweder im Kleinen gesellschaftliche Idyllen stören (etwa der Holländer Michel in Das kalte Herz) oder eben gesellschaftliche Zwänge etablieren (neben Heidis Fräulein Rottenmeier auch Paule Rezeau, die Viper im Würgegriff) oder in einer Ära, als die Industrialisierung bei vielen ohnehin schon Paranoia und Existenzängste weckt, »wahnsinnige« Ideen zu Fortschritt und Technik propagieren (nicht zuletzt Frankenstein mit seiner monströsen Schöpfung). Im 20. Jahrhundert war in Europa zuerst eher Schluss mit schurkisch – beziehungsweise lenkten die Weltkriege den Fokus der geschockten Menschheit eine Zeit lang auf das allzu reale Schurkentum, dem sie ausgesetzt war. Umgekehrt haben sich die Fiktionen der Nazis darüber, was ein Schurke ist, zum Glück nicht auf breiter Basis gehalten.
Weltherrschaft & Psychopathen
Zwischen den Kriegen hatte Freuds frischer, tiefer Blick in die menschliche Seele die literarischen Figuren zudem so nachvollziehbar gemacht, dass man ihnen nicht recht böse sein durfte. Erst als die Psychoanalyse schon längst Standard war, kam ein neuer Lieblingsschurke hinzu, bis heute einer der Stars auf dem fiktionalen Antagonistenparkett: der fasziniert wie ein Held begutachtete Psychopath im Spannungsverhältnis zur zivilisierten westlichen Gesellschaft. Ab dem Kalten Krieg spannen die Schurken auch noch Weltherrschaftsfantasien (siehe so ungefähr alle James-Bond-Romane von Ian Fleming). Auch die, die schon an der Macht sind, kriegen in den Büchern ihr meist grotesk überhöhtes Schurkenfett weg: Herrschende von Lateinamerika (Der Herbst des Patriarchen) über die britische Countryside (Farm der Tiere) bis Afrika (Der Herr der Krähen).
Reiche Schnösel & arme Schlucker
Womit wir bei einem neueren Feindbild wären, das mit dem Weltherrschaftsebenso eng verknüpft ist wie mit dem Psychopathenfaktor: der Schurke Kapitalismus. Ob reicher Schnösel (Der große Gatsby) oder armer Gauner (Die Elenden): Wer zu viel Geld und / oder Macht hat und / oder will, wird vom eigenen Autor zumindest kritisch beäugt (Ayn Rand bildet da die monströse Ausnahme) und gerät schnell auf die Schurkenbahn. Patrick Bateman tickt in American Psycho sicherlich auch deshalb aus, um die ihm durch Anzug und Visitenkarten geebnete Wall Street zum gemainstreamten Reichtum zu verlassen.
Weltliteratur & Ausnahmen
Die Genreliteratur im Detail habe ich außen vor gelassen – ich würde gerne behaupten: nur aus Platzgründen, aber die Wahrheit ist, dass ich nicht das Geringste von den beeindruckenden Fantasy-, Rollenspiel- und Vampirbisswelten verstehe, die sich vor mir aufgetürmt hätten, hätte ich mich darauf eingelassen. Einige der Paradeschurken, die – oft stark überzeichnet und von Grund auf böse – in erster Linie dem Unterhaltungsprinzip unterliegen, sind jedoch so legendär, dass man nicht über sie hinwegsehen konnte: Sauron etwa oder der Baron Harkonnen.
Andere haben schlichtweg Morde begangen und sind ihrer zu überführen. Obwohl mir das Genre des Whodunits deutlich näher liegt als jene von Game of Thrones und Fifty Shades of Grey, habe ich auch hier nur Mordende ausgewählt, die sich durch Besonderheiten auszeichnen – Raffinesse, Grausamkeit oder philosophische Unterfütterung: Glavinics Kameramörder zum Beispiel, oder den bei Agatha Christie, der es schafft, alle zehn Personen auf einer Insel zu töten.
Bösewichte kommen gerne auch in Büchern für junge Leser vor; je schärfer Autoren hier die Grenze zum Übel ziehen, desto erfolgreicher werden ihre Werke. Und gar nicht wenige davon bleiben in Erinnerung und haben auch in dieses Buch Eingang gefunden: vom hungrigen Tiger Schir Khan zu den Vertretern der dunklen Magie in Hogwarts und Umgebung.
Männer sind Schurken
Der Versuch eines geschlechtergerechten Blicks ist dabei zum Scheitern verurteilt. Historisch betrachtet war der Club der Weltautoren immer männlich dominiert und hat sich bevorzugt auch männliche Gegenfiguren erschrieben, während er die Frauen, wenn schon als starke, dann besonders gerne entweder als Mütter oder als erotisch vernichtende Femme fatales herbeifantasierte. Eine 50:50-Quote ist uns also nicht gelungen, bei den Autorinnen schon gar nicht, bei den Schurkinnen leider auch nicht. Die Liste beruht auf Werken von zehn Autorinnen, 83 Autoren, zwei männlichen Autorenpaaren und fünf unbekannten Verfassern. Von den 100 besprochenen Schurken sind 62 eher ein Mann, 21 eher eine Frau, acht sind Paare oder Personengruppen (jeweils unterschiedlichen Geschlechts, aber mehr Männer), fünf lassen sich als Tiere einstufen und vier passen endgültig in keine dieser Kategorien.
Schurken gibt es überall
Die Bücher stammen zu einem überraschenden Großteil aus dem englischsprachigen, gefolgt vom deutschsprachigen Raum, aber ich habe mich bemüht, auch Schurken aus kleineren Ländern Europas sowie aus Asien, Afrika und Südamerika zu Wort kommen zu lassen: Aus dem alten Arabien, aus Argentinien, China, Island, Kenia, Kolumbien, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, der Türkei und Ungarn ist jeweils nur genau ein Buch dabei.
Der Reiz des Bösen
Mit allen schurkischen Fiktionen ist eine gewisse Lust verbunden. Es geht uns gut, also genießen wir das Böse. Gleichzeitig sagen Schurken oft mehr über die Gesellschaft ihrer Zeit aus als Helden, weil sie einerseits Feindbilder verkörpern, auf die sich alle einigen können, und andererseits eine gewisse Sehnsucht widerspiegeln, aus den bestehenden Systemen auszubrechen, unartig zu sein, seinen eigenen Weg zu gehen. Ein reales Problem, das wir selbst nicht angehen können oder wollen, bleibt so, verlagert in die Lektüre, dennoch auf wohlige Art bei uns.
Oft lieben wir diese Bösen daher mehr als wir sie hassen. Oft brummen wir auch befriedigt, wenn sie ums Leben kommen. Aber selten vergessen wir sie als Erste, wenn die Lektüre länger zurückliegt – weil sie einen Nerv getroffen, uns in eine Geschichte hineingezogen und den Akt des Lesens von einem rein geistigen auch zu einem emotionalen Erlebnis gemacht haben. Den Reiz des Bösen – auch bzw. gerade weil es »nur« in einer Geschichte lebt – möchte diese Arbeit betonen und erkunden. Die launigen Illustrationen stammen aus der talentierten Hand des durchaus belesenen Kristof Kepler, der nur in einigen Fällen einzig meinen Artikel als Inspirationsquelle zur Verfügung hatte.
(K)ein Lexikon
Dieses Buch ist ein Lexikon. Das heißt, man muss es nicht von vorne bis hinten lesen. Man darf sich morgens zum Kaffee oder auf eine Zigarettenlänge ein, zwei Schurken des Tages zuführen. Man kann im Buch der Schurken blättern und überlegen, welche Romanentdeckung mit einer Prise Fiesem man als Nächstes erkunden möchte. Wer der schurkischere Hochstapler ist: Felix Krull oder der mit dem lustigen Namen, Lafcadio Wluiki? Wer zuerst böse war: Frankenstein oder sein Monster; Moby Dick oder Captain Ahab? Oder wem aus der Liste der Konzernchef XY oder die Schwester des Exfreundes eigentlich am ehesten gleicht?
Der britische Guardian hatte 2014 / 5 eine kleine Serie zum Thema Baddies in Books. Im Internet steht ein Schurken-Wiki zur Verfügung. Eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema in Form eines erschöpfenden Lexikons blieb bisher erstaunlicherweise aus. Auch mein Buch – ein Hochstapler wäre ich, würde ich das behaupten! – ist keine solche. Aber es macht hoffentlich Spaß. So wie geschriebene Schurken.
Martin Thomas Pesl