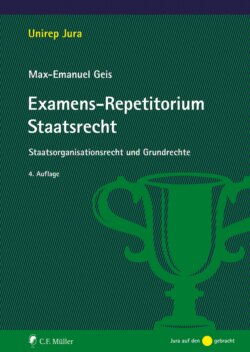Читать книгу Examens-Repetitorium Staatsrecht - Max-Emanuel Geis - Страница 107
На сайте Литреса книга снята с продажи.
bb) Maßstab der „tatbestandlichen Rückanknüpfung“
Оглавление111
Nach dem Maßstab der tatbestandlichen Rückanknüpfung muss sich die Zulässigkeit an der Vereinbarkeit mit Grundrechten messen lassen. Erst im Rahmen der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne ist der Vertrauensschutz in der Abwägung zu berücksichtigen. Die Grundrechtsprüfung soll an dieser Stelle keinen Schwerpunkt einnehmen, jedoch wird auf die wichtigsten Besonderheiten im Zusammenhang mit Steuern eingegangen.
112
Die Besteuerung der Einkünfte des C, die er bis einschließlich Mai 2020 erzielt hat, könnte einen Verstoß gegen Art. 14 GG darstellen. Dies ist der Fall, wenn der Schutzbereich des Art. 14 I GG eröffnet, ein hoheitlicher Eingriff in diesen Schutzbereich gegeben und dieser nicht verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Art. 14 I GG schützt nur vermögenswerte Rechte, nicht das Vermögen als solches,[48] und auch nicht den (steuerfreien) Erwerb oder bloße Erwerbsaussichten.[49] Somit ist bereits die Eröffnung des Schutzbereichs abzulehnen. Außerdem ist die Erhebung von Steuern und die damit einhergehende Reduzierung von Einnahmen nur ein Eingriff, wenn die Existenz des Steuerpflichtigen gefährdet werden würde.[50] Die Besteuerung der Übungsleitertätigkeit wirkt hier jedoch nicht existenzgefährdend. Folglich ist auch ein Eingriff in Art. 14 I GG abzulehnen.[51]
113
In Betracht kommt weiterhin ein Verstoß gegen Art. 2 I GG, da die Steuerpflicht die allgemeine Handlungsfreiheit des Steuerpflichtigen C einschränken könnte. Die allgemeine Handlungsfreiheit umfasst als Auffanggrundrecht alle Betätigungen und Lebensbereiche, die nicht bereits in den Schutzbereich eines spezielleren Grundrechts fallen.[52] Darunter fällt auch die Einnahmenerzielung und Mittelverwendung nach Belieben des Bürgers, im weitesten Sinne die wirtschaftliche Betätigung.[53] Der Schutzbereich des Art. 2 I GG ist hier daher eröffnet.
114
Sobald natürliche Handlungsmöglichkeiten durch staatliche Maßnahmen eingeschränkt werden, bedarf dies einer Rechtfertigung. Insofern schützt Art. 2 I GG auch vor der Einführung einer etwaigen Steuerpflicht.[54] Durch die Besteuerung der Einkünfte aus der Übungsleitertätigkeit wird C in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt. Diese Abgabepflicht vermindert seine tatsächlichen Einnahmen und damit auch die Verwendungsmöglichkeiten der durch diese Tätigkeit erlangten Mittel.[55] Somit ist ein Eingriff durch das Änderungsgesetz zu bejahen. Dieser Eingriff könnte jedoch durch die Schranke der verfassungsgemäßen Ordnung aus Art. 2 I GG gerechtfertigt sein. Davon ist die gesamte Rechtsordnung umfasst, soweit sie formell und materiell verfassungsgemäß ist.[56] Demzufolge ist auch das Änderungsgesetz zum EStG eine Rechtsnorm, die als Schranke einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit rechtfertigen kann. Allerdings müsste hierfür das Änderungsgesetz verfassungsgemäß, insbesondere verhältnismäßig sein.
115
Exkurs
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, gelegentlich auch Übermaßverbot genannt, ist eine Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips[57] und gilt als Leitregel allen staatlichen Handelns.[58] So hat etwa die Verwaltung den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Rahmen des Verwaltungsermessens, sofern ihr ein solches im jeweiligen Gesetz eingeräumt wird, zu beachten. In diesem Zusammenhang ergänzt das Übermaßverbot den ebenfalls aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Soweit es um die Freiheitsrechte des einzelnen Bürgers geht, ist das Verhältnismäßigkeitsgebot Ausdruck der Grundrechte und findet seinen dogmatischen Eingang in die verfassungsmäßige Rechtfertigung staatlicher Eingriffe. Zugleich kann es aber auch zwischen einzelnen Staatsorganen zur Anwendung kommen, wenn eine geschützte Rechtsposition beeinträchtigt wird, und ist dann direkt als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips zu verstehen.[59] Beispielhaft sei hier die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens durch die zuständige Behörde im Baurecht erwähnt (gem. § 36 II 3 BauGB i.V.m. den jeweils einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften). Die Ersetzung greift in die Planungshoheit der Gemeinde als Teil des kommunalen Selbstverwaltungsrechts aus Art. 28 II GG ein. Dieser Eingriff ist insbesondere nur dann rechtmäßig, wenn er verhältnismäßig ist.[60]
Dies gilt bei einer staatlichen Maßnahme gerade dann, wenn sie einen legitimen Zweck verfolgt und geeignet ist, dessen Erreichung zu fördern. Darüber hinaus muss die Maßnahme erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne, also angemessen sein.[61] Für die Bestimmung der Geeignetheit gelten unterschiedliche Maßstäbe, die davon abhängig sind, ob ein Organ der Legislative, der Exekutive oder der Judikative handelt. Maßnahmen der Verwaltung sind grundsätzlich vollumfänglich auf ihre Geeignetheit überprüfbar, da sich deren Handeln nach dem jeweiligen Gesetz bestimmt. Der Gesetzgeber hingegen muss eine Prognose beim Erlass eines Gesetzes abgeben und zukünftige Entwicklungen einschätzen, verfügt also über einen Prognose- und Beurteilungsspielraum (Einschätzungsprärogative).[62] Die Geeignetheit wird in diesem Fall erst bei offensichtlich fehlerhaften Einschätzungen abzulehnen sein.[63]
Die Erforderlichkeit bestimmt sich danach, ob die gewählte Maßnahme das mildeste, den Adressaten am wenigsten belastende, aber gleich effektive Mittel darstellt.[64] Entscheidend ist daher, ob die weniger einschneidende Maßnahme auch gleich wirksam wäre. Während dem Gesetzgeber auch hier ein Spielraum zur Verfügung steht, wird der Verwaltung die erforderliche Maßnahme durch das Gesetz vorgegeben.
Im Rahmen der Angemessenheit erfolgt eine Abwägung, ob die geeignete und erforderliche Maßnahme auch im Verhältnis zum verfolgten Zweck steht. Gegenstand der Abwägung sind die individuell geschützten Rechtsgüter auf der einen Seite und die entgegenstehenden öffentlichen Interessen auf der anderen Seite. Schließlich darf das staatliche Handeln nicht die Grenzen der Zumutbarkeit überschreiten.[65]
Zu guter Letzt gibt es aber nicht nur Grenzen, wann der Gesetzgeber tätig werden darf, sondern auch Verpflichtungen des Gesetzgebers zum Einschreiten. Dies besagt das Untermaßverbot. Als Gegenstück zum Übermaßverbot findet es jedoch überwiegend bei Schutzpflichten des Staates gegenüber dem Bürger Anwendung. Demnach hat der Staat einzugreifen, um einen Mindeststandard an Schutz des Bürgers zu gewährleisten.[66]