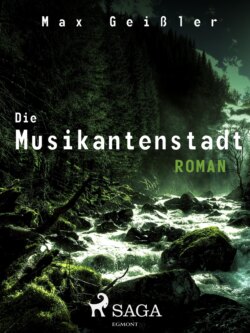Читать книгу Die Musikantenstadt - Max Geißler - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
15.
ОглавлениеEin Jahr darnach war ein neuer Pfad durch den Bergwald gebrochen, waren Schluchten überbrückt, waren Stufen in die Felsen geschlagen; es war ein Weg vom Walddorfe nach den drei Brunnen gebahnt worden, und jene Stelle, an der einst die Köhlerhütte zwei Kindern Unterschlupf gewährte, die sich auf brennenden, ungebahnten Steigen die Füsse wund gelaufen hatten, war nun vom Dorf aus in wenig mehr als einer Stunde zu erreichen.
Aber die goldene Schale, in die damals der silberne Strahl des Brunnens klang, war zertrümmert. Felsen waren gebrochen, der Hochwald war gefällt, graue Halden brüchigen Gesteins erhoben sich und wuchsen, wo vordem rauschender Forst gegrünt hatte. Die Förderkarren rollten auf Schienen; das Schichtglöcklein schlug, und Bergleute fuhren an und aus und sprengten in den Tiefen der Erde die silbernen Wände, zu denen ein Hütejunge das Tor gefunden, und von denen er in der Einsamkeit seines Bergfriedens geträumt hatte.
Des Nachts wandelten Lichter auf dem neuen Waldsteige und überschritten die Brücken der Schluchten; das waren die Blenden der Bergleute, die aus dem Walddorfe zur Arbeit in den Drei-Brunnenschacht hinabstiegen, oder die nach beendeter Schicht heimkehrten. Hunderte von fremden Arbeitern hatte die Botschaft von dem Funde des kleinen Propheten ins Walddorf gelockt; hunderte von Familien waren mit ihrem armen Hausrat in das Gebirgsdorf gezogen, das sie bis dahin nicht einmal dem Namen nach gekannt hatten.
Die Jahre wandelten.
Haus an Haus erstand im Talgrund, durch den längst wieder das stark gewordene Wildwasser um die Blöcke schäumte. Aber der Wald auf der Talsohle, der noch da und dort um die Dächer der Hütten gerauscht hatte, war gefallen. Strassenzüge von kleinen, armen Häusern, deren Schindeldächer nun schon wieder grau wurden und mit dem weichen Grün des Mooses sich überwoben, zeigte das Tal. Nur die alten Hütten der Waldleute von einst zerbrachen noch manchmal das Regelmass der Häuserreihen. Dicht und niedrig standen die Dächer beieinander, und schmal waren die Wege; denn es war kein Raum im Talgrund für ein Gärtlein am Haus und war kein Raum für einen Streifen Grün. Immer mehr Dächer erhoben sich; lauter kleine, verkümmerte Häuser mit engen Höfen dahinter, in die kaum ein Licht der Sonne sich wagte.
Bleiche, arme Kinder liefen zwischen den Häusern oder spielten im Sande. Aber wenn der Sommer kam und die Beeren reiften, wenn zur Herbstzeit im Bergwalde die Schwämme aufgingen, dann zogen Kinder und Mütter in die Forsten, die Güter der freigebigen Wälder zu sammeln.
Und auch an den Hängen, die den Talkessel umrahmten, sank der Wald; denn auch dort wuchsen die Mauern der kleinen Häuser.
Bei den drei Brunnen wurden neue Schächte und Stollen gebrochen; immer höher hoben sich die Halden des zutage geförderten Gesteins, und an den zuerst aufgeworfenen blühte nun schon wieder die harte Schlehe, wuchsen die Wildrosen und der blauäugige Natterkopf.
So wandelten die Jahre.
Die Hausnamen, die den Holzleuten und Schmugglern geläufig gewesen waren, verloren sich. Nur die ‚schwarzen Kreuzleute‘, die ‚Propheten‘ und die ‚Pechschaber‘ waren geblieben. Aber die neuen Leute, die aus allen Winden herzugezogen waren, redeten sie gedankenlos nach und wusste kaum einer, warum sie da seien; denn in den Hunderten der neuerstandenen Häuser erzählte man von dem heimlichen Frieden des einstigen Walddorfes als von einem Märchen. Die Erlebnisse auf dem Schmuggelpfade und auf der Wildbahn berichtete man wohl noch, aber viele der Leute, die damals dabei gewesen waren, kannte fast niemand mehr, weil sie gestorben oder fortgegangen waren in eine andere grüne Einsamkeit.
Nur die drei Hütten, die noch die Namen der vorigen Zeit trugen, schickten keinen mit der Blende und Spitzhacke zur Arbeit unter Tag. Die schwarze Kreuzfrau trug ihre behäbige Fülle und ihr schwarzes Täschlein noch immer keuchend von Haus zu Haus. Weil ihr Scheitel nun ganz silbern geworden war, dachte sie an einen Feierabend nach ihrem langen Wirken. Das war gegen das Ende hin hart und mühselig geworden. Der schwarze Kreuzmann aber spällte noch immer sein feines trockenes Holz zu Schachteln und versah mit beschaulicher Bedachtsamkeit sein kaum fühlbares Amt als Vorsteher der Waldgemeinde. Der Pechschaber und die beiden Propheten (der ‚kleine‘, der den Erzfund getan hatte, war nun auch schon ein Mann geworden) schleissten Schindeln für die zahlreichen Dächer und deckten diese ein. Der Wildschütz Veit war einmal lange mit verbundener Hand umhergegangen; sie sagten, eine Kugel des Hegers habe ihm die Hand zerschlagen. Er hatte einen steifen Finger behalten, war ein Bergmann geworden und legte Schlingen, wenn es anging. Aber die Arbeit im Berg und die scharfsichtigen Steiger litten kein Umherstreifen auf der Wildfährte. Da nahm er seine Sehnsucht nach dem rauschenden Wald und der gefahrvollen Freiheit der vorigen Zeit mit in den Stollen zum Erzgraben und ward ein bleicher, vermühter Mann wie die anderen alle. Die Pechschaberin hatte im Haus am Stein einen Kramladen aufgetan, denn der Weg nach dem Schachte führte die Bergleute dort vorüber. Seit jener Zeit hatte das Haus am Stein ein neues Schindeldach und einen feinen Kalkbewurf an den Wänden.
Wie die vier Pechschaberleute des Abends einmal beieinander sassen und der Rauch der vielen Schornsteine das Tal erfüllte, da stand der Mann, der einst landfahrend gewesen war, von der Holzbank auf und schaute über das Seine.
„Annemirl,“ sagte er, „das ist nun übrig geblieben von der lustigen vorigen Zeit!“
Da machten sie alle verwunderte Augen; denn es war ein zweideutig Wort, das sie vernommen hatten. Aber nur die Frau hatte es verstanden und dachte, es solle wohl heissen: „Besser ist’s geworden als vordem, aber schöner nicht.“
Dann nahm der Pechschaberbub, der er trotz seiner achtzehn Jahre immer noch geblieben war, die Geige wieder auf und spielte eine wunderliche Weise, wie sie ihm sein Herz hiess: die war wild und träumerisch, die war tosend wie ein Bergwasser und war wie silberner Fall klingenden Mondscheins. Die ging durch das Dorf und war flehende Bitte; die flog über die Dächer und schlug ihren Flug wie ein Adler durch die abendgoldene Luft.
Da wurden die Kinder vor den Türen stille: „Horch, der Girgl vom Stein spielt die Geige!“
Das war die Geige mit dem weichen, vollen Ton, die die Annemirl vor zwanzig Jahren in der brüchigen Wachstuchhülle auf dem Rücken in das Walddorf getragen hatte.
Daran dachte der Pechschaber in dieser Stunde und sah die Frau mit einem langen Blick an. Darüber verklang das Lied des Sohnes wie heimliches Leid um fremde Fernen, verklang wie ungestillte Sehnsucht nach der Fülle des Lebens. Und der Pechschaber deutete mit dem Finger auf das Haar der Frau:
„Annemirl, die Zeit flicht dir die Silberzweiglein in die Scheitel! Weisst du noch, wie wir einmal gerechnet haben? Nun sind die einundzwanzig Jahre gleich vorbei, und das Musikantenpärlein hat sich richtig eingestellt.“