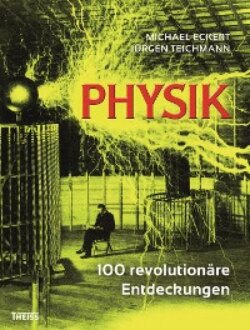Читать книгу Physik - Michael Eckert - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ibn al-Haitham, das islamische Physikgenie
ОглавлениеWir wissen wenig vom Leben dieses universalen Physikers, Astronomen und Mathematikers, obwohl er vielleicht der bedeutendste des Mittelalters ist. Auf jeden Fall übt er wesentlichen Einfluss auf spätere christliche Wissenschaftler aus – insbesondere mit seinen Erkenntnissen zur Optik.
Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haitham (im lateinischen Mittelalter Alhazen) wird in Basra, im heutigen Irak geboren. Hier erwirbt er wohl seine große Gelehrsamkeit. Kurz nach dem Jahr 1000 nach Christus soll er die Fluten des Nil in Ägypten regulieren – durch einen Staudamm. Doch sieht er bald ein, dass dieses Vorhaben zu gewaltig ist, um es realisieren zu können. Trotzdem bleibt er in Kairo als Gelehrter. Mehr als 200 Werke soll er in seinem Leben verfasst haben. Nur 55 haben überlebt. Er erweitert die euklidische Geometrie, den Almagest, die Aristotelische Physik und verschiedene griechische Arbeiten zur Optik. Das Besondere in dieser Zeit: Experimente sind wesentlicher Teil seiner Forschung. Sie sind notwendig, um jede Hypothese zu prüfen. Am meisten Einfluss haben bald seine Studien über Licht und Farbe – in seinem Werk Kitab al-Manazir. Das Buch entsteht zwischen 1011–1021. Die lateinische Übersetzung um 1200 beeinflusst alle großen Wissenschaftler des christlichen Europa, von Roger Bacon über Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Johannes Kepler bis zu René Descartes.
Ibn al-Haitham argumentiert, wie sein ebenfalls berühmter Zeitgenosse, der persische Arzt Ibn Sina (Avicenna), gegen die griechisch-antike Theorie der Sehstrahlen, die vom Auge ausgehen sollen. Er besitzt eine genaue Kenntnis vom Bau des Auges und kennt auch die vergrößernde Wirkung von Linsen. Licht kommt für ihn von Objekten und wird durch unseren Sehsinn erfasst. Nur der von einem Objektpunkt senkrecht in unser Auge fallende Lichtstrahl erzeugt das Bild dieses Punktes. Er entwickelt daraus eine umfassende, von Experimenten getragene Theorie. In einem dunklen Raum etwa sieht man einen Lichtstrahl anhand der Staubteilchen, die Anteile des Lichts in unsere Augen streuen. Er konstruiert eine Camera Obscura – in unserem Verständnis ein Bildprojektor ohne Linsen – um zu studieren, wie leuchtende Gegenstände abgebildet werden. Hier wirkt eine kleine Öffnung in einem größeren Kasten wie eine Glaslinse. Man kann Dinge, die außerhalb des Kastens existieren, an der inneren Wand abgebildet sehen. Er beschreibt die Wirkungsweise dieser Camera genau – zum ersten Mal außerhalb Chinas, wo ihr Prinzip schon lange bekannt ist. Strahlengänge, auch komplizierte, löst er mathematisch, etwa die Aufgabe, den Spiegelungspunkt auf einem sphärischen Spiegel zu finden, in dem der Strahl von einem Objekt genau in den gegebenen Ort des beobachtenden Auges reflektiert wird. Als Mathematiker berechnet er etwa Paraboloide, also Körper, die durch Rotation einer Parabel entstehen, hier sogar um einen beliebigen Durchmesser. Er entdeckt auch die sphärische Aberration in Linsen.
Auch die Dicke der Lufthülle unserer Erde versucht er aus optischen Beobachtungen, der Dauer der Dämmerung, abzuschätzen. Das Licht des Mondes wird eingehend mit einem selbst gebauten Instrument untersucht. Dabei erkennt er auch, dass die Vergrößerung des Mondes in der Nähe des Horizonts eine optische Täuschung ist. Großen Einfluss im gesamten Mittelalter haben auch seine kosmologischen Vorstellungen: Er glaubt an feste existierende Planetensphären über die rein mathematische Behandlung des ptolemäischen Weltbildes hinaus.
JT
Der Aufbau der Augen bei Ibn al-Haitham.