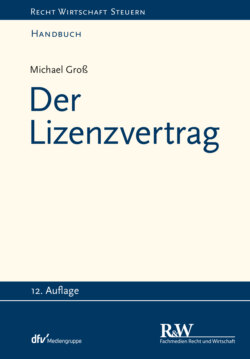Читать книгу Der Lizenzvertrag - Michael Groß - Страница 77
II. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer die Ausübung des Lizenzrechts zu ermöglichen
Оглавление243
Durch den Lizenzvertrag erwirbt der Lizenznehmer ein positives Benutzungsrecht.4 Der Lizenzgeber hat daher alles zu tun, um dem Lizenznehmer die Ausübung seines Rechtes zu ermöglichen. Die Maßnahmen, die er hierzu zu ergreifen hat, können im Einzelfall verschieden sein. Wenn auch in § 35 Abs. 2 PatG bestimmt ist, dass die Erfindung in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, so reichen diese Angaben häufig zur Herstellung des Lizenzgegenstandes in industrieller Fertigung nicht aus. Der Lizenzgeber hat dann dem Lizenznehmer die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und ihm weitere Unterlagen, soweit diese nötig sind, zur Verfügung zu stellen.5
Bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen, sind die Mitteilungen über die Herstellungsmethode und dgl. das Ausschlaggebende.
244
Es empfiehlt sich, hierüber im Lizenzvertrag besondere Vereinbarungen zu treffen. Soweit dies möglich ist, sollte genau bestimmt werden, wieviel Sätze von Zeichnungen und sonstigen Unterlagen (Werkstattzeichnungen, Modelle und dgl.) der Lizenzgeber zur Verfügung zu stellen hat. Häufig sehen die Verträge auch eine ständige technische Beratung durch den Lizenzgeber vor.
245
Vor allem bei Vertragspartnern, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben, muss der Lizenzgeber oft noch weitergehende Pflichten übernehmen, wie z.B. die Unterrichtung von Angestellten des Lizenznehmers im Betrieb des Lizenzgebers, die Anlernung von Arbeitskräften des Lizenznehmers, die Entsendung von Ingenieuren, die den Aufbau und die Überwachung der Produktion beim Lizenznehmer durchzuführen haben, oder die Lieferung einer bestimmten Anzahl von Erzeugnissen aus der eigenen Produktion. Es handelt sich hierbei um Nebenverpflichtungen aus dem Lizenzvertrag.
246
Dabei können diese technischen Nebenleistungen für den Lizenzgeber zu einem nicht unerheblichen Kostenfaktor werden, z.B. wenn die technische Beratung des Lizenznehmers über einen längeren Zeitraum geht und den Einsatz eines oder sogar mehrerer Arbeitnehmer des Lizenzgebers erfordert. Die hierbei entstehenden Kosten gehen zulasten des Lizenznehmers.6 Grundsätzlich empfiehlt es sich allerdings, über die Kostentragung Vereinbarungen zu treffen. Hierbei sollte insbesondere bei der Entsendung von Arbeitnehmern in sog. Niedriglohn-Länder überlegt werden, ob nicht eine Pauschale ggf. günstiger ist, da in diesen Ländern oft kein Verständnis für das Lohnniveau in der Bundesrepublik anzutreffen ist. In einem solchen Falle sollte allerdings auch der Umfang der Nebenleistungen sehr genau festgelegt werden, damit für den Lizenzgeber nicht überraschende Kosten entstehen.
247
Wird neben dem lizenzierten Schutzrecht auch besonderes geheimes Know-how übertragen, kann dafür auch eine besondere Lizenzgebühr verlangt werden.7 In diesem Zusammenhang ist auch auf ein Urteil8 des Bundesgerichtshofes hinzuweisen. Hier ging es darum, dass der Inhaber eines Verfahrenspatentes an einen gewerblichen Abnehmer eine z.T. auch selbst durch Patente geschützte Vorrichtung veräußerte, die zur Ausübung eines geschützten Verfahrens bestimmt war. Hier stellte sich der Bundesgerichtshof auf den Standpunkt, „es würde allerdings dem Sinn des Vertrages widersprechen, wenn der Veräußerer nunmehr dem Erwerber der Vorrichtung deren bestimmungsgemäße Benutzung unter Berufung auf sein Verfahrenspatent verbieten könnte. Nach dem Zweck eines solchen Veräußerungsvertrages ist deshalb regelmäßig anzunehmen, dass der Veräußerer dem Erwerber eine Erlaubnis zur Anwendung des geschützten Verfahrens mit Hilfe der Vorrichtung auch dann erteilt hat, wenn ausdrückliche Vereinbarungen über eine solche Lizenz weder in dem Kaufvertrag noch sonst getroffen worden sind“. Die Bedingungen für die Überlassung des besonderen Know-how überlässt der Bundesgerichtshof den vertraglichen Vereinbarungen der Parteien. Dabei ist es auch möglich, die Überlassung des Know-how vertraglich von einer Lizenzzahlung abhängig zu machen.9
248
Für die rechtliche Beurteilung derartiger Nebenverpflichtungen muss im Einzelfall festgestellt werden, ob sie unselbstständig sind, d.h. der Verwirklichung des hauptsächlichen Vertragszwecks dienen, oder ob es sich um selbstständige Nebenverpflichtungen handelt.10 Handelt es sich um selbstständige Nebenverpflichtungen, so sind diese nicht nach Lizenzrecht zu beurteilen, sondern nach den Grundsätzen des Rechtsgebiets, aus dem diese Verpflichtungen stammen (z.B. Dienstvertragsrecht, Kaufrecht und dgl.).
249
Bei Maschinen ist der Lizenznehmer oftmals nicht in der Lage, bestimmte Teile, vor allem Präzisionsteile, selbst herzustellen. Er muss diese vom Lizenzgeber beziehen. Um die Herstellung des Lizenzgegenstandes beim Lizenznehmer sicherzustellen, ist der Lizenzgeber daher zuweilen gezwungen, bestimmte Lieferpflichten zu übernehmen. Er muss dabei darauf bedacht sein, dass er keine Bindungen eingeht, die er nicht einhalten kann, weil er z.B. aufgrund einer guten Konjunktur den Anforderungen des Lizenznehmers nicht mehr nachkommen kann. Für die Verpflichtung zur Lieferung können bestimmte Kontingente oder ein bestimmter Produktionsanteil vorgesehen werden.11
In Fällen, in denen der Lizenzgeber glaubt, sich nicht in solcher Weise für längere Zeit festlegen zu können, bleibt nur die Möglichkeit, dem Lizenznehmer zuzusagen, dass er ihn bei der Lieferung gegenüber anderen Kunden nicht benachteiligen werde. Für die vom Lizenzgeber im Rahmen des Lizenzvertrags gelieferten Teile erhält der Lizenznehmer meist einen Vorzugspreis in der Weise eingeräumt, dass ihm ein Nachlass auf den Listenpreis des Lizenzgebers gewährt wird. Für Preisänderungen werden zum Teil Fristen festgelegt, während derer die alten Preise noch gelten.
250
In die Verträge ist auch noch aufzunehmen, zu welchen Bedingungen der Lizenzgeber die Teile an den Lizenznehmer liefert. Hierbei ist besondere Sorgfalt auf die Ausgestaltung der Bestimmungen über die Mängelhaftung zu legen. Es kann schwierig sein festzustellen, ob die Mängel, die an der Maschine auftreten, auf Mängeln an den Teilen beruhen, die der Lizenzgeber geliefert hat, oder ob sie auf die Tätigkeit des Lizenznehmers zurückzuführen sind. Darauf hinzuweisen ist, dass Mängelhaftungsansprüche gegenüber dem Lizenzgeber nur der Lizenznehmer geltend machen kann, nicht dagegen der Kunde. Dieser steht gewöhnlich in keiner vertraglichen Beziehung zum Lizenzgeber, es sei denn, dass ausnahmsweise der Lizenzgeber vertragliche Verpflichtungen auch gegenüber dem Kunden übernimmt.12 Es empfiehlt sich, die Lieferbedingungen des Lizenzgebers und die des Lizenznehmers aufeinander abzustimmen, um eine reibungslose Abwicklung insbesondere bei auftretenden Mängelhaftungsansprüchen sicherzustellen.
4 Vgl. Rn. 13. 5 Vgl. Bartenbach, Rn. 1369 ff.; Pietzcker, Anm. 8 zu § 6; Rasch, S. 27; Reimer, PatG, Anm. 46 zu § 9; Benkard, PatG, Rn. 150 f. zu § 15. 6 Bartenbach, Rn. 1445; Pagenberg/Beier, S. 228 ff., 234 ff. 7 Vgl. dazu auch oben Rn. 113, 132. 8 BGH, 24.9.1979, GRUR 1980, 38. 9 Vgl. BGH, 24.9.1979, GRUR 1980, 39; Henn, Rn. 29. 10 Vgl. RG, 14.5.1935, GRUR 1935, 950. 11 Hinsichtlich der Abnahmeverpflichtungen des Lizenznehmers, die das Gegenstück dazu bilden, vgl. Rn. 197. 12 Vgl. Rn. 257 ff.