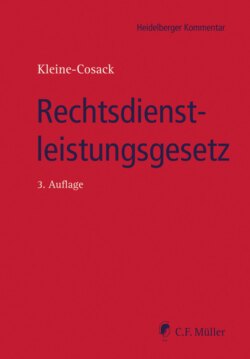Читать книгу Rechtsdienstleistungsgesetz - Michael Kleine-Cosack - Страница 17
III. Allgemeine Ziele des RDG
Оглавление12
Die Ziele des RDG werden in der Gesetzesbegründung[27] wie folgt beschrieben:
„Angesichts dieser Entwicklung schlägt der Gesetzentwurf erstmals eine umfassende Neuregelung des Rechts der außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen vor. Das Rechtsberatungsgesetz soll inhaltlich und, nachdem es aufgrund seiner gesetzestechnischen Struktur (Gesetz mit fünf Ausführungsverordnungen) nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße Gesetzgebung entspricht, auch strukturell grundlegend reformiert werden.
Vor dem geschichtlichen Hintergrund, der das Rechtsberatungsgesetz bis in die Gegenwart belastet hat, soll dabei bewusst keine bloße Gesetzesänderung, sondern eine vollständige Ablösung dieses Gesetzes durch ein neues Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) erfolgen. Titel und Struktur des neuen Gesetzes, die Abkehr vom weiten Begriff der Geschäftsmäßigkeit und die an ihre Stelle tretende Differenzierung zwischen unentgeltlichen und entgeltlichen Rechtsdienstleistungen machen die zu Recht seit langem geforderte grundlegende Abkehr von einem Gesetz deutlich, das ursprünglich auch in dem Bestreben erlassen wurde, jüdische Juristinnen und Juristen aus allen Bereichen des Rechts auszuschließen und die Sozialrechtsberatung allein den Organisationen der NSDAP vorzubehalten . . . Zugleich soll die Neuregelung den verfassungs- und europarechtlichen Vorgaben, der Rechtslage in den europäischen Nachbarländern und den gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre Rechnung tragen.“
13
In Anbetracht dieser Ausgangslage haben sich die Reformvorschläge von der Überlegung leiten lassen,[28] dass der verbraucherschützende Charakter des Gesetzes als Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt – so auch die Gesetzesbegründung[29] – erhalten bleiben soll. Der Rechtsuchende, sei er Verbraucher, sei er Unternehmer, müsse vor den oft weitreichenden Folgen unqualifizierten Rechtsrats geschützt werden. Vor allem die Belange des Verbraucherschutzes, aber auch der Schutz der Rechtspflege und der in ihr tätigen Personen sowie das Rechtsgut Recht als solches rechtfertigten es daher, die Berufs- und Dienstleistungsfreiheit in den Bereichen, in denen Rechtsdienstleistungen erbracht werden, einzuschränken. Aus diesem Grund hätten das BVerfG ebenso wie der EuGH die Vorschriften des RBerG ausdrücklich für vereinbar mit dem Grundgesetz und dem europäischen Recht gehalten, was – dazu unten[30] – nicht ganz zu überzeugen vermag, da die Erforderlichkeit der Regulierung der Rechtsdienstleistungen unter Einschränkung der bis zum RBerG geltenden Gewerbefreiheit niemals sorgfältig geprüft wurde.
14
Eine völlige Deregulierung des Rechtsberatungsmarktes soll es jedenfalls nach dem Willen des RDG-Gesetzgebers auch künftig nicht geben. Sie könnte angeblich – selbst bei gleichzeitiger Statuierung umfassender Informationspflichten der Anbieter juristischer Dienstleistungen – den Verbraucherschutz nicht hinreichend gewährleisten. Die strikte Einhaltung solcher Informationspflichten erscheine kaum praktikabel, geschweige denn überprüfbar; vertragliche Schadensersatzansprüche der Recht suchenden wären erheblich durchsetzungsgefährdet. Denn im Rechtsdienstleistungsbereich bestehe in weiterem Umfang als in anderen Lebensbereichen eine Asymmetrie der Informationen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Der Verbraucher frage die Rechtsdienstleistung eher selten als Gut des täglichen Bedarfs nach und könne daher kaum Konsequenzen aus schlechten Erfahrungen ziehen und den ihm zusagenden Anbieter herausfinden. Diesen Argumenten ist eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen. Sie rechtfertigen aber – dazu unten[31] – kein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, zumal außer Acht gelassen wird, dass letztlich der Verbraucher gezwungen wird, oftmals gegen seinen Willen einen – meist anwaltlichen – Berater einzuschalten, wenn er die die Rechtsdienstleistung nicht selbst erbringt.
15
Im Übrigen – so der Gesetzgeber – entfiele bei einer Abkehr vom Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt die verbraucherschützende Rückabwicklung von Verträgen gemäß § 134 BGB. Auch würden der Rechtsverkehr und betroffene Dritte im Fall einer Freigabe des Rechtsberatungsmarktes überhaupt nicht mehr geschützt. Es solle daher grundsätzlich am Modell des Verbotsgesetzes mit Erlaubnisvorbehalt festgehalten werden.
16
Entscheidend ist jedoch unabhängig von den nicht durchweg überzeugenden Rechtfertigungsversuchen des RDG, dass der Gesetzgeber die Reichweite des Erlaubnisvorbehalts erheblich eingeschränkt hat. Die gilt für das grundsätzliche Bestehen einer Erlaubnispflicht nach den §§ 2, 3 RDG sowie vor allem die Ausweitung der Nebenleistungsbestimmung des § 5 RDG. Auch die Möglichkeit der unentgeltlichen sowie zur verbandlichen Rechtsberatung wurden sichergestellt.