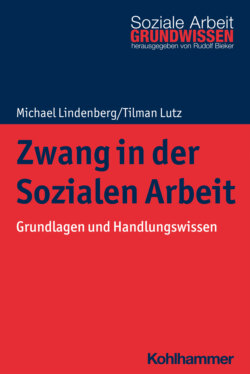Читать книгу Zwang in der Sozialen Arbeit - Michael Lindenberg - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Zwang auf der Mikro-, Meso- und Makroebene mit drei Beispielen
ОглавлениеDiese grundlegende Unterscheidung zwischen weitem und engem Zwang ist für unsere Darlegung tragend und wird unsere Ausführungen als Grundgerüst begleiten. Dazu werden wir immer wieder auf drei Beispiele zurückgreifen, mit denen wir diesen Unterschied verdeutlichen. Um zu zeigen, dass Zwang eine allgegenwärtige Größe in der Sozialen Arbeit ist, haben wir unterschiedliche Beispiele gewählt. Dieser Gedanke der Allgegenwärtigkeit von Zwang ist bedeutsam, denn haben wir schon oft gehört, dass Kolleg*innen es von sich weisen, überhaupt Zwang auszuüben. Daher haben wir als erstes Beispiel den Strafvollzug als unstrittiges Zwangsbeispiel gewählt. Aber auch andere Arbeitsfelder, etwa eine Kindertagesstätte (Kita) oder eine Wohngruppe in der Jugendhilfe, unsere beiden anderen Beispiele, sind davon nicht frei. In all diesen Organisationen finden sowohl weiter als auch enger Zwang in ganz unterschiedlichen Ausprägungen statt. Da es sich um Organisationen handelt, haben alle Beispiele einige gemeinsame Strukturmerkmale, also Handlungen und Abläufe, die immer passieren (müssen).
Soziologisch betrachtet ist jede Organisation eine auf Dauer gestellte Einheit, die ihren Bestand dadurch sichert, dass das in sie eintretende und von ihr beschäftigte Personal auch jederzeit gehen und durch andere Personen ersetzt werden kann. Diese Wechselmöglichkeit des Personals sichert die Kontinuität von Organisationen, anders könnten sie ihre Aufgaben nicht dauerhaft erfüllen. Eine formale Organisation besteht daher aus einer Reihe von Menschen, die zweckmäßig und arbeitsteilig auf klar umrissene Ziele hin handeln. Jede Organisation muss darüber hinaus einen allgemein anerkannten Zweck erfüllen. Der anerkannte Zweck von Organisationen Sozialer Arbeit besteht darin, auf Menschen, Situationen und Bedingungen bzw. Verhältnisse einzuwirken. Das kann sehr viele Formen annehmen. Es kann der Zweck sein, Menschen zu bessern, zu bestrafen und die Allgemeinheit von dem Begehen von Straftaten abzuhalten (Strafvollzug), sie zu erziehen und zu bilden (Kita), sie zu erziehen und zu unterstützen (Wohngruppe der Jugendhilfe). Wir wollen im Folgenden die Eingangsbedingungen in diesen drei Organisationen abbilden und anhand dieser Darlegung die Unterscheidung zwischen engem und weitem Zwang verdeutlichen. Mit der nachfolgenden Grafik ( Abb. 1) wollen wir zudem unseren Ausgangspunkt verdeutlichen, wenn wir über Zwang sprechen: Es sind vor allem die Organisationsbedingungen selbst, die sich auf den engen und weiten Zwang auswirken ( Exkurs 1; Kap. 5.2). Das ist die Makro-Ebene.
Diese Organisationsbedingungen – ihre Strukturmerkmale – haben stets Auswirkungen auf die Mikro-Ebene, auf der das individuelle Handeln in der Interaktion mit Adressat*innen stattfindet, und auf die Meso-Ebene, also der Ebene der Konzeption bzw. der gemeinsam geteilten Handlungsroutinen und -regeln. Umgekehrt haben diese beiden Ebenen wiederum Auswirkungen auf die Makro-Ebene. Das auf diesen drei Ebenen als legitim betrachtete Handeln in der jeweiligen Organisation (»So machen wir das, und so ist es richtig«), wird von den legalen Anforderungen auf der Meta-Ebene umrahmt (»Was wir tun, widerspricht nicht dem Gesetz«).
Abb. 1: Handeln in Organisationen