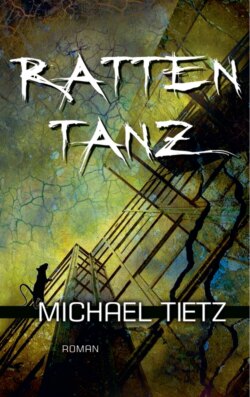Читать книгу Rattentanz - Michael Tietz - Страница 30
25
Оглавление20:40 Uhr, Krankenhaus Donaueschingen, Intensivstation
Das Notstromaggregat im Wirtschaftshof klang bereits seit zwanzig Minuten seltsam. Wie ein Gurgelnder, der sich verschluckt und plötzlich loshüstelt. Das Hüsteln hielt einige Minuten an, ging in ein ordentliches Husten über und verstummte schließlich mit einem abschließenden Seufzer. Das war, als ein unscheinbares Ventil zersprang. Dazwischen peitschte aus der Klinikküche ein Schuss.
Zufall.
Die wenigen Maschinen der Intensivstation, die über einen Akku verfügten, stimmten urplötzlich lautes Wehgeschrei an und piepsten ohne Unterlass in den verschiedensten Tonlagen. Dämmerung flutete im gleichen Moment durch die Fenster und innerhalb von sechs Minuten verstarben die vier frisch Operierten, deren Leben bis zu diesem Augenblick künstlich mittels Beatmungsmaschinen in ihnen gehalten wurde. Das dürfte die Zahl der Leichen, die sich inzwischen im Aufwachraum stapeln, auf vierundzwanzig erhöhen, dachte Eva Seger. Traurig sah sie hinüber zu Aleksandr Glück. Eva hatte seit Stunden Feierabend. Aber die Angst vor dem, was da draußen auf sie warten mochte, hielt sie zurück. Und die Kranken. Aleksandr Glück. Sie spürte den unbändigen Drang nach Bewegung in sich, wollte über die Station hetzen, arbeiten und dabei an nichts denken. Nicht an Hans und Lea, nicht an die Flugzeuge, an den Jungen, der in das Bett gefeuert hatte, in dem sich der Polizist versteckte. Der Polizist hatte Glück gehabt, denn alle drei Projektile verfehlten ihn. Eva hatte gewartet, bis die vier Männer die Station verlassen hatten. Dann holte sie den in Angst erstarrten Joachim Beck aus seinem Versteck.
Beck hatte gekeucht wie ein Erstickender, war aus dem Zimmer mit der Leiche gerannt und am Ende der Station in einem kleinen Lagerraum schluchzend zusammengebrochen. Sie brauchte zehn Minuten, bis sie den Mann so weit beruhigt hatte, dass der bereit war, ihr in den Aufenthaltsraum zu folgen und – dem da noch funktionierenden Notstrom sei Dank – eine Tasse Kaffee zu trinken.
Dr. Stiller blieb fast eine Stunde verschwunden, eine Stunde, in der Eva allein war mit anfangs dreizehn Patienten. Mehmets Ausraster war wohl der Startschuss für einen allgemeinen Aufbruch gewesen: Stefan entschuldigte sich bei Eva und ging. Die junge Ärztin verschwand, ohne sich abzumelden und von den vier Schwestern der Spätschicht kam nicht eine.
Schließlich fand sie Stiller zusammengerollt wie einen Embryo und mit den dünnen, durchscheinenden Händen an beiden Ohren unter einem Patientenbett. Er hatte eingenässt und als sie ihn unter dem Bett hervorholte, starrte er Eva nur mit riesigen Augäpfeln an.
Gollum!
Eva machte weiter, denn die Menschen hier brauchten sie. Sie wusste, sollte auch sie noch die Station verlassen, dann war’s das. Was war wichtiger – ihre Patienten, die wahrscheinlich ohnehin sterben mussten, oder Lea? Lea natürlich, aber die wusste Eva in guten Händen. Nein, nicht nachdenken. Nicht an die Fahrt denken, die noch vor ihr lag, dreißig Kilometer durch Kriegsgebiet, wie es Beck bezeichnet hatte, durch Krieg und Chaos. Die Station gab ihr im Moment noch ein zwar brüchiges, aber doch beruhigendes Sicherheitsgefühl. Hier kannte sie sich aus. Da draußen nicht mehr.
Aleksandr Glück brauchte sie! Er war der einzige Patient, dessen war sie sich bewusst, der hier noch eine reelle Überlebenschance besaß. Mit mieser Zukunftsprognose zwar, aber wenn ihm jemand half, könnte er dieses ganze unverständliche Chaos überleben. Auch deshalb blieb Eva, wegen Glück. Und weil Joachim Beck ihr eindringlich davon abgeraten hatte, vor morgen früh das Haus zu verlassen.
»Warum gehen Sie nicht auch, Schwester?« (Schwästerrr!), fragte Glück.
Eva hatte sich im Flur, wo Glück sie sehen konnte, auf den Boden gesetzt. Sie war blass und müde und traurig. Und allein.
»Gehen Sie doch und retten Sie sich, hier gibt es nicht mehr viel zu tun.« Womit er den Nagel auf den Kopf traf.
Als die Aggregate ausfielen, waren neben Glück noch weitere sieben Patienten auf der Station. Die, die noch beatmet werden mussten, verstarben umgehend, bei den verbleibenden, zwei Frauen und ein Mann, alle heute notoperiert, würde es in ein, höchstens zwei Stunden vorüber sein. Da die lebenswichtigen Medikamente, die, von Maschinen aufs Feinste dosiert, ihren Kreislauf am Laufen hielten, ohne Strom nicht weiter verabreicht werden konnten, hatten sie keine Chance.
»Wissen Sie, Schwester, manchmal muss man auch einmal an sich denken und, auch wenn es schwerfällt, einsehen, wenn es nicht weitergeht.« Eva erhob sich und ging an sein Bett.
»Sie reden wie ein alter Philosoph, wissen Sie das?« Gewohnheitsmäßig strich sie seine Bettdecke glatt. »Wie ein Philosoph, der recht hat«, fügte sie hinzu.
Glück richtete sich auf. »Unter normalen Umständen wäre das Verhalten der anderen, derer, die Sie hier im Stich gelassen haben, verwerflich. Aber, Schwester, die Umstände sind nicht mehr normal. Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, ob unter diesen Umständen jetzt nicht Ihr eigenes Verhalten verwerflich ist, Schwester?«
Eva sah ihn mit einer Mischung aus Zweifel und Belustigung an.
»Doch, doch, Schwester! Ich finde es verwerflich, wenn Sie sich an Ihre Arbeit klammern und dabei sich selbst vergessen. Gehen Sie, gehen Sie heim, zu Ihrer Familie und Ihrem Mann. Wohnen Sie hier in der Stadt? Dann schaffen Sie es noch, bevor die Dunkelheit kommt!«
»Ich lebe in Wellendingen. Selbst wenn die Welt in Ordnung wäre, bräuchte ich über eine halbe Stunde mit dem Auto. Mein Mann ist gestern nach Schweden geflogen. Und meine Kleine ist hoffentlich bei den Nachbarn.«
»Sie haben ein Kind?«
Eva nickte. »Wollen Sie sie sehen?« Sie holte einen winzigen Geldbeutel aus ihrem Kittel. Sie war froh, dass sie immer auf ein paar altertümliche Papierabzüge der digitalen Bilder bestanden hatte. All die Tausend Fotos, die Hans auf einer externen Festplatte und auf DVDs speicherte, waren jetzt unerreichbar. Selbst zu bloßen Erinnerungen geworden, wie die Momente, an die sie eigentlich erinnern sollten.
Eva gab Glück ein Bild von Lea. Ein weiteres Foto zeigte Hans und Lea in einem reifen Getreidefeld. Nur ihre Köpfe schauten aus dem Goldgelb der Ähren heraus und über ihnen strahlte die Sonne. Genau so ein Feld war es, in dem sie und Hans sich vor zehn Jahren zum ersten Mal geliebt hatten. Oder versucht hatten, zu lieben. Sie musste lächeln, was sie damals zum Glück nicht getan hatte. Sie lächelte zärtlich bei der Erinnerung an Hans’ Problemchen damals im Feld.
Es hatte fünf Monate gedauert. Fünf Monate, in denen sie sich heimlich zu Spaziergängen getroffen oder leise miteinander telefoniert hatten. Fünf Monate Sehnsucht, fünf Monate schlechtes Gewissen ihren Partnern gegenüber. Hans hatte einmal zu ihr gesagt, dass sie beide − damals war außer leisen Berührungen noch nichts gewesen − schon ein seltsames Paar wären. Normalerweise würde man doch zuerst übereinander herfallen und sich dann erst Gedanken machen und über eine Zukunft reden. Oder gehen. Aber sie näherten sich einander mit Worten (Eva) und Zuhören (Hans). Und sie schrieben einander seitenlange Briefe.
Bis Hans sie entdeckte, hatte Eva die Ehe mit Martin Kiefer als logische Fortsetzung ihres Elternhauses verstanden. Aus der Ehe ihrer Eltern waren Zuneigung und Respekt, wenn es diese Dinge denn je gegeben hatte, längst verschwunden, sie selbst hatte nie ein Familienleben im Sinne von Liebe und Geborgenheit erlebt. Und so waren die Männer, die sie unter den vielen Bewerbern aussuchte, immer einer ganz bestimmten Kategorie zuzuordnen: kühl, eher einfach in ihren Ansichten und sie waren sehr genügsam im Bett.
Als Hans ihr in einem seiner Briefe geschrieben hatte, dass er ganz genau wisse, dass sie miteinander schlafen würden, hatte ihr Herz angefangen zu rasen. Genau das wollte sie – ihm gehören. Aber sie hätte niemals gewagt, diesen Gedanken zu denken, geschweige denn, ihn auszusprechen. Zu eng saß das Korsett ihrer strengen bürgerlichen Erziehung, zu klar war die Rolle einer Frau in ihr Hirn gebrannt. Als sie Martin geheiratet hatte, war sie froh, ihrem Elternhaus zu entfliehen. Für diese Freude opferte sie die Gelegenheit auf ein eigenes Leben. Sie glaubte damals wirklich, mit Martin vielleicht nicht glücklich, aber wenigstens zufrieden sein zu können. Irgendwann würden Kinder kommen und das kleine Reihenhaus, das sie umbauten, würde eine Familie beherbergen. Aber je mehr Martin von Kindern sprach, desto größer wurde Evas Angst und ihre Unsicherheit. Sie wusste nicht, was es war, aber irgendetwas stimmte nicht mit ihr, mit dem Leben, das sie lebte.
Dass der bloße Gedanke an einen Mann sie erregte, war ihr bis da hin noch nie geschehen. Sex war, wie Martins Sportschau-Samstag auch, ein Etwas, das zu einer Ehe dazu gehörte und genau so lief es dann zwischen ihnen auch ab: Nachdem Martin ihr tagelang vergeblich Avancen gemacht hatte, ließ Eva es schließlich irgendwann über sich ergehen, mit den Gedanken sonst wo, ohne Erregung, ohne Lust. Berührungen und Zärtlichkeiten waren ihr schon immer unangenehm gewesen. Wie sollte eine junge Frau genießen und geben können, was sie als Kind niemals erlebt hatte?
Es war ein warmer Augustnachmittag gewesen damals, als sie sich auf einem abgelegenen Wanderparkplatz getroffen hatten. Genau wie auf dem Foto, aus dem heraus Hans sie jetzt anlächelte. Sie wussten beide, dass es an diesem Tag geschehen würde und sie hatten beide bis zum frühen Abend Zeit.
Eva hatte gewusst, dass die kommenden Stunden ihr Leben völlig verändern würden, dass sie danach niemals wieder ihren Mann an sich heranlassen könnte. Und trotzdem wollte sie Hans, wollte ihn, wie sie noch niemals zuvor etwas gewollt hatte.
Und dann konnte er nicht.
Es ging nicht und das war fast das Schönste, was ihr hatte passieren können, dachte Eva. Denn was stattdessen seine Hände und sein Mund mit ihr taten, hatte ihr fast den Verstand geraubt. Was er ihr schenkte, war reines Glück, war das wirkliche Leben! Geschenke, ganz ohne männliche Gier nach eigener Befriedigung. Ihm war sein Versagen peinlich und er hatte sich geärgert, dass er, wo er doch endlich am Ziel war, nicht konnte.
Eva hatte seine unbeholfene Art, damit umzugehen, amüsiert, sie liebte ihn mehr als alles auf der Welt. Und jetzt war sie endlich auch bereit, dies einzugestehen.
Eva streichelte Hans’ Gesicht auf dem Foto. Ihr Herz klopfte laut, hämmerte, aufgeregt wie bei diesem ersten Mal.
»Aber eigentlich habe ich ja bald zwei Kinder«, sagte Eva und zeigte auf ihren Bauch. Glück hob die Augenbrauen, dann verstand er. Ein breites Lächeln überzog sein Gesicht.
»Das ist gut.« Er streckte die Hand nach ihr aus. »Darf ich?«
»Ich bin erst im dritten Monat, noch ganz am Anfang. Sie können noch nichts spüren.«
Trotzdem nahm sie seine dünne Hand und legte sie sich auf den Unterleib. Aleksandr Glück schloss die Augen. Für einen kurzen Moment war die Welt wieder in Ordnung, war er jung, gesund und voller Kraft und Olga, seine Frau, trug ihren gemeinsamen Sohn in sich. Es war eine kurze, überaus vollkommene Sekunde, die Eva ihm schenkte. Und sie spürte die Ruhe des Alten in sich strömen. Was war wichtig? Am Morgen hätte sie es noch gewusst, da war alles noch klar und geordnet. Es gab Wertigkeiten, die unumstößlich und sicher schienen, in Stein gemeißelt sozusagen. Aber das war lange her, fast schon ein anderes Leben. Eva durfte sich nicht fallen lassen, sie musste stark sein, stark für Aleksandr Glück, für Lea und Hans – und für das Ungeborene. Aber was war das Wichtigste? Sie selbst? Lea? Glück?
»Sie müssen auf sich aufpassen«, sagte Glück, streichelte ein letztes Mal ihren Bauch, dann zog er die Hand unter die Bettdecke zurück. Hatte er ihre Gedanken erraten? »Nur wenn Sie gesund bleiben, wird es auch das Baby sein. Nur wenn Sie Kraft haben, können Sie morgen zu Ihrer Kleinen fahren.«
»Morgen? Wird morgen alles wieder gut sein?« Sie hoffte, dass der alte Mann ihr sagen konnte, dass die Welt sich am nächsten Morgen wieder in den gewohnten Bahnen bewegen würde. Dass alles nur ein böser, böser Traum war.
»Vielleicht. Wahrscheinlich aber eher nicht.«
»Der Polizist hat erzählt, dass die meisten Straßen blockiert sind und dass in der Stadt geplündert wird. Wie soll ich da, als einzelne Frau, die dreißig Kilometer bis Wellendingen schaffen?«
Aleksandr Glück musterte sie und sagte dann: »Gehen Sie nicht davon aus, dass in ein, zwei Tagen alles wieder beim Alten sein wird. Vergessen Sie diese Illusion, dazu sind die Veränderungen viel zu einschneidend und viel zu umfassend. Wegen mir müssen Sie nicht gehen, ich freue mich, wenn Sie mir noch ein wenig Gesellschaft leisten. Wahrscheinlich wird nie wieder eine so schöne junge Frau auf meiner Bettkante sitzen«, sie lachte und verdrehte die Augen. »Doch machen Sie sich langsam Gedanken, Schwester, was werden soll, wenn keiner kommt und alles wieder wie früher macht. Überlegen Sie sich das.«
Sie betrachtete ernst den alten Mann. Er wirkte gefasst und weise, ruhig. War dies der Zustand, den man Alter nennt? Oder war es ein Zustand, den ein Mensch erst dann erreicht, wenn sein Tod unmittelbar bevorsteht, er dies weiß und er dies akzeptiert? Glück wirkte so klug und wissend als könnten seine Augen etwas anderes sehen, als könne er mehr sehen als sie selbst, die noch viel zu sehr dem Leben verhaftet war.
»Sind Sie jetzt eigentlich ganz allein hier, Schwester? Wo ist dieser Polizist und wo der kleine Doktor?«
»Dem Polizisten habe ich eine Hose und den Pullover eines …«, sie zögerte verlegen.
»Eines Toten«, ergänzte Glück.
»… gegeben. Er wollte in die Stadt, in seine Wohnung.«
»Schade.« Glück wirkte nachdenklich. »Mit ihm hätten Sie sich vielleicht irgendwie durchschlagen können.«
»Und Dr. Stiller liegt in seinem Büro und schläft und ist morgen früh hoffentlich wieder einigermaßen erträglich!«
Nachdem sie Stiller unter dem Bett hervorgeholt hatte, musste Eva ihm ein starkes Beruhigungsmittel geben. Der Arzt war nur noch ein Schatten, zitterte und redete ununterbrochen von Ritter und Mehmet und den Schüssen. Sie hatte ihm eine Decke auf den Boden gelegt, ihn zugedeckt und ihm, wie einem kleinen Kind, versprechen müssen, die Tür offen zu lassen und nach ihm zu sehen. Das war irgendwann gegen fünf, seitdem schlief Stiller und Eva war mit den Kranken allein.
»Was wird aus Ihrer Frau?«, fragte Eva.
Olga Glück hatte auch heute ihren Mann besucht, kurz nachdem Ritter und sein Gefolge mit viel Lärm die Station verlassen hatten. Er konnte sie beruhigen und hatte ihre weiche, volle Hand lange gehalten. Dann hatte sie, ungeachtet all des Sterbens um sie herum, ihr allgegenwärtiges Strickzeug aus der Handtasche genommen und an einem Socken weitergearbeitet. Sie hatten sich leise unterhalten, sie auf Russisch, der Sprache ihrer Kindheit, und er in seinem knarrenden Deutsch. Er bestand darauf, Deutsch zu reden, es sei eine Frage des Anstandes, schließlich lebten sie ja nun endlich im Land seiner Urgroßväter. Aber ihr war das egal, denn nur in ihrer Muttersprache konnte sie ihm alles erzählen, konnte plappern ohne lange nachzudenken, fühlte sie sich wohl. Deutsch blieb ihr immer fremd und, wenn es sich einmal nicht vermeiden ließ oder Glück mit Nachdruck darauf bestand, kamen die Sätze nur unvollständig und langsam über ihre Lippen und sagten selten das, wozu sie gedacht waren. So hatten beide auch heute zusammengesessen – eine abgeschiedene, einsame Insel der Glückseligen.
Dann beantwortete Glück Evas Frage. »Wenn ich endlich gestorben bin, wird meine Frau Tabletten nehmen.« Eva sah auf. Glück nahm ihre Hand. »Wir haben das schon vor Jahren so entschieden, Schwester und damals war ich noch gesund. Olga und ich, wir lieben uns seit fünfundfünfzig Jahren.« Seine Augen leuchteten, als er weitersprach. »Sie war sechzehn bei unserer ersten Begegnung und ich siebzehn.«
Glück begann, Eva von seiner Kindheit in Moskau zu erzählen, von der riesigen Wohnung, mit Wänden und Fenstern so hoch, dass sie ihn immer mehr an eine Kirche denn Wohnung mahnten, und von seinem Vater, der als Wissenschaftler gearbeitet hatte. Als Hitler seine Kolonnen gen Moskau in Gang setzte, um Bolschewismus und Judentum auszurotten, war es von einem Tag auf den anderen vorbei mit Wohlstand und dem unbeschwerten Leben Aleksandrs. Man unterstellte den Deutschstämmigen, dass sie dem Angreifer näher stünden als dem Land, in dem sie geboren waren und lebten. Glück und seine Eltern wurden in ein sibirisches Lager deportiert und erst nach dem Ende des Großen Vaterländischen Krieges 1945 erlaubte man ihnen unter strengen Auflagen, sich in einem kleinen sibirischen Dorf anzusiedeln. Glücks Vater durfte in einer Kolchose Schweine hüten, seine Mutter häkelte kleine Decken und Vorhänge, die eine Nachbarin einmal im Monat mit auf den Markt in die Stadt nahm und dort für sie verkaufte, denn eine der Auflagen für die Beendigung der Lagerhaft war, dass sie die engen Grenzen des Dorfes und seiner morastigen Wiesen und Wälder nicht verlassen durften. Da sei er aufgewachsen, erzählte Glück und trank einen Schluck Mineralwasser.
»Es war nicht leicht, Schwester, besonders nicht für meinen Vater. Er starb auch früh, vielleicht weil er nicht verwinden konnte, dass er Schweine zusammentreiben musste statt neue Formeln zu entwickeln. Aber ich hatte trotzdem eine schöne Kindheit, weil meine Eltern mich liebten. Und weil sie sich liebten, so wie Olga und ich.« Eva erhob sich.
»Oh, Sie haben zu tun und ich halte Sie auf mit meinem Geschwätz!«
»Nein, nein, ich wollte mir nur einen Stuhl holen.«
Der Patient im Nachbarzimmer war inzwischen verstorben. Eva ahnte es, aber sie wollte nicht mehr zu ihm, wollte nicht noch einem Menschen ein Tuch über das Gesicht legen müssen.
»Bitte, erzählen Sie weiter! Es tut gut, Ihnen zuzuhören.«
»Und ich langweile Sie wirklich nicht?«
»Nein. Im Gegenteil.«
»Und wo war ich stehen geblieben?«
»Sie wollten erklären, was es mit den Tabletten auf sich hat«, sagte Eva.
»Ja richtig! Und ich erzähle von Sibirien!« Glück spielte den Entrüsteten und kratzte sich am Kopf. »Verzeihen Sie einem alten Mann, Schwester?« Eva nickte.
»Olga und ich, wir sind inzwischen schon so lang beieinander, dass wir uns schon lange kein Leben mehr ohne den anderen vorstellen können. Sie ist mein Leben, wissen Sie, und ich bin ihres. Wir würden ohne den anderen eingehen und vor Kummer dahinsiechen. Wir wa ren noch so jung damals, als wir heirateten, sie achtzehn, ich ein Jahr älter. Fünfundfünfzig Jahre sind eine sehr lange Zeit, mehr als viele Men schen leben, und in all den Jahren haben wir uns nie gestritten, fiel nie ein böses Wort. Deshalb haben wir einen kleinen Vorrat an Schlaftabletten gesammelt und uns versprochen, dass der, der das Pech hat übrig zu bleiben, nicht lang allein bleiben wird. Mein Leben hätte ohne sie keinen Sinn, Schwester. Ich würde nur anderen, fremden Menschen zur Last fallen und keiner wäre da, der nach mir sieht. Das wäre kein Leben mehr. Olga denkt genauso. Wir sind unser Leben und an dem Tag, an dem kein Wir mehr existiert, wird leben zum Warten auf den Tod. Warum dann also nicht selbst ein wenig Schicksal spielen?«
Glück legte eine Denkpause ein und stützte den Kopf in die hohle Hand. Er sah aus wie ein alternder griechischer Dichter. Sie saßen eine Weile da ohne zu reden.
»Haben Sie keine Kinder?«, fragte Eva schließlich.
Glück zögerte, dann antwortete er: »Wir haben zwei Söhne.«
»Sie sind nicht hier?«, fragte Eva.
»Nein.« Er schüttelte den Kopf. »Nein, Nikolaj und Wanja sind schon vorausgegangen«, erklärte er.
»Wohin voraus?«, fragte Eva, obwohl sie die Antwort ahnte.
»Dahin, wo ich sie endlich bald wieder in die Arme schließen kann«, antwortete Glück und lächelte.
»Wie …«
»Nein«, lachte er, »jetzt ist es genug! Ich rede und rede und dabei wird es schon dunkel und Sie haben noch nichts zu Abend gegessen!« schimpfte er und drohte mit einem ausgemergelten Zeigefinger.
»Ich habe keinen Hunger.« Ihre Antwort klang halbherzig.
»Sie müssen aber etwas essen, Schwester! Wenn schon nicht für sich, dann wenigstens für Ihr Kleines.« Er sah sie an und streckte die Hand nach ihr aus. Eva ergriff sie.
In diesem einen Moment, als ob die Berührung eine Tür in ihr aufgestoßen hätte, begann sie zu weinen. Zuerst waren es nur einzelne Tränen, die ihr über die Wangen rollten, aber bald begann sie zu schniefen und schluchzte und als Glück sich zu ihr nach vorn beugte und sie mit vor Schmerzen verzerrtem Gesicht in die Arme nahm, brachen sich die Ängste und Anspannungen dieses Tages Bahn und sie begann hemmungslos zu weinen.
»Wein nur, Schwesterchen. Weine.«
Sie hatte sich den Tag über mit Arbeit betäubt und seit dem Stromausfall nichts gegessen und nur wenig getrunken. Sich dafür aber mehrmals übergeben. Um sie herum waren zwei Dutzend Menschen gestorben, inzwischen vielleicht schon mehr, und nur Gott allein wusste, wie es in der Stadt draußen aussah, wie in der Welt. Wie bei Lea und Hans. Sie war Stunde um Stunde von einem Patienten zum nächsten gerannt, als alle anderen längst gegangen waren und Stiller war mehr Belastung dabei denn Hilfe.
War dieser Tag die Wirklichkeit? Sie schluchzte, als sie wieder an Ritter und Mehmet dachte und wie dieser auf die Leiche nebenan geschossen hatte. War das die neue Realität? War dieser Tag so wirklich wie das Gestern, mit seinen Abendnachrichten und blühenden Wiesen und dem Telefonat mit Hans? War dies das neue Leben, waren Ritter und Mehmet, der trockene Wasserhahn und die blinden Lampen das Morgen und Übermorgen? Eva hatte so abgrundtiefe Angst, fühlte sich verlassen und einsam und wünschte, Hans wäre bei ihr und könnte sie trösten! Nein, sie wollte nicht, dass dies alles wahr sei, dass sie mit Glück hier saß, während sich ringsum die Leichen stapelten. Dies alles durfte einfach nicht wirklich sein und deshalb war sie weitergerannt, immer weiter über die Station geeilt, für alles verantwort lich, allein verantwortlich – nur, um nicht anhalten und nachdenken zu müssen. Sie wollte nicht sehen − aber jetzt, mit geschlossenen, nassen Augen, jetzt begann sie zu sehen. Und was sie sah, machte ihr unsagbare Angst!
»Bleiben Sie heute Nacht hier. Hier sind Sie sicher.«
Aleksandr Glück schlug Eva ein gemeinsames Abendessen vor.
»Kommen Sie, tun Sie einem alten Mann den Gefallen, Schwester. Es ist vielleicht mein letztes Abendessen und«, er verzog das Gesicht, »bisher habt ihr mir ja immer nur Suppe und Brei gegeben.«
»Ich weiß nicht, ob ich etwas finde. Vielleicht ist ja gar niemand mehr in der Küche.«
»Sie werden uns schon was Feines mitbringen.« Glück war zuversichtlich.
»Also gut.« Eva erhob sich. Sie warf das tränendurchnässte Stück Zellstoff in den Mülleimer. »Was wünschen Sie sich? Worauf haben Sie Appetit?«
»Weißbrot!«, kam es prompt. »Und einen kräftigen Camembert, wenn Sie welchen finden. Wissen Sie, der ist schön weich. Und dazu würde am besten ein Glas Rotwein passen. Haben die hier so was?«
Eva nickte.
»Ich kann Sie wirklich allein lassen?«
»Natürlich, Schwester. Außer dem kleinen Doktor ist doch keiner mehr da, der mir etwas tun könnte, oder?« Das stimmte.
Stiller schlief noch immer, friedlich wie ein kleines Kind, auf dem Boden in seinem Büro. Sonst gab es keinen Lebenden mehr auf der Station. Nachdem sich auch noch das Notstromaggregat der allgemeinen Arbeitsverweigerung angeschlossen hatte, waren alle innerhalb kürzester Zeit verstorben. Wie Eva es vorausgesehen hatte. Dennoch war sie zu jedem Einzelnen ans Bett gegangen, hatte den Beatmeten die Schläuche aus dem Mund gezogen und allen die Hände gefaltet. Sie tat es für sich. Und sie öffnete die Fenster einen kleinen Spalt. Sie hatte vor Jahren einmal über eine alte Frau gelesen, die, nachdem ihr Mann für immer eingeschlafen war, das Fenster öffnete, damit die Seele hinausschweben und aufsteigen konnte. Sie hatte die Geschichte nie wieder vergessen und öffnete seitdem immer das Fenster ein wenig und hoffte, dass die Seelen ihren Weg fanden.
Eva bewaffnete sich mit einer Taschenlampe. Am Eingang zur Station kam sie am Aufwachraum vorbei, in dem zwölf Betten mit Verstorbenen standen. In manchen Betten lagen zwei oder drei Tote, zum Teil noch notoperiert, und einige lagen am Boden. Sie kam durch den Wartebereich der Etage und bog, an den Aufzügen vorbei, ins Treppenhaus ab. Gespenstische Stille herrschte in den Fluren, die meisten Türen standen offen und nur in einer Handvoll Zimmer warteten noch Patienten still darauf, dass man sie endlich hole.
Das Leben ging manchmal seltsame Wege, überlegte Eva. Wie schnell alles doch zusammengebrochen war, wie schnell das in Jahrtausenden mühsam geschnürte Korsett, welches sich Zivilisation nannte, aus allen Nähten platzen konnte. Sie dachte an die Bilder vom Balkankrieg, auf denen sich Ende des zwanzigsten Jahrhunderts Menschen, die Jahrzehnte friedlich neben- und miteinander gelebt hatten, abschlachteten wie Tiere. Und das im Herzen Europas, nicht etwa im Irak oder im Kongo. Es wäre damals, bei den Bildern vom Krieg im auseinanderfallenden Jugoslawien, wohl kaum jemandem in den Sinn gekommen, dass das, was sich Zivilisation nannte, auch in Deutschland wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen könnte, sollte erst einmal eine der untersten Karten herausgezogen werden. Bisher waren es immer Kriege, die alles wegbrechen ließen. Zuerst ein Konflikt, dann Krieg, dann Anarchie und Elend und Einsamkeit. Was aber folgt, wenn das Wegbrechen zuerst kommt?
Eva schauderte.
Sie war inzwischen an der weit offen stehenden Tür zum Speiseraum angekommen. Bis auf das schwache Licht, das die soeben untergehende Sonne zwischen den Bäumen hindurchschickte, war es dunkel. Auf einem Tisch standen einige Schüsseln und Teller und Besteck. Weiße Porzellanscherben zerschlagener Teller lagen herum. Eva durchquerte den weiten Raum und ging an der langen Theke der Speisenausgabe und der alten Registrierkasse vorbei zu einer Tür. Hinter dieser Tür lag ein Flur, der Küche und Speisesaal miteinander verband. In dem fensterlosen Gang herrschte vollkommene Stille. Alles schien verlassen. Im schmalen Lichtkegel der kleinen Taschenlampe, die eigentlich dazu diente, die Pupillenreaktion Hirnverletzter zu prüfen, sah sie, dass fast alle Türen, die vom Flur abgingen, offen standen. Es gab hier mehrere sogenannte Seminarräume mit jeweils einem Dutzend Computer, an denen die Mitarbeiter der Klinik geschult wurden. Alle Monitore und Computer waren verschwunden, ein letzter zerschlagener Bildschirm lag am Boden. Auch die Schiebetür in die Großküche stand weit offen. Betreten nur in Schutzkleidung gestattet! , mahnte seit Kurzem ein Schild. Sie folgte dem Schein der Lampe, kam an einem kleinen Raum vorbei, in dem sauberes Geschirr lagerte, dann stand sie an einem Förderband. Über das Band rollten dreimal täglich die Tabletts für die Patienten vorbei und wurden von Arbeiterinnen mit dem Gewünschten bestückt.
Auch hier erschien ihr alles ruhig.
Vielleicht hatte der Polizist ja doch übertrieben, überlegte Eva. Vielleicht gab es doch eine Chance, noch in dieser Nacht nach Hause zurückzukehren. Er hatte sicher übertrieben, als er von Mord und Plünderungen erzählte. Und was auf der Station geschehen war, war nur ein dummer Zufall.
Durch die Küchenfenster fiel warmes Abendlicht. Sie wollte gerade die Taschenlampe ausknipsen, als sie ein Geräusch stutzen ließ. Ein Klirren, wie wenn Glas gegen Glas schlägt. Sie blieb stehen und lauschte. Die beiden Herdreihen, mit riesigen Töpfen am Rand und ebenso überdimensionierten Kellen darüber, warteten auf den kommenden Tag. Gulliver im Land der Riesen, dachte sie mit einem Blick auf Töpfe, Pfannen und Kellen. Sie ging um den ersten Herd herum, folgte dem Geräusch. Offenbar kam es aus dem winzigen Aufenthaltsraum am Ende der Küche.
Plötzlich stolperte sie. Sie verlor das Gleichgewicht und die Taschenlampe aus der Hand, und landete in einem kalten Brei aus rosafarbener Creme und dunkelroten, jetzt in der Dämmerung fast schwarzen Schlieren. Ihre Lampe rollte unter den Herd. Dort blieb sie so liegen, dass sie das starre Gesicht des Chefkoches beleuchtete. Eva erkannte den Mann sofort, ihn, der immer etwas früher als seine Mitarbeiter kam und meist auch länger blieb und der, auch im größten Stress um die Mittagszeit, immer Zeit für einen Scherz mit den Schwestern fand und fragte, wie ihnen sein Essen schmecke.;
Genau dieser Chefkoch lag tot neben ihr und als Eva sich abstützte um aufzustehen, hielt sie plötzlich ein Ohr in der Hand. Sie warf es zur Seite als sei es glühend heiß und schrie, schrie, wie sie noch nie in ihrem Leben geschrien hatte. Der bis unter die Decke geflieste hohe Raum verstärkte ihre Schreie wie ein riesiges Megafon und warf sie hundertfach zurück. Er wollte ihre Schreie nicht. Unfähig, sich zu bewegen und erschrocken von der Intensität ihrer eigenen Stimme, stand Eva neben dem Koch und starrte auf die Leiche. Überall war sie mit Erdbeercreme und geronnenem Blut beschmiert.
In diesem Moment wurde die Tür des kleinen Aufenthaltsraumes aufgerissen. Eva hob den Blick und sah Mehmet in die Augen. Mehmet erkannte sie sofort und brüllte: »Es ist die Schlampe von der Intensivstation!« Er suchte seine Pistole und, als er sie nicht fand, riss er Fuchs die Maschinenpistole aus der Hand und schoss eine Salve auf die Schwester. Er hatte aus der Hüfte heraus zu hoch gezielt und die meisten Geschosse prallten an den Gerätschaften über dem Herd ab und versetzten die Kellen und Löffel in Schwingung. Sie stießen gegeneinander und stimmten einen misstönigen Trauermarsch an. Ein Projektil zerriss eine der Neonröhren, die förmlich explodierte, und drei weitere Kugeln schlugen in die gegenüberliegende Wand, die daraufhin einige der weißen Kacheln fallen ließ.
Eva duckte sich hinter dem Herd als sie Ritters Stimme hörte.
»Spinnst du, wir brauchen sie lebend, du Idiot!« Er riss Mehmet die MP weg und stieß ihn aus dem kleinen Raum.
»Los, fangt sie!«
Dass er nicht schon früher draufgekommen war, ärgerte er sich. Wo sonst, wenn nicht auf einer Intensivstation, würde es Schmerzmittel geben!
Mehmet durchquerte mit einigen kräftigen Sprüngen die wenigen Meter bis zum Herd. Eva schüttelte ihre Überraschung und das Entsetzen endlich ab, rannte zum Ausgang, während Mehmet über die Arbeitsfläche der Küche setzte. Er kam genau in der von ihm auf dem Boden verursachten Schweinerei an, rutschte aus und landete weich auf dem Koch.
»Idiot!«, zischte Fuchs, der mit wehendem Mantel an ihm vorbeirannte.
Eva eilte durch den dunklen Gang, nahm die Abkürzung an den Aufzügen vorbei ins Treppenhaus. Sie sah nicht mehr zurück. Mit wenigen Schritten rannte sie zwei Etagen empor und an einem Mann im Bademantel vorbei, der rauchend im Wartebereich stand und die Asche seiner Zigarette genüsslich auf den Boden streute.
»Schwester, mein Urinbeutel ist voll!«, rief er ihr mit erhobenem Arm hinterher.
Eva rannte den fast dreißig Meter langen Flur zu ihrer Station, riss die erste der Türen auf und stand vor dem Eingang zum Aufwachraum. Aufwachraum, dachte sie, Einschlafraum wäre treffender! Sie sah sich um. Sie musste diese Tür irgendwie verriegeln, musste die drei Verrückten daran hindern, hier einzudringen! Die Tür öffnete nach innen. Wenn sie nur irgendetwas so davorlegen könnte … Ihr Blick fiel auf die Betten mit den Toten. Ohne langes Überlegen schnappte sie das erstbeste Krankenbett und rollte es quer vor die Flügeltür. Dann arretierte sie die Bremsen.
Aber wenn sie die Scheiben einschlagen, kann einer von ihnen hereinklettern.
Sie rannte zurück in den Aufwachraum und sah sich um. Aber die Regale und Schränke, die als Barrikade infrage kämen, waren fest eingebaut. Einige Stühle und Hocker standen herum, sonst nichts.
Fast nichts!
Ohne weiter nachzudenken bückte sie sich und packte die Leiche einer alten Frau an den Armen. Die Frau war schwerer als Eva vermutet hatte. Sie war schon fast kalt und als Eva sie auf die Bettbarrikade stemmte, schlugen ihre Arme wie Pendel gegen Evas Beine. Aber Eva wusste, dass dies ihre einzige Chance war. Sie musste sich verbarrikadieren, quasi mit Leichen einmauern, um die Verrückten fernzuhalten. Sie musste das Kind retten, sich retten. Hans weiß doch noch gar nichts von dem Baby!
Ihr war schwindelig – vor Hunger, vor Anstrengung, wegen des Kindes in ihr. Aber sie ging zurück und zerrte einen Mann mit offener Operationswunde aus seinem Bett und über den glatten Boden zur Tür. Leiche um Leiche zerrte sie durch den Raum. Weiter und immer noch eine. Evas Arme schmerzten und ihr rann der Schweiß vom Körper und ihr Geruch vermischte sich mit dem Geruch von Erdbeercreme und Tod und Blut.