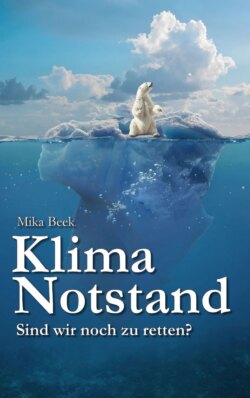Читать книгу Klimanotstand - Mika Beek - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеUrsache Nr. 1: CO 2 -Austoß
Was ist eigentlich CO2? Drei chemische Elemente sind in unserem Bewusstsein verankert: H2O, O2 und CO2. Schon in der Schule lernen wir, dass zwei Wasserstoffatome (Hydrogenium) und ein Sauerstoffatom (Oxygenium) ein Wassermolekül ergeben. H2O ist Wasser und ohne Wasser kein Leben. Die zweite Formel ist O2, also zwei Atome Oxygenium, die zusammen das Molekül Sauerstoff bilden. Das brauchen wir zum Atmen und ohne es gäbe es auch kein Wasser. Die dritte Formel ist CO2. Hier verbinden sich zwei Sauerstoff-Atome (Oxygenium) mit einem Kohlenstoffatom (Carbon). Heraus kommt Kohlenstoffdioxid oder einfach Kohlendioxid. Das brauchen wir nicht zum Atmen, sondern wir produzieren es bei der Atmung. Aber wir brauchen es in bestimmten Mengen trotzdem zum Leben. Zu viel Kohlendioxid ist wiederum giftig.
Bei Kohlendioxid denken viele an rauchende Schornsteine oder den Auspuff eines Autos, manche denken auch an Flugzeuge und Schiffe. Das sind in der Tat die sichtbaren Ausstöße von CO2, wenngleich das, was wir da sehen, eher andere Moleküle sind. In der Schule lernt man, dass die Pflanzen Kohlendioxid brauchen, es in der Photosynthese umwandeln und Sauerstoff abgeben, den die Tiere und Menschen wiederum einatmen und Kohlendioxid wieder ausatmen. Eigentlich ein perfektes Kreislaufsystem, wenn es denn im Gleichgewicht ist.
Doch dieses Gleichgewicht wankt, denn der CO2-Anteil in der Atmosphäre ist zu hoch. Die Referenzstation Manua Loa auf Hawaii hat einen Anteil von 405 ppm (Anteile pro Millionen) im Jahr 2017 gemessen. Das war der höchste Wert seit 800.000 Jahren. Seit der Industrialisierung ist dieser Wert nun um 41% angestiegen. Hier denken wir zu Recht an rauchende Schornsteine und Abgasausstoß.
Ursache Nr. 2: CO 2 -Äquivalente
Doch CO2 ist nicht das einzige Treibhausgas. Durch die Erwärmung der Meere schmelzen die Polkappen. In Grönland schmelzen jährlich 250-300 Milliarden Tonnen Eis und das Tempo hat in den letzten Jahren zugelegt. Am Südpol hingegen wachsen die Eismassen, weil sich vermutlich die Windmuster geändert haben. Trotzdem kommen beide Pole zusammen auf einen Rekord-Eisrückgang. Das macht beim Meeresspiegel nur 0,6 Millimeter mehr aus, aber es geht nicht nur um das Element Wasser an sich, sondern auch um seine Zusammensetzung. Die Ozeane sind unsere größten CO2-Speicher, entsprechend ist auch im Eis CO2 gespeichert. Man schätzt, dass ungefähr 1,8 Billionen Tonnen CO2 im ewigen Eis eingeschlossen sind und man rechnet damit, dass diese "Ewigkeit" schon 2050 zu Ende geht und das Nordpolarmeer im Sommer eisfrei sein wird. Das ist nicht nur für Robben, Eisbären und die in Grönland lebenden Menschen ein Problem, sondern auch für den Rest der Welt.
Diese im Eis gebundene Masse an Kohlendioxid gelangt nicht etwa wieder mit dem Wasser ins Meer, sondern in die Luft und das nicht als Kohlendioxid, sondern als Methan. Im Vergleich zu Kohlendioxid ist Methan vierunddreißigmal so wirkungsvoll bei der Verstärkung des Treibhauseffekts. Kurz zur Erinnerung, was das ist: Die Atmosphäre lässt die Sonnenstrahlen durch, sie erwärmen die Erde und den Ozean, werden aber zu großen Teilen reflektiert, können nun aber nicht mehr im gewohnten Umfang wieder durch die Atmosphäre ins All zurückgeworfen werden. Sie werden also von der Atmosphäre teilweise und zu immer größer werdenden Teilen zurück auf die Erdoberfläche geworfen. Dort erwärmen sie wiederum die Ozeane und die Erde, werden zum Teil wieder reflektiert, um dann erneut reflektiert zu werden. Ohne diesen Effekt wäre auf der Erde kein uns bekanntes Leben möglich, weil die Durchschnittstemperatur bei minus 18°C läge. Bei einer ausgeglichenen Menge der Gase bleibt das Klima beständig, steigt die Konzentration eines oder gar aller Gase jedoch an, steigt die Reflektion. Da der Anteil an Kohlendioxid seit Beginn des 19. Jahrhunderts um 40% gestiegen ist, hat sich auch der sogenannte Treibhauseffekt verstärkt. Wer schon einmal im Hochsommer bei Sonnenschein in einem Treibhaus war, möchte schnell wieder raus. In einem Treibhaus geht das, auf der Erde nicht.
Ein weiteres CO2-Äquivalent ist Lachgas (N2O), das mit sechs bis neun Prozent am Treibhaueffekt beteiligt ist. Die Schwankungen kommen daher, weil Lachgas als flüchtiges Gas "nur" rund 120 Jahre in der Atmosphäre verbleiben kann, was angesichts der Lebenserwartung der Menschen kein echter Vorteil ist. Wir müssen uns hier vor Augen halten, dass sich Lachgas dreihundertmal stärker auf den Treibhauseffekt auswirkt als Kohlendioxid und es sich trotz des geringeren Anteils in der Atmosphäre extrem klimaschädlich zeigt.
Vor der industriellen Revolution betrug der N2O-Anteil in der Atmosphäre 207 ppb (Parts of Billion – Teil einer Milliarde). Im Jahr 2017 wurden 330 ppb gemessen, wobei der höchste Anstieg besonders seit dem Jahr 2009 zu verzeichnen war. Von 2000 bis 2010 betrug der Anstieg 0,68 ppb und im nur halb so langen Zeitraum 2010 bis 2015 stieg der Wert um 0,98 ppb an. Von 2000 bis 2013 stieg die Stickstoffeinlage im Boden parallel um 59 Millionen Tonnen an. In Anbaugebieten, die zusätzlich noch gedüngt werden, stieg der ohnehin schon vorhandene Überschuss auf einen theoretischen „Über-Überschuss“ von 18 Millionen Tonnen. Da das Ökosystem solche theoretischen Überschüsse praktisch nicht zulässt, entweichen sie automatisch wieder aus dem Boden in die Atmosphäre. Seit 2009 ist der Wert des von der Erde in die Luft entweichenden Lachgas laut IPCC-Bericht um 2,9% gestiegen. Die Wissenschaftler suchten auch nach natürlichen Ursachen für den Anstieg und nach bekannten Verfahren, die einen Anstieg hätten verursachen können. Allein damit ließe sich der Anstieg aber ohnehin nicht erklären. Der Referenzzeitraum von 1998 bis 2015 wurde auch mit zurückliegenden Daten verglichen und es wurde ein Durchschnittswert berechnet, doch das Ergebnis blieb unverändert: Die N2O-Emissionen sind menschengemacht. Allerdings hat sich die Herkunft der Emissionen verschoben. Die USA und Europa haben zwar insgesamt viel, aber nicht mehr Lachgas als sonst ausgestoßen. Hingegen haben sich die N2O-Emissionen in Ostasien und Südamerika so weit erhöht, dass dort weltweit das meiste Lachgas ausgestoßen wird. Clemens Scheer vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie bezeichnet den Abbau der Stickstoffüberschüsse bei der landwirtschaftlichen Produktion und beim Einsatz von organischem Dünger als "absolutes Muss", um die Klimaerwärmung zu stoppen (FRANKFURERER RUNDSCHAU vom 22.11.2019). Dies sei aber auch nötig, um etwa "eine Versauerung von Böden" sowie die "Kontamination von Grund- und Oberflächengewässern mit Nitrat" auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Das Magazin HEISE vom 19.11.2019 zitiert Scheer: "Wahrscheinlich sehen wir erst die Spitze des Eisberges, da Stickstoff in der Biosphäre in den letzten Jahrzehnten massiv akkumulierte". Er sieht ein sehr hohes Potenzial, die N2O-Emissionen aus anthropogenen Quellen wieder deutlich zu senken, aber angesichts der wachsenden Weltbevölkerung und dem damit einhergehenden Nahrungsmittelbedarf handle es sich "sicherlich um eine der größten Herausforderungen unserer Zeit". Fortunat Joos, Professor für Klima- und Umweltphysik an der Universität Bern, bezeichnete den bleibenden Anstieg bei den Lachgas-Emissionen als "sehr beunruhigend", da er die Modelle der Klimaerwärmung zusätzlich durcheinanderwirbele. N2O sei auf lange Sicht aber weniger schädlich als CO2, da es im Gegensatz dazu eine beschränkte Lebensdauer von rund 120 Jahren in der Atmosphäre habe (HEISE vom 20.11.2019 von Stefan Krempl). Der Lachgas-Ausstoß müsse stabilisiert werden, während die CO2-Emissionen auf Netto-Null reduziert werden müssten.