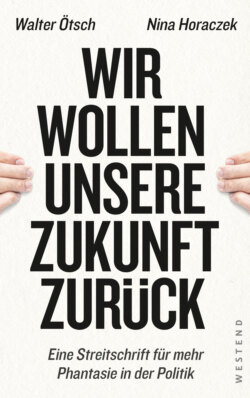Читать книгу Wir wollen unsere Zukunft zurück! - Nina Horaczek - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Durchbruch
ОглавлениеDie 1970er-Jahre bringen den unerwarteten Durchbruch für das neoliberale Netzwerk – ein halbes Jahrhundert nach dem Beginn der Bewegung. Was in einem kleinen wissenschaftlichen Kreis seinen Ursprung hatte, durchdrang ab den 1970er-Jahren die globale Politik. Damals kam es in zahlreichen Ländern der Welt zu einer »neoliberalen Wende« in der Politik durch konservative beziehungsweise rechte Parteien. In Großbritannien und in den USA kamen fast zeitgleich die konservativen Politiker Margaret Thatcher von den britischen Tories und Ronald Reagan von den amerikanischen Republikanern an die Macht. Beide waren Anhänger von Hayek und Friedman und beide setzten Teile der Lehren dieser beiden Ökonomen politisch um.
Die USA und Großbritannien sind für das globale Schicksal des Planeten von besonderer Bedeutung, weil sie trotz des fulminanten Aufstiegs von China in die Liga der großen Wirtschaftsmächte immer noch die Heimat der beiden Machtzentren des Kapitalismus sind: nämlich der City of London, die über Jahrhunderte die Finanzen des britischen Empires managte, und der Wall Street in New York, deren Banken und Fonds nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Dollar als Weltleitwährung zu den größten der Welt wurden. Das aktuelle globale kapitalistische System beruht in hohem Maße immer noch auf den Rechtssystemen dieser beiden Länder beziehungsweise von England und dem US-Staat New York.23 Indem der Neoliberalismus die Machtzentren des Kapitalismus eroberte, konnte er von dort seinen weltweiten Siegeszug antreten.
Der neoliberale Umschwung hat in vielen Ländern direkt mit der Mont Pèlerin Society zu tun. Denn sie begann ab der Mitte der 1950er-Jahre, sich ein eigenes Reich aufzubauen, unterstützt und finanziert von reichen Personen und Unternehmerinnen und Unternehmern, die erkannten, dass sich die Ideologie des Neoliberalismus gut für eigene Interessen einspannen lässt. Die Vertreterinnen und Vertreter der MPS errichteten zahlreiche Think Tanks. Diese Think Tanks waren eng verzahnt und gingen koordiniert in der Öffentlichkeit vor. Diese Denkfabriken dienten, so wurde es intern auch offen gesagt, der »Propaganda«. Sie richteten sich direkt an Medien, Politikerinnen und Politiker und waren stets darauf ausgerichtet, die Öffentlichkeit im eigenen Interesse zu beeinflussen.24 Viele Mitglieder dieser neoliberalen Denkfabriken waren in Doppelrollen tätig, eine Tatsache, die auch heute noch häufig zu beobachten ist: Sie treten zum einen als »objektive« Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im akademischen Bereich auf und sind gleichzeitig als Lobbyistinnen und Lobbyisten und als Propagandistinnen und Propagandisten in Think Tanks und in der Öffentlichkeit aktiv.
Heute umfasst das Netzwerk, das um die Mont-Pèlerin-Gesellschaft organisiert ist, als Atlas Network fast 500 Think Tanks weltweit. Finanziert wurde und wird das Atlas Network auch von Öl- und Chemiekonzernen wie dem Milliardenkonzern Koch Industries, ExxonMobile oder Shell, aber zumindest früher auch von Tabakkonzernen wie Phillip Morris.
In einzelnen Ländern trugen marktfundamentale Think Tanks in den 1970er-Jahren dazu bei, die konservativen Parteien nachhaltig zu verändern. Insbesondere in Großbritannien und in den USA spielten sie eine einflussreiche Rolle bei der »neoliberalen Wende« in der Ära von Thatcher und Reagan. Dazu leistete auch eine neue Welle von Think Tanks ihren Beitrag, die ausgehend von der MPS gegründet wurden und die viel aggressiver agierten und direkt auf die Beeinflussung der Politik gerichtet waren. Zu den wichtigsten Institutionen für die USA zählen dabei das Cato Institute und die Heritage Foundation.
Die Gründung des Letzteren im Jahre 1973 hängt eng mit der politischen Neuformierung der US-Republikaner nach der gescheiterten Präsidentschaftskampagne von Barry Goldwater im Jahre 1964 (die von Milton Friedman unterstützt wurde) zusammen.25 In der Folge wurden die Republikaner zu einer immer konservativeren Partei, die zunehmend kulturkritisch argumentierte und die Bruchlinien in der Gesellschaft thematisierte. 1969 zog Richard Nixon mit seinem Begriff silent majority in das Weiße Haus ein: »… die Vorstellung einer numerischen Mehrheit, die bisher aus undurchsichtigen Gründen von einem Elitenkartell von der Macht ferngehalten wurde.«26 Nixon appellierte an die »forgotten Americans, the non-shouters, the non-demonstrators«, Menschen also, die einfach nur hart arbeiten, ihre Steuern zahlen und ansonsten in Ruhe gelassen werden wollen.27
Nixon steht für eine Schwelle zwischen Keynesianismus und Neoliberalismus. Noch Anfang der 1970er-Jahre bekannte er sich als Gefolgsmann von John Maynard Keynes. Doch Ende der 1970er-Jahre wendete sich das Blatt, als es Ronald Reagan gelang, auch die konservativen Christen in das republikanische Lager zu ziehen.28 Unterstützt von Think Tanks führte er einen klar marktfundamentalen Wahlkampf: »Government is not the solution to our problem. Government is the problem«, war seine Parole.29 Die Regierung löse die Probleme der Menschen nicht, sie sei das Problem, lautete nun die Devise. Mit Reagans Wahlsieg im Jahr 1981 waren die Neoliberalen im Zentrum der Macht angekommen. Die Heritage Foundation legte der neuen Reagan-Regierung einen über tausend Seiten starken Bericht mit dem Titel »Mandate for Leadership« vor, ein Kompendium von 1 270 Vorschlägen, von denen zahlreiche in der Regierung Reagan umgesetzt wurden. Viele der damals beschlossenen Steuerkürzungen argumentierte Reagan mit dem Wunsch, »die Bestie auszuhungern« (»starving the beast«).30 Die »Bestie«, damit war der Staat mit seinen Ausgaben gemeint. Tatsächlich wurden die Staatsausgaben, auch als Folge der Steuerkürzungen, kräftig erhöht, insbesondere für die Rüstung.
Die Regentschaft Reagans veränderte nicht nur die USA, sondern die ganze Welt. Unter seiner Ägide änderten sich in den 1980er-Jahren die Arbeitsweise und Ziele der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds nachhaltig. Die USA nutzten die Schuldenkrise der 1980er-Jahre, um eine globale Politik »des Marktes« zu etablieren. Um die Schulden erlassen zu bekommen, mussten über hundert Länder sogenannte »Strukturanpassungsprogramme« (Structural Adjustment Loans) durchführen, sie wurden sprachlich als Armutsbekämpfungs- und Wachstumsprogramme beschönigt (Poverty Reduction and Growth Facility) – 1989 sprach man zusammenfassend auch von einem Washington Consensus.31 Im Gegenzug für die Finanzhilfen wurde von den betroffenen Staaten Haushaltsdisziplin, Deregulierung, Privatisierungen von Staatsbetrieben und ein Abbau von Mindestlöhnen und Subventionen, etwa für Grundnahrungsmittel, verlangt. Die Konsequenz war in vielen Fällen der Abbau des Sozialstaates oder sogar von Souveränitätsrechten – die Verletzung von Menschenrechten spielte keine Rolle.
In Großbritannien stand der Umschwung unter der konservativen Premierministerin Thatcher in direktem Zusammenhang mit dem Centre for Policy Studies (CPS), das 1974 als Think Tank gegründet wurde, auch um die Tories zu »bekehren«, so der Gründer Keith Joseph. Denn für die Neoliberalen steckte selbst in den britischen Konservativen noch »zu viel Sozialismus«.32 Thatcher, damals stellvertretende Direktorin des Centre for Policy Studies, wurde im Jahr 1974 überraschend Oppositionsführerin der Konservativen. 1979 kam schließlich ihre große Stunde: Die Labour-Regierung wurde durch ein Misstrauensvotum gestürzt, der britischen Sozialdemokratie fehlte nur eine Stimme zur Mehrheit. Dem damaligen Premierminister James Callaghan von der Labour Party blieb nur übrig, Neuwahlen anzusetzen. Thatcher gewann die Wahl, sie wurde Premierministerin und wandelte das Land – zeitgleich mit Reagan in den USA – nach marktfundamentalen Prinzipien um. Bis ins Jahr 1990, als ihre Amtszeit endete, wurde ihre Regierung vom ihrem Centre beraten und unterstützt. Das CPS organisierte seinen Einfluss in »Studiengruppen«. Die erfolgreichste war dabei die Trade Union Reform Group. Praktisch sämtliche von dieser Gruppe Ende der 1970er-Jahre eingebrachten Vorschläge für »Reformen« wurden umgesetzt, wie das Verbot von Solidaritätsstreiks, um die Befugnisse der Gewerkschaften drastisch einzuschränken.33