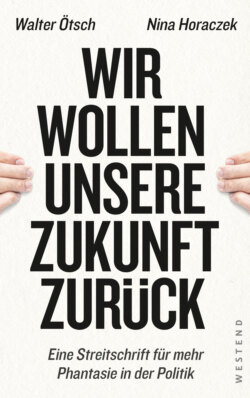Читать книгу Wir wollen unsere Zukunft zurück! - Nina Horaczek - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung: Warum die Zeit reif ist für eine bessere Zukunft für alle
ОглавлениеFreuen Sie sich. Eine neue, bessere Zukunft wartet auf uns. Eine Zukunft, in der wir viel weniger von der Ausbeutung anderer – seien es Menschen, Tiere oder die Umwelt – profitieren. In der nicht mehr der Profit der Maßstab aller Dinge ist, sondern der Mensch mit seinem Recht auf eine saubere, intakte Umwelt und ein besseres Leben.
Zugegeben, unser Optimismus ist aus der Not geboren. Weil es keine Alternative zu einer positiven Veränderung gibt – zumindest wenn wir als Menschheit überleben wollen. Aber auch, weil sich das Bewusstsein, wie dringend sich die Welt ändern muss, langsam bis in die Mitte der Gesellschaft durchsetzt.
Das Fenster der Möglichkeiten öffnet sich genau jetzt in diesem Moment. Die Vorboten einer besseren Welt sind schon da. Wir müssen nur unsere Augen öffnen und genau hinsehen. In diesem Buch finden Sie zahlreiche Beispiele dafür, wie eine bessere Welt für alle aussehen kann – und auch, wie wir dort hinkommen können.
Warum gerade jetzt? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Im Jahr 2020 überkreuzten zwei Ereignisse einander: ein notwendiges, nämlich das Anwachsen der Klimaschutzinitiative Fridays for Future zu einer globalen Bewegung, und ein zufälliges, die Covid-19-Pandemie.
Die neue globale Bewegung war notwendig, weil seit mittlerweile vier Jahrzehnten bekannt ist, dass unser Wirtschaftssystem, das stets auf Wachstum ausgerichtet ist, zu einer massiven Erderwärmung führt und dadurch die ökologischen Grundlagen der Menschheit gefährdet. Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis die Allgemeinheit gegen diese Entwicklung protestiert, bis engagierte Bürgerinnen und Bürger auf die Straße gehen.
Fridays for Future war gerade eineinhalb Jahre alt, als ein weiteres, zufälliges Ereignis, nämlich die Covid-19-Pandemie, die Menschheit in Angst versetzte. Normalerweise bremsen derart einschneidende Ereignisse andere Entwicklungen in der Gesellschaft aus. So war es zumindest in den vergangenen Jahrzehnten mit der Klimabewegung: Wann immer die Erderwärmung breiter diskutiert wurde, krachte ein anderes Großereignis über uns hinein – und schon war der Klimawandel wieder aus den Schlagzeilen verschwunden. Das war im Jahr 1989 so, als die Berliner Mauer fiel. Das war nach den islamistischen Terroranschlägen vom 11. September 2001 so. Wenige Jahre später, im September 2008, stand das Finanzsystem vor dem Kollaps und das Umweltthema verschwand erneut von den Titelseiten.
Jetzt, im Jahr 2021, ist es zum ersten Mal ganz anders. Die Coronapandemie hat das Thema Erderwärmung nur für einen kurzen Wimpernschlag aus den politischen Charts verdrängt – um dem Umweltthema schnell einen noch viel stärkeren Schub zu verleihen. In einer im September 2020 veröffentlichten Umfrage des »Pew Research Center« in Washington, die in 14 Ländern der Welt, vor allem in Europa, Asien und Nordamerika, durchgeführt worden war, nannten 70 Prozent der Befragten den Klimawandel als große Bedrohung. Zum Vergleich: 2013 waren es erst 54 Prozent gewesen, 2017 61 Prozent. Die Pandemie bestätigte zentrale Thesen der Umweltbewegung: Wir können nicht weiter so mit unserer Umwelt umgehen. Wir können nicht weiter so verschwenderisch wirtschaften. Unsere Welt ist zerbrechlich.
Anlässlich ihres 75. Jahrestages ließen die Vereinten Nationen eine weltweite Umfrage durchführen, bei der die Menschen nach ihren Vorstellungen für die Zukunft, aber auch nach ihren größten Ängsten befragt wurden. »Inmitten der aktuellen COVID-19-Krise besteht für die meisten Befragten die unmittelbare Priorität darin, den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu verbessern – Gesundheitsversorgung, sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen und Bildung, gefolgt von größerer internationaler Solidarität und mehr Unterstützung für die am stärksten betroffenen Personen. Dies beinhaltet die Beseitigung von Ungleichheiten und den Wiederaufbau einer integrativeren Wirtschaft«, lauten die zentralen Erkenntnisse aus dieser weltweiten Befragung. »Mit Blick auf die Zukunft sind die überwältigenden Sorgen die Klimakrise und die Zerstörung unserer natürlichen Umwelt. Weitere Prioritäten sind: stärkere Achtung der Menschenrechte sicherzustellen, Konflikte beizulegen, Armut zu bekämpfen und Korruption zu verringern.« Über 87 Prozent der Befragten erklärten in dieser Umfrage, dass die globale Zusammenarbeit für die Bewältigung der heutigen Herausforderungen von entscheidender Bedeutung ist und dass die Pandemie die internationale Zusammenarbeit dringlicher gemacht hat.1
Die Coronakrise »führt uns vor Augen, wie eng Ökosysteme und Gesundheit miteinander verbunden sind und wie verletzlich unsere Gesundheit ist«, sagt auch Sabine Gabrysch, Professorin für Klimawandel und Gesundheit an der Charité Universität in Berlin, im April 2021 im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung.2 Wenn wir nicht wollen, dass immer mehr Kinder an Allergien und Atemwegserkrankungen leiden, wenn wir nicht wollen, dass immer mehr alte Menschen an Hitzesommern sterben, wie dies im Rekordsommer 2018 passierte, dann müssen wir endlich eines tun: aufstehen und uns einmischen.
Nur wie? Wo sind die Visionen für ein besseres und gesünderes Leben? Die gute Nachricht: Es gibt sie. Es gab sie schon immer. Die schlechte: Wir haben uns daran gewöhnt, zu glauben, dass wir nichts ändern können. Nicht als Individuen und auch nicht als Gesellschaft.
Was aber hat in den vergangenen Jahrzehnten eine umfassende soziale und ökologische Transformation blockiert? Wieso wissen wir so lange, dass es um unseren Planeten immer schlechter steht, und warum passierte trotzdem nur so wenig? Auch davon handelt dieses Buch. Denn die Gegenwart ist immer ein Produkt der Vergangenheit und ohne die Vergangenheit zu verstehen, können wir keine neue, bessere Zukunft bauen.
Jahrzehntelang vermittelten Politik und Wirtschaft die Botschaft, die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger könnten lediglich die schlimmsten Auswirkungen des Markthandelns abfedern, mehr nicht. Das Bild, das die Politik den Menschen vermittelte, lautete: Von den politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern dürfe man sich keine großen Würfe erwarten. Rasche gesetzliche Schritte mit weitreichender Wirkung seien unrealistisch. Kein Land werde etwas tun, wenn nicht alle anderen im Gleichklang mitziehen. Im globalen Wettbewerb der Staaten werde kein Land so dumm sein, Maßnahmen zu setzen, die ihm alleine Nachteile verschaffen, während andere Länder abwarten und vielleicht nichts tun. Und solange die Wirtschaft nicht mitspiele, werde gar nichts passieren.
All diese Ausreden sind durch die Taten der Politik widerlegt. Denn im Frühjahr 2020 war gleichsam über Nacht alles anders. Die Politik gab die Regeln vor. Plötzlich blieben alle Flugzeuge auf dem Boden. Plötzlich blieben alle Geschäfte zu. In der Pandemie hat die Politik klar gezeigt, dass sie handlungsfähig ist und die Welt verändern kann – sie muss nur den Mut haben, es auch zu tun. »Es gibt keine Ausreden mehr fürs Nichthandeln«, meinte der Politikexperte Christoph Hofinger schon im Herbst 2020.3 Er leitet das SORA Institut, das zu den bekanntesten politischen Forschungsinstituten in Österreich zählt.
Auch auf rechtlicher Ebene kam es kürzlich zu einer historischen Zäsur. Mit der im März 2021 getroffenen Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts zur teilweisen Verfassungswidrigkeit des Klimaschutzgesetzes definierte das Oberste Gericht auch den Freiheitsbegriff radikal neu. Freiheit bedeutet seitdem auch, die künftigen Generationen nicht schädigen zu dürfen.
Es dürfe »nicht einer Generation zugestanden werden, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben umfassenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde. Künftig können selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein; gerade deshalb droht dann die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbußen hinnehmen zu müssen«, steht in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.4
Das ist das genaue Gegenteil zu jenem neoliberalen Paradigma, das bis zum Ausbruch der Coronapandemie den Mainstream beherrschte. Bis dahin lautete das politische Mantra, der Staat dürfe keine Schulden machen, weil dies die Zukunft der nachfolgenden Generationen zerstöre. Nun erklärten die Richterinnen und Richter, der Staat müsse sofort handeln, um die Erderwärmung zu bekämpfen. Nur so könne gesichert werden, dass auch nachfolgende Generationen eine Chance haben, ihre freiheitlichen Grundrechte auszuüben. Die Investitionen in den Klimaschutz von heute sind Garanten für eine lebenswerte Zukunft.
Noch eine Entwicklung gibt Hoffnung, wurde bis jetzt aber viel zu wenig beachtet: Bewegungen wie Fridays for Future gehen von der Jugend aus. Sie führen ein globales politisches Bündnis an, das mittlerweile auch eine weltweite Schar an Erwachsenen überzeugt. Die Tatsache, dass die Jugend Katalysator für Veränderung ist, ist per se nicht ungewöhnlich. Die letzte große Bewegung, die unsere Gesellschaft radikal veränderte, war jene der sogenannten 68er. Auch diese Bewegung war von jungen Menschen getragen. Die 68er entstanden in Abgrenzung zu ihren Eltern, jener Generation, die für Adolf Hitlers Aufstieg und die Barbarei des Nationalsozialismus verantwortlich war. Die 68er konfrontierten ihre Elterngeneration damit, dass sie die Schreckensherrschaft der Nazis und die Shoah schweigend mitgetragen oder gar aktiv unterstützt hatten. Die 68er waren noch Kinder einer autoritären, vom Nationalsozialismus geprägten Erziehung. Ihre Politisierung und ihr beharrliches Nachfragen führten in vielen Fällen zum Schweigen am Familientisch oder gar zum Bruch in der Familie.
Im Gegensatz dazu entstammen die jungen Menschen, die heute für die Rettung des Klimas auf die Straße gehen, einer ganz anderen Generation. »Sie wuchsen mit einer ganz anderen Erziehung auf«, sagt der Politikforscher Hofinger. Diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen konnten (in vielen, natürlich nicht in allen Fällen) in einem Klima des Respekts und der Liebe groß werden und sie wurden von ihrem Umfeld mit dem Anspruch erzogen, dass aus ihnen moralische Menschen werden.
Nun hält diese Generation ihren Eltern einen Spiegel vor: »In der Moral, in der ihr uns erzogen habt, ist euer Verhalten gegenüber der Umwelt nicht konsistent«, lautet die Botschaft. Die jungen Leute tun das aber nicht in der anklagenden Dynamik der 68er-Generation, sie brechen die Brücken zur Elterngeneration nicht ab. Sie bleiben in Kontakt und konfrontieren uns auf Augenhöhe mit den richtigen Fragen.
Wir sind es ihnen schuldig, die Antworten darauf zu finden.
Linz/Wien, August 2021