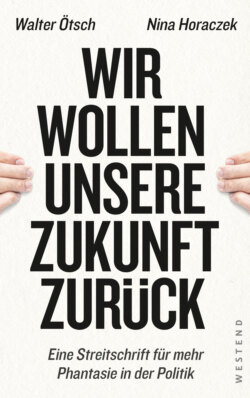Читать книгу Wir wollen unsere Zukunft zurück! - Nina Horaczek - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Wie es zur Krise der politischen Phantasie kam Ein langsamer Niedergang
ОглавлениеDie Phantasie verschwand nicht über Nacht aus der Politik. Der Niedergang der produktiven politischen Phantasie war schleichend und erstreckte sich kaum bemerkt über einige Jahrzehnte. Bis vor dem Entstehen von Fridays for Future und bis vor der Coronakrise galt es fast als selbstverständlich, von der Politik keine positiven Bilder über die drängenden Fragen der Zukunft zu erwarten. Viele Wähler und Wählerinnen waren von der Politik enttäuscht und sahen ihr Leben fernab vom politischen Geschehen. In vielen Fällen unterschieden die Menschen kaum mehr zwischen Politik und politischen Parteien.
Wer im persönlichen Umfeld fragt, welches Bild die Menschen von Politik haben, hört häufig folgende Schlagworte: Streit, Korruption, Günstlingswirtschaft. Eine Umfrage der Kommunikationsagentur Edelman in New York, die unter 34 000 Menschen in 28 Ländern durchgeführt wurde, illustriert eine fortschreitende Abnahme des Vertrauens in die Politik, aber auch in Wirtschaft und Medien. In den USA sank das Vertrauen in die Regierungsinstitutionen zwischen Mai 2020 und dem Jahr 2021 von 53 auf 48 Prozent. Das heißt, weniger als jeder und jede zweite Befragte vertrauen denjenigen, die von der Bevölkerung in Regierungsämter gewählt wurden. Das meiste Vertrauen, nämlich 61 Prozent, schenken die Befragten aus 28 Ländern der Wirtschaft, gefolgt von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) mit 57 Prozent. Den Regierungen wird global gesehen lediglich zu 53 Prozent vertraut, den Medien glaubt nur noch knapp jeder und jede Zweite (51 Prozent).1
Gleichzeitig fordern weltweit immer mehr Menschen politische Reformen: 2020 erklärten 68 Prozent der Französinnen und Franzosen, 65 Prozent der US-Amerikanerinnen und Amerikaner sowie 48 Prozent der Britinnen und Briten und 39 Prozent der Deutschen in einer Umfrage, das politische System in ihrem Land brauche eine große Veränderung.2
Das zeigt, dass den Menschen trotz aller politischer Frustration die Probleme auf der Welt nicht egal sind. Ganz im Gegenteil. Die Menschen, die in der oben genannten UN-Studie befragt wurden, haben ein durchaus intaktes Sensorium, was die großen Probleme, vor denen die Menschheit steht, betrifft: 84 Prozent der Befragten sind in Sorge um ihren Arbeitsplatz. 40 Prozent fühlen sich durch den Klimawandel konkret bedroht, insgesamt 72 Prozent bereitet die steigende Erderwärmung zumindest Sorge. Neben Cyberattacken (35 Prozent in Furcht, 68 Prozent sorgenvoll) und der Covid-19-Pandemie (die 35 Prozent Furcht bereitet und 65 Prozent Sorge) ist es die Furcht (32 Prozent) beziehungsweise Sorge (61 Prozent) um den Verlust von Freiheit und Bürgerinnen- und Bürgerrechten.
Gleichzeitig fühlen sich Bürgerinnen und Bürger immer weniger von den politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten vertreten. In Deutschland ist dieser Befund nicht ganz so niederschmetternd. 54 Prozent der befragten Deutschen vertrauen der Wirtschaft, 52 Prozent den Medien, nur 46 Prozent NGOs und mit 59 Prozent wurde der Regierung in dieser Befragung das meiste Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ausgesprochen.
Fest steht jedoch: Die Demokratie befindet sich in einer Krise. Ein wachsender Teil der Bevölkerung fühlt sich von den politischen Parteien nicht mehr vertreten. Viele erfahren die Wahlkämpfe als rituelle Abläufe mit sinnlosen Slogans und den immer gleichen Stehsätzen. In Talkshows und Medien wird über den Wahlkampf wie über ein Pferderennen berichtet: Welches Pferd liegt um wie viel Meter vorne, welches lahmt und welches hat welchen Laut von sich gegeben? Machen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten im Wahlkampf Versprechungen, erwartet kaum jemand der Wählerinnen und Wähler noch, dass diese – sollte die betreffende Partei nach der Wahl Regierungsverantwortung übernehmen – ernsthaft umgesetzt werden.
War das nicht schon immer so? Nein. Historisch gesehen ist dieser Befund, der für die meisten Parteien gilt, nicht selbstverständlich oder gar unausweichlich. Wir stehen vor einem scheinbaren Paradoxon. Spätestens seit dem Auftreten der rechtspopulistischen Parteien ist die politische Arena von heftigem Streit durchzogen. Dies strahlt weit aus. Mittlerweile setzen nicht mehr nur Parteien der extremen Rechten in der politischen Auseinandersetzung auf populistische Tricks, sondern auch Parteien, die bis vor kurzem noch in der gemäßigten politischen Mitte angesiedelt waren.
Zudem verfolgen viele Populistinnen und Populisten die Strategie eines permanenten Wahlkampfs, um die Bevölkerung in einen ständigen Zustand der politischen Erregung und des Konflikts zu ziehen. Das Ziel ist nicht mehr, eine politische Diskussion zu führen, also in einem Ringen einander widersprechender Positionen und Interessen einen positiven Kompromiss für einen möglichst großen Teil der Bevölkerung zu erzielen. Stattdessen wird Politik als erbitterter Kampf »Wir« gegen »die Anderen« inszeniert, ein Kampf, in dem es nur einen Sieger oder eine Siegerin geben darf. Schlimm genug, dass Populistinnen und Populisten mit diesem einfachen Rezept die Bevölkerung spalten. Noch schlimmer, dass manche Regierungen dieses populistische Spiel kopieren. Dauernde Inszenierungen sollen die eigene Gefolgschaft aktivieren. Politik dient hier bloß der Aufrechterhaltung eines Erregungszustands in der Bevölkerung. Auf diese Weise sorgen die Populistinnen und Populisten, aber auch deren Gegnerinnen und Gegner (die auf gezielte Provokation mit lauter Empörung reagieren) dafür, dass die ganze Zeit kein positiver Zukunftsdiskurs geführt wird.3
Denn im Populismus wird bloß das Bild einer guten alten Zeit beschworen, die es niemals gegeben hat. Dieses verklärte Vergangenheitsbild wird als Leitbild in die Zukunft geschoben. Trumps Slogan »Make America great again« verdeutlicht das Prinzip. Der Historiker Timothy Synder spricht vom »Prinzip der Ewigkeit«, das er so erklärt: »Die Verführung durch eine mythisierte Vergangenheit hindert uns daran, über mögliche Zukünfte nachzudenken. Die Gewohnheit, in der Opferrolle zu verweilen, stumpft den Impuls der Selbstkorrektur ab. Da die Nation durch die ihr innewohnende Tugend und nicht durch ihr zukünftiges Potenzial definiert wird, wird Politik zu einer Diskussion über Gut und Böse und nicht zu einer Diskussion über mögliche Lösungen für reale Probleme.«4
Jede Auseinandersetzung in der Politik betrifft immer die Zukunft. Diese kann bewusst und offen oder unbewusst und stillschweigend geführt werden. Die bewusste Frage lautet: Wie soll Zukunft gestaltet werden?
Aber bevor diese Frage beantwortet wird, braucht es einen Blick in die Vergangenheit: Wie konnte sich der Zukunftsdiskurs so sehr verändern?