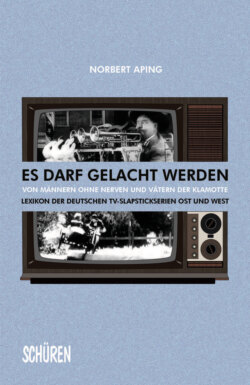Читать книгу Es darf gelacht werden Von Männern ohne Nerven und Vätern der Klamotte - Norbert Aping - Страница 11
Verstreute Quellen
ОглавлениеEin größerer Teil der Slapstickserien ist nicht überliefert worden. Bis weit in die 1970er-Jahre wurden sie im Bereich der ARD nicht archiviert. Auch beim ZDF ist längst nicht alles mehr vorhanden. Seit der Insolvenz des Kirch-Imperiums Anfang der 2000er-Jahre ist der Zugang zu früheren Serien aus dessen Produktion kompliziert. Kein deutscher Sender hat von Beginn an eine Programm-Chronik erstellt. Offenbar hielt man das nicht für erforderlich. Erst sehr viel später wurde das Versäumnis als Fehler angesehen und mit Rückdokumentationen begonnen, die bis heute lückenhaft geblieben sind. Beim ZDF zum Beispiel konzentriert sich die Rückwärtsdokumentation vor allem auf vorhandene, noch verfügbare Sendebeiträge.
Um den Serien zu Inhalt, Umfang, Produktion und Hintergrund auf die Spur zu kommen, war eine Generalrecherche verschiedener Quellen unausweichlich. Sie ermöglichte mosaikartig ein ziemlich vollständiges Bild.
Um ein breiteres Bild zu erhalten, wurden für die Recherche Programmzeitschriften herangezogen, die seit den 1950er-Jahren erschienen. Für den bundesdeutschen Bereich sind dies: Bildschirm, Bild + Funk, Fernsehstunde, Funk Uhr, Gong, Hören und Sehen, Hörzu, tele 14 Tage, TV Fernseh-Woche sowie TV Hören und Sehen. Dazu kamen Programminformationen des Bayerischen, Berliner, Hessischen und Westdeutschen Werbefernsehens. Letzteres gab ab 1962 monatlich das Programmheft Intermezzo heraus, das einer TV-Zeitschrift ähnelt. In der zentralistischen DDR war die Bandbreite ungleich geringer. Unser Rundfunk, FF – Funk und Fernsehen und ff dabei sind aufeinander folgende Titel einer Zeitschrift. Nach der deutschen Wende kamen die Programmzeitschriften des deutsch-französischen Kulturkanals arte hinzu: arte Monatsheft und arte Magazin. Die Programmzeitschriften geben aber keine Auskunft darüber, was tatsächlich gesendet worden ist. Die abgedruckten Programme erschienen in der Regel eine Woche vor dem Beginn der neuen Programmwoche und fußen auf den Ankündigungen der Sender. Ankündigungen sind schon begrifflich keine Nachweise.
Die Sender gaben wöchentlich den geplanten Programmablauf heraus, die so genannten Sendefahnen. Dazu veröffentlichten sie in ihrem Programmdienst mit einem Vorlauf von etwa sechs Wochen vor der beabsichtigten Ausstrahlung zu ausgewählten Sendungen Informationen für die Presse. Mit ihren schwerpunktmäßigen Informationen bilden Pressedienste also nicht das gesamte Programm ab. Nicht alles, was angekündigt wurde, wurde aber auch gesendet. Bis zur Sendung konnte es zu Änderungen in der Programmplanung kommen. Manchmal konnten sie den Zeitschriften noch bis zur Drucklegung mitgeteilt werden. Das ZDF bot in seinem Programmdienst Informationen über Änderungen bis zu drei Tage vor dem Sendetag an. Zuweilen waren Änderungen aber so kurzfristig, dass Vorabinformationen nicht mehr möglich waren. Besondere Ereignisse, wie Sportveranstaltungen, politische Entwicklungen oder der Tod bekannter Persönlichkeiten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens führten nicht selten zu Programmänderungen. Die Fernsehzuschauer sind mit solcherlei Änderungen aus tagesaktuellem Anlass sicherlich vertraut. In der vor-digitalen Zeit wurden die Änderungen in vielen Fällen in den Änderungsteilen der Programmdienste der Sender nachträglich mitgeteilt. Im digitalen Zeitalter erreichen auch kurzfristige Änderungen noch weitgehend rechtzeitig die interessierten Zuschauer.
Die Zeitschriften werteten die Informationen, die sie von den Sendern erhielten, sehr unterschiedlich aus. Man berichtete im Idealfall ausführlich, manchmal verbunden mit eigenen Recherchen, die zusätzlich im redaktionellen Teil der jeweiligen Zeitschrift abgedruckt wurden. Andererseits war es kein Einzelfall, dass man sich trotz vorhandener Informationen durch die Sender auf rudimentäre Angaben wie den Sendetitel beschränkte. Bei Serien wurde nicht immer der Titel der jeweiligen Episode abgedruckt. Dann lässt sich schwerlich sagen, was tatsächlich gezeigt wurde.
Diese Quellenlage machte es erforderlich, Unterlagen über die Zuschauerbefragung, die Erhebung von Sehbeteiligung und Einschaltquoten bis hin zu den Sendeprotokollen heranzuziehen. Besonders ertragreich war dies inhaltlich für das CINEMATOGRAPHEN-THEATER und in puncto konkreter Zuschaueräußerungen für die zweite Staffel von ES DARF GELACHT WERDEN. Die Sendeprotokolle über den tatsächlichen Verlauf eines jedes Programmtages, auch korrigierte Sendepläne genannt, sind der Nachweis dafür, dass und wann ein Beitrag tatsächlich gesendet worden ist. Die Erhebungen von Infratest und Infratam sind auch als Nachweise geeignet, weil die Sendungen den Untersuchungsgegenstand darstellen. Allerdings gab es, zumindest in der Zeit bis zu den 1960er-Jahren, mitunter Einschränkungen bei den Berichten der Zuschauerforschung. Entweder erhielten die Forschungsinstitute eingeschränkte Berichtsaufträge oder sie trafen selbst eine Auswahl unter den Sendungen, über die sie berichteten. Manchmal ließen sich auch keine repräsentativen Erhebungen durchführen. Über viele Jahre bildeten die Berichte der Zuschauerforschung nicht das gesamte Programm ab.
Bundesdeutsche Fernsehanstalten und ihre Werbetöchter haben zu ihren beliebten Slapstickserien der 1960er- und 1970er-Jahre wenige Unterlagen aufbewahrt. Als ich gegen Ende der 1990er-Jahre für das Dick und Doof Buch recherchierte, existierten noch manche Unterlagen. Für Werbetöchter und Privatsender war es noch selbstverständlich, Fragen zu beantworten. Hätte ich damals schon gezielt zu allen Slapstickserien recherchiert und mich nicht im Wesentlichen auf die Laurel-und-Hardy-Bezüge konzentriert, hätten sich wahrscheinlich mehr Unterlagen zusammentragen lassen, als das heute möglich ist. In den vergangenen 20 Jahren haben sich die Verhältnisse grundlegend geändert. Werbetöchter und Privatsender sehen die Archivierung nur noch bedingt als sinnvoll an. Man trennt sich «vom Ballast» vergangener Tage und entsorgt Unterlagen, wenn sie aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen nicht mehr aufbewahrt werden müssen und sich wirtschaftlich nicht länger nutzen lassen. Vor allem aber sollte man heutzutage in aller Regel nicht mehr damit rechnen, von Privatsendern und Rechtsnachfolgern des früheren Werbefernsehens Antworten zu erhalten. Die Rubrik auf Webseiten «Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns!» gerät dann zur Farce. Die Rückwärtsdokumentation im öffentlich-rechtlichen Bereich hat darüber hinaus darunter gelitten, dass nicht alle Papier-Unterlagen bzw. nicht alle aus ihnen ersichtlichen Informationen von ausgebildeten Archivkräften in standardisierte digitale Datenbank-Muster überführt wurden. Es wurden nicht selten kostengünstige Hilfskräfte eingesetzt, denen letztlich überlassen blieb zu beurteilen, was für die Übertragung bedeutsam war. Die Digitalisierung hat daher zu manch nicht zu unterschätzendem Informationsverlust geführt.
Um Filme zu identifizieren, die in den Slapstickserien gezeigt wurden, können TV-interne Produktionsunterlagen, Akten über Außenhandel und internationalen Filmaustausch sowie überlieferte Ansagetexte helfen. Sie enthalten manchmal weiterführende Informationen über Produktion und Inhalte. Die Identifizierung der Originalfilme bleibt dennoch schwierig und aufwändig. Seit der Frühzeit des Films wurden Slapstickfilme häufig über Jahrzehnte unter immer neuen Titeln in den Kinos wiederaufgeführt, mitunter auch als Zusammenschnitte mit anderen nicht gekennzeichneten Streifen. In den TV-Serien wurden Originaltitel so gut wie nie mitgeteilt. Ende der 1970er-Jahre waren die Serien STARS DER STUMMFILMÄRA und STARS DER STUMMFILMZEIT in der Hinsicht eine große Ausnahme. Das änderte sich erst in den 1990er-Jahren, als der deutsch-französische Sender arte Slapstickserien zeigte. Dort war es eine cineastische Selbstverständlichkeit, über das Original zu informieren. Abgesehen von der umfangreichen Übernahme der bundesdeutschen Serie KLAMOTTENKISTE sind die DDR-Serien nicht archiviert worden. Die ausgezeichneten FILMOBIBLIOGRAFISCHEN JAHRESBERICHTE, die seit 1965 jährlich von der Hochschule für Film und Fernsehen der DDR «Konrad Wolf» in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Filmarchiv der DDR bzw. ab dem Berichtsjahr 1989 mit dem Bundesarchiv – Filmarchiv herausgegeben worden sind, stellten sich für die Slapstickserien nicht als hilfreich heraus. Sie weisen als einzige Slapstickserie lediglich die KLAMOTTENKISTE aus und auch nur mit vier der acht neuen Serientitel, unter denen sie in der DDR gesendet wurde (1985, S. 274, 275; 1986, S. 290; 1988: S. 268). Daher ließ sich die Recherche für den Bereich der DDR im Wesentlichen nur auf überlieferte schriftliche Unterlagen stützen. Aus Programmunterlagen, dem Fernsehdienst und der TV-Zeitschrift der DDR ließen sich Rückschlüsse auf Komiker und konkrete Filmtitel gewinnen. Zuweilen aber waren die Angaben spärlich oder gar nichtssagend. Titel wie VERRÜCKTE TAGE ohne irgendeinen Hinweis auf Darsteller und Inhalt machen jede Zuordnung unmöglich. Wenn die einzige Information zu einem Chaplin-Film der Sendetitel AUF ZIMMERSUCHE ist, bleibt eine genaue Eingrenzung immer noch schwierig. Ganz unmöglich sind Identifizierungen ohne vorhandenes sendefähiges Materials dann, wenn in Ankündigungen von nicht mehr als «einem Film mit …» die Rede ist oder zum Beispiel nur gefragt wird: «Lachen Sie auch über Slapsticks?»
Als besonderer Glücksfall erwiesen sich daher die umfangreichen Arbeitsunterlagen von Heinz Caloué samt Schriftverkehr, die er mir hinterlassen hat. Sie betreffen alle Phasen der Produktion von der Materialsichtung über die Planung und das Verfassen von Dialogbüchern bis zu den Aufnahmen im Synchronstudio. Mit seine Unterlagen ließen sich große Lücken schließen. So konnte der Inhalt der Serie ES DARF GELACHT WERDEN vollständig rekonstruiert werden, obwohl von ihren 54 Folgen wohl nur noch zwei existieren, die zu allem Überfluss noch unzugänglich sind. Dazu kamen Arbeitsfotos aus dem Besitz von Konrad Elfers. Außerdem hatte ich Zugang zu dem umfangreichen Nachlass des Filmkomponisten Conny Schumann, der unter anderem für die Musik der vorbildlichen deutschen Synchronisation von 36 kurzen Tonfilmen des Duos Laurel und Hardy bei Kirchs Beta Technik verantwortlich war. All das zusammengenommen machte es möglich, die im Laufe der Jahrzehnte rund 1 000 gesendeten Serienfolgen, die weit mehr Slapstickfilme enthalten, sehr weitgehend zu klären. Außerdem ließen sich Ergebnisse des Dick und Doof Buches im Serienbereich näher beleuchten und an einigen Stellen aus dem komplexen Kontext heraus auch korrigieren.
Die Recherchen haben schwerpunktmäßig in folgenden Einrichtungen stattgefunden: Bundesarchiv-Filmarchiv (Berlin), Deutsches Filminstitut und Fernsehmuseum (Frankfurt a. M.), Deutsche Nationalbibliothek (Standorte Frankfurt a. M. und Leipzig), Deutsches Rundfunkarchiv (Standorte Frankfurt a. M. und Potsdam-Babelsberg), Hans-Bredow-Institut (Hamburg), Unternehmensarchive des Hessischen Rundfunks (Frankfurt a. M.) und des ZDF (Mainz), Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf (Potsdam-Babelsberg), Stiftung Deutsche Kinemathek in Berlin (Bibliothek und Schriftgutarchiv) sowie die Historischen Archive des Norddeutschen und des Westdeutschen Rundfunks (Hamburg bzw. Köln). Für die Betrachtung im nachfolgenden Abschnitt «Ein langer Weg ins Fernsehen» hat mir freundlicherweise Frau Christine Dühlmeyer Materialien ihres verstorbenen Ehemannes Charly Dühlmeyer überlassen. Dazu habe ich Interviews mit Film- und Fernsehschaffenden geführt, die weitere Einblicke in die Produktion der Serien ermöglicht haben. Überwiegend stammen diese Interviews aus der Zeit der Recherchen für mein Dick und Doof Buch.