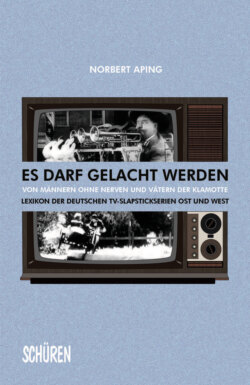Читать книгу Es darf gelacht werden Von Männern ohne Nerven und Vätern der Klamotte - Norbert Aping - Страница 20
Musik und Stummfilm
ОглавлениеDer Film-Erklärer ist überdies ein Beleg dafür, dass der Stummfilm nicht stumm ablief, sondern ein tönendes Erlebnis war. Dazu kam Musik. Ein reiner, wenn auch überziehender Vortrag wäre doch schnell eintönig geworden. Die Musik hatte seit der Frühzeit des Films eine wichtige dramaturgische Funktion und war unverzichtbar: Sie unterstützte die erkannte oder vermutete Filmhandlung durch passende Versatzstücke, die Spannung, Freude, Spaß, Hoffnung und Verzweiflung für jeden verständlich skizzierten. An den richtigen Stellen mussten Musiker zum Beispiel Spannung und Komik mit Tremolos, anschwellenden Klängen und abrupten Enden unterstützen. Musik ist die universellste Sprache. Ihr Erscheinungsbild fiel sehr unterschiedlich aus. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Sparte Filmmusik (Nowell-Smith, S. 172 ff.). In den 1920er-Jahren schufen versierte Film-Komponisten eigens Kompositionen für bedeutende und kassenträchtige Spielfilme, zu deren Uraufführungen nicht selten Prominente aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft erschienen. Exponenten der Film-Komponisten waren Giuseppe Becce, Paul Dessau, Hans Erdmann, Gottfried Huppertz, Franz Lehár, Edmund Meisel und Willy Schmidt-Gentner, um nur einige zu nennen (Birett, Stummfilmmusik). Erdmann betreute im Reichsfilmblatt (RFB) die regelmäßig erscheinende Rubrik «Filmmusik». Becce gründete 1921 die Zeitschrift Kino-Musik-Blatt, später Ton-Film-Musik, aus der sich mehrere Beispiele für Kompositionen von Slapstickfilmen entnehmen lassen. Gemeinsam mit Ludwig Brav legten Erdmann und Becce 1927 das zweiteilige Werk Allgemeines Handbuch der Film-Musik vor. Im ersten Teil beschäftigt es sich mit Theorie und Praxis der Filmmusik, während der zweite Teil ein thematisches Skalenregister enthält, mit dessen Hilfe sich Filme nach Stimmungen und Situationen mit kompositorischen Versatzstücken live untermalen ließen. 2020 ist es unverändert wiederaufgelegt worden. Diese Art musikalischer Bearbeitung von Stummfilmen war allerdings schon aus Kostengründen nicht der Standard. In Kinos rund um die Welt wurden Orchester zum Beispiel durch die elektrisch-pneumatische Wurlitzer Kino-Orgel ersetzt, die The Mighty Wurlitzer genannt wurde. Sie war mit vielen Klangregistern, einem Effektregister und einem chromatischen Schlagwerk ausgestattet, sodass sich zur Musik die beliebten Geräuscheffekte einspielen ließen. Einer der bekanntesten Kino-Organisten ist Gaylord Carter, der seine Karriere in der Stummfilmzeit begann. Es gab außerdem das Orchestrion-artige elektrisch-pneumatische Klavier namens Fotoplayer. Der Fotoplayer konnte wie eine Violine oder Orgel klingen, und auch mit ihm ließen sich per Handzug oder Pedale Schlagzeuggeräusche und Toneffekte erzeugen. Je kleiner die Vorführungsstätte und weniger bedeutend die Filme, desto sparsamer fiel die Live-Musik aus. Entweder bestritt sie ein Kintopp-Pianist zusammen mit einem Stehgeiger oder allein. Wenn die Musiker nicht kamen oder verhindert waren, konnte man sich mit einem Harmonium oder einem elektrischen, selbst spielenden Klavier behelfen. Zuweilen wurde auch ein krächzendes Grammophon eingesetzt, das freilich nicht synchron auf den Film abgestimmt werden konnte. In den USA hatte man gegen Ende der Stummfilmzeit die so genannten Vitaphone-Platten mit vorproduzierter Musik und Geräuscheffekten entwickelt. Sie konnten einigermaßen synchron zu den Filmen abgespielt werden.
Slapstickfilme aus der Stummfilmzeit wurden mit einer höheren Bildzahl pro Sekunde abgespielt, als sie gedreht worden waren. Das steigerte den komischen Effekt. Eine Unart war freilich, dass Kinobesitzer ab Anfang der 1920er-Jahre vor allem Filme des Beiprogramms, zu dem Slapstickfilme gehörten, mit einer entschieden zu hohen Geschwindigkeit vorführten. Auf diese Weise ließen sich rund um den Hauptfilm mehr Filme unterbringen als bei der Konkurrenz, die die Streifen mit normaler Geschwindigkeit abspielte. Es ging also darum, Zuschauer mit einem umfangreicheren Programm anzulocken (RFB Nr. 39 vom 25. September 1925, S. 81). Stummfilme, zumal solche aus der Frühzeit, wurden in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedreht, in den 1920er-Jahren stieg die Bildanzahl pro Sekunde auf bis zu 29 Bilder. Die richtige Vorführgeschwindigkeit variierte also von Film zu Film (Sudendorf, «Variationen der Geschwindigkeit»). War ein Film zum Beispiel mit 16 bis 18 Bildern pro Sekunde aufgenommen worden, ließ er sich mit einer Geschwindigkeit bis zu 24 Bildern pro Sekunde vorführen. Damit konnte man etwaiges Flimmern verhindern und immer noch eine adäquate Wiedergabe gewährleisten. Wenn Kinobetreiber jedoch die Vorführgeschwindigkeit auf bis zu 40 Bilder pro Sekunde heraufschraubten, verfälschte das den Film und erschwerte zudem das Lesen der Zwischentitel. Kinomusiker fühlten sich durch die Manipulationen gehetzt und in ihrer künstlerischen Tätigkeit beeinträchtigt. Das führte zum Streit mit Betreibern von Lichtspieltheatern (RFB Nr. 35 vom 1. September 1928, S. 32). «Selbst bei einer amerikanischen Groteske darf der Film nicht wie ein Geisterschatten über die Bildwand rasen», war eine der Forderungen gegen diese Art Missbrauch (RFB Nr. 1 vom 5. Januar 1929, S. 14). Aber auch abendfüllende Spielfilme wie Fritz Langs DR. MABUSE, DER SPIELER TEIL 1 (1922) waren betroffen. Bei dessen Uraufführung beklagte man sich über «das schnelle Abrollen der zahlreichen, z. T. recht ausführlichen [Zwischen]Titel» (RFB Nr. 17 vom 13. Mai 1922, S. 19). 1928 erwog die Münchner Polizeidirektion, Vorschriften zur Normierung des Vorführ-Tempos zu erlassen. Umgehend protestierten sowohl der Reichsverband Deutscher Lichtspiel-Theaterbesitzer e. V. als auch die Spitzenorganisation der Deutschen Filmindustrie e. V. (RFB Nr. 2 vom 14. Januar 1928, S. 10). Um das Problem abzuwiegeln, verwiesen einige darauf, in Ungarn führe man Filme sogar mit einer Geschwindigkeit bis zu 80 Bildern pro Sekunde vor (RFB Nr. 4 vom 28. Januar 1928, S. 21). Es wurde eine Limitierung auf 28 bis 30 Bilder pro Sekunde ins Gespräch gebracht, Film-Pionier Oskar Messter machte sich für eine Normierung auf 24 Bilder pro Sekunde durch technische Vorkehrungen stark. Das favorisierte auch die Münchner Polizeidirektion (RFB Nr. 3 und 4 vom 21. und 28. Januar, S. 35 bzw. S. 21, und Nr. 5 vom 4. Februar 1928, S. 23). Offenbar wurde dies aufgegriffen, denn das Thema kam danach zur Ruhe.