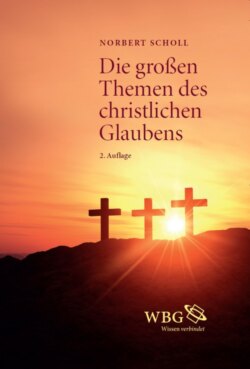Читать книгу Die großen Themen des christlichen Glaubens - Norbert Scholl - Страница 46
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gängige christliche Verkündigung
ОглавлениеNicht zuletzt kommen noch Probleme hinzu, die aus der Art und Weise der kirchlichen Gottesverkündigung und dem „christentümlichen“ Gottesbild selbst erwachsen. Nur zwei seien hier besonders hervorgehoben.
Die Rede vom „allmächtigen“ Herrscher-Gott
Viele Gläubige stellten (und stellen) sich Gott vor als absoluten Herrscher, „der alles so herrlich regieret.“ Der alles kann, was er will, und der alles regiert und beherrscht, wie es ihm gefällt; Gott ist „allmächtig“. Diese göttliche „Eigenschaft“ wird bezeichnenderweise als einzige im Glaubensbekenntnis erwähnt, und das gleich zweimal. Es hat den Anschein, als ob das Wichtigste von dem, was die Bibel von Gott zu erzählen weiß, seine (All-)Macht wäre. Das mag vielleicht für manche Abschnitte der Schrift zutreffen – etwa für die Erzählungen von der machtvollen Errettung des Volkes aus ägyptischer Knechtschaft oder für die Bezeugung der Hoffnung auf den endgültigen Sieg Gottes über alle widergöttlichen Mächte in der Offenbarung des Johannes.18 Dieses herrschaftliche Gottesbild trägt unverkennbar Züge, die frühere Generationen ihrem eigenen Erfahrungsbereich über den Umgang mit Kaisern und Königen entlehnt haben. Heute, unter anderen politischen Umständen und in einer anderen, demokratischen Gesellschaftsordnung ist diese Gottesvorstellung im Verschwinden begriffen. Solange es noch Könige und Kaiser, Despoten und Monarchen jeder Art gab, forderten diese Herren eine Projektion ihres Herrschergebarens auf Gott geradezu heraus. Wenn Menschen einen (absolutistischen) Monarchen erlebten, der ihr Leben bis ins Detail bestimmte und nahezu uneingeschränkte Verfügungsmacht, ja sogar Leibeigenschaft über sie besaß, so konnten sie sich den obersten aller Herren, den Herr der Herren, nur unter jenem Bild vorstellen, nun aber nochmals gesteigert als „allmächtiger“ Herrscher. Ängste und Hoffnungen, Befürchtungen und Erwartungen, die Menschen gegenüber weltlichen Alleinherrschern hegten, übertrugen sie auf den „Allerhöchsten“.
Geschichtskundige Menschen erinnern sich noch, dass in einer noch gar nicht so lange zurückliegenden Vergangenheit manche weltlichen und geistlichen Herrscher ihre Stellung als „gott-gegeben“ betrachteten, dass sie sich unter dem besonderen Schutz der (göttlichen) „Vorsehung“ wähnten. Gottesbild und Herrscherbild samt den daraus abgeleiteten Praktiken beeinflussten und verstärkten sich gegenseitig.
Der Psychologe von Gagern äußert den „Verdacht, dass das Pochen auf die Allmacht Gottes, wie wir das so gelernt haben, an Seinem Wesen vorbeidenkt. Was wäre denn, wenn wir verzichten würden auf diese Hilfskonstruktionen eines Allmächtigen? Ist Gott nicht der ganz Einfache? Ganz einfachen, schlichten Herzen zugänglich? Er ist in allem Guten gegenwärtig und erfahrbar. Ist denn das nicht richtig, wenn wir singen: ‚Wo die Güte, wo die Liebe, da ist Gott‘? Ja, da geschieht Gott. Da kann Er sein und wirken. Wenn wir gut sind, dann machen wir Raum für Ihn. In uns.“19
Die christlichen Kirchen sollten sich wieder mehr auf die biblische Rede von Gott besinnen und auf die „Eigenschaften“, die ihm dort zugeschrieben werden. Gott wird im Alten wie im Neuen Testament mit einem gütigen Vater verglichen (Ps 106,1; 107,1; 118,29; Jer 33,11/Mt 20,15; Lk 6,35). Die Menschen werden aufgerufen, barmherzig zu sein, wie auch Gott barmherzig ist (Ex 34,6/Lk 6,36). Die Liebe Gottes zu seinem Volk wird erwähnt (Dtn 33,3/1 Joh 4,8). Seine Gerechtigkeit wird gepriesen (Ps 9,9; Tob 3,2/Joh 17,25). Seine Weisheit wird bewundert (Ps 104,24/Röm 16,27). Warum finden diese biblischen Attribute Gottes in der Liturgie und in kirchlichen Dokumenten keine oder nur wenig Verwendung? Warum werden sie nicht ins Credo aufgenommen?
Einen Versuch, den Begriff „Allmacht“ zu rechtfertigen bzw. neu zu justieren, macht der Bonner Theologe Hans-Joachim Höhn. Freilich unterscheidet auch er zuerst Gott und Welt strikt voneinander. „Wir müssen Gott mit einer Welt zusammen denken, die ohne Gott gedacht werden will“, lautet seine paradox anmutende Schlussfolgerung. Das kann geschehen, wenn man der Frage nachgeht: Warum ist überhaupt etwas und nicht nichts? Dass es die Welt und den Menschen gibt, ist nicht einfach selbstverständlich. Das Nichts kann das Dasein nicht begründen – „aus nichts wird nichts“. Darum muss es ein Prinzip geben, das den Unterschied von Sein und Nichts zugunsten des Daseins begründet: Gott. Denn die Welt selbst kann wegen ihrer grundsätzlichen Endlichkeit nicht der Grund für ihr eigenes Dasein sein. Höhn glaubt, damit die „Allmacht“ Gottes retten zu können: Indem Gott zwischen Sein und Nichts zugunsten des Daseins unterscheidet und die Welt in ihre Freiheit freigibt, zeigt sich seine Allmacht, so Höhn. Ansonsten aber kann – und muss – die Welt völlig aus sich selbst heraus verstanden werden. Es geht in einem aufgeklärten und zeitgemäßen Glauben darum, Gott um seiner selbst willen anzuerkennen – ohne jede andere Notwendigkeit.20
Die Rede vom Schöpfer-Gott
Weniger neurotisierend, sondern wohl eher die intellektuelle Redlichkeit in Frage stellend ist das Bild des kosmologischen Schöpfer-Gottes. Sein Zustandekommen hängt mit unserem Naturerleben zusammen. Die Natur gibt dem Menschen Rätsel auf, die er nicht zu lösen vermag. In Naturkatastrophen, aber auch in weniger spektakulären Ereignissen (Missernten, Gewitter, Frost, Erdbeben, Überflutungen u.a.) erfährt der Mensch sein Unvermögen trotz aller technischen Fortschritte. Um sich die Natur wenigstens einigermaßen griffig zu machen, begannen die Menschen in früheren Zeiten, menschliche Eigenschaften in sie hineinzuprojizieren, die sie aber gleichzeitig so überhöhten, dass der Natur übermenschliche (= göttliche) Kräfte zukamen.
Sigmund Freud schildert diesen Vorgang und die daraus resultierenden Konsequenzen: „An die unpersönlichen Kräfte und Schicksale kann man nicht heran, sie bleiben ewig fremd. Aber wenn in den Elementen Leidenschaften toben wie in der eigenen Seele, wenn selbst der Tod nichts Spontanes ist, sondern die Gewalttat eines bösen Willens, wenn man überall in der Natur Wesen um sich hat, wie man sie aus der eigenen Gesellschaft kennt, dann atmet man auf, fühlt sich heimisch im Unheimlichen, kann seine sinnlose Angst psychisch bearbeiten. Man ist vielleicht noch wehrlos, aber nicht mehr hilflos gelähmt, man kann zum mindesten reagieren, ja vielleicht ist man nicht einmal wehrlos, man kann gegen diese gewalttätigen Übermenschen draußen die selben Mittel in Anwendung bringen, deren man sich in seiner Gesellschaft bedient, kann versuchen, sie zu beschwören, beschwichtigen, bestechen, raubt ihnen durch solche Beeinflussung einen Teil ihrer Macht … (Allerdings) macht der Mensch die Naturkräfte nicht einfach zu Menschen, mit denen er wie mit seinesgleichen verkehren kann, das würde auch dem überwältigenden Eindruck nicht gerecht werden, den er von ihnen hat, sondern er gibt ihnen Vatercharakter, macht sie zu Göttern.“21
In unseren Breiten kommt heute sicher niemand mehr auf die Idee, die Natur zu vergöttlichen. Die moderne Naturwissenschaft hat den Menschen heute ein anderes Verhältnis zur Natur gegeben. Die fortschreitende Technisierung hat manche Probleme bewältigt und sie befähigt, die Naturkräfte zu zähmen und sich dienstbar zu machen. Die kosmologische Gottesvorstellung verliert innerhalb der christlichen Kirchen mehr und mehr an Bedeutung – wenigstens theoretisch. Denn noch immer halten sich, von den Kirchen durchaus gefördert, Reste von Brauchtümern, die auf diesem Gottesbild beruhen.
Karl Rahner, einer der bedeutendsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts (1903–1983), sagte in seinem letzten berühmten Vortrag über die „Erfahrungen eines katholischen Theologen“ wenige Wochen vor seinem Tod:
„Wir reden von Gott, von seiner Existenz, von seiner Persönlichkeit, von drei Personen in Gott, von seiner Freiheit, seinem uns verpflichtenden Willen und so fort. […] Aber bei diesen Reden vergessen wir dann meistens, dass eine solche Zusage immer nur dann einigermaßen legitim von Gott ausgesagt werden kann, wenn wir sie gleichzeitig auch immer wieder zurücknehmen, die unheimliche Schwebe zwischen Ja und Nein als den wahren und einzigen festen Punkt unseres Erkennens aushalten und so unsere Aussagen immer auch hineinfallen lassen in die schweigende Unbegreiflichkeit Gottes selber.“22