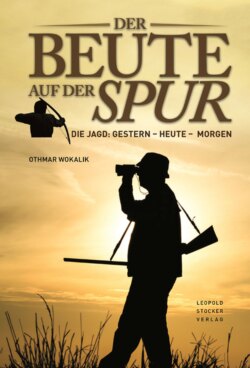Читать книгу Der Beute auf der Spur - Othmar Wokalik - Страница 10
ОглавлениеDas Altertum
Die Bedeutung des Wildes im Alten Orient
Auf einer Grabinschrift in Sakkara, Ägypten (6. Dynastie, 2325–2155 v. Chr.), wird der Besitzstand eines reichen Ägypters mit 3.898 Rindern, 1.135 Gazellen, 1.308 Säbel- und 1.244 Mendesantilopen angegeben; noch ein knappes Jahrtausend später berichtet der assyrische König Tiglat-pileser I. (ca. 1114–1076 v. Chr.), der Eroberer Babylons:
Herden von Gazellen, Hirschen, Steinböcken, Antilopen … ließen sie mich in hochragenden Waldgebirgen in Netzen fangen. Ich brachte Herden davon zusammen und zählte ihre Zahl wie die Herden von Schafen. 4 Elefanten fing ich lebendig.16
In der Wissenschaft als „Revolution“ bezeichnet, weist die Entwicklung der Massentierhaltung aber – sachlich gesehen – alle Kriterien einer Evolution auf. Und auch die kulturellen (Jagdkult) und intellektuellen (Jagdtechniken, Jagdwaffen) Leistungen verschmolzen nach einem langen Nebeneinander zu einer Einheit.
1958 gelang, wie bereits erwähnt, dem englischen Archäologen James Mellaart mit der Freilegung einer Tempelanlage und Wohnstatt in Anatolien ein sensationeller und überdies aufschlussreicher Fund mit kultischen Jagddarstellungen aus der Zeit um 5800 v. Chr. Die Tempelanlage war den Jägern und Kriegern geweiht; Jagd und Krieg wurden hier als heilige Einheit gesehen. Der gefährliche Leopard, aber auch der Wildstier als Herr der Herde, hatte einem höheren Wesen, der Göttin Ischtar zu dienen. Sie, die Kriegs-, Himmels- und Liebesgöttin, wurde in Mesopotamien stets in Begleitung von Leoparden oder Löwen dargestellt. Das Ischtar-Tor, ein Juwel altorientalischer Baukunst, zählt zu den hervorragendsten Leistungen der Künstler und Handwerker Babylons.
Jäger- oder Löwenjagd-Palette aus der Zeit der ägyptischen Negade-Kultur (um 3250–3100 v. Chr.), British Museum/London (Bild: Jon Bodsworth): Dieses Paletten gehören zu den frühesten Beispielen reliefgeschmückter Prunkpaletten dieses Stils.
Die heiligen Tiere des Alten Orients waren nicht nur Symbol der Gottheit, sondern auch Sinnbild des Schutzes der Herden vor Dämonen und Raubwild. Der Löwe galt als Dämon, der zu bezwingen und zu töten war, um das Böse zu bannen und Unheil abzuwehren. Diese Schutzfunktion in Jagd und im Krieg hatte allen voran der König wahrzunehmen.
Mit der Heiligung der Jagd erlangte das zweckorientierte, magische Ritual der Urzeit religiösen Charakter; das Ritual wurde zum Ritus; Jagd und Religion gingen eine Symbiose ein.
Babylonier, Sumerer und Assyrer
Wie in Ägypten der Nil, so waren es in Mesopotamien der Euphrat und der Tigris, die das Entstehen dicht bevölkerter Großstädte ermöglichten. Die Gründung des altägyptischen wie auch des babylonischen Weltreiches erfolgte etwa 4000 Jahre v. Chr. Es waren riesige Bewässerungsanlagen und die Urbarmachung des Bodens, die zur Bildung der ersten großen Gemeinschaftsstaaten der Menschen führten. Während Ägypten eine Zweiteilung des Landes unter der Doppelkrone der Pharaonen verhinderte, sind die Versuche, eine einheitliche Herrschaft im Zwischenstromland zu errichten, gescheitert. Die jeweiligen Sieger in den zahlreichen Kämpfen vermochten nur selten das Gesicht der altbabylonischen Kultur zu formen. Unabhängig vom politischen Geschehen haben sich unterschiedliche Religionen, Künste, Sitten und Bräuche durchgesetzt. Bis heute bietet das Zwischenstromland ein Bild wahrhaft babylonischer Verwirrung und demgemäß vielfältig sind die Beiträge der einzelnen Kulturen, wie sie in der Art der Jagdausübung sichtbar werden.
Zu den ältesten schriftlichen und bildlichen Quellen, die uns über Jäger und Jagd berichten, zählen die der Sumerer, der Assyrer und der Babylonier. Sie geben jagdhistorisch die Jagd der Völker wieder, keinen Prototypus des mesopotamischen Raumes.
Im Alten Testament (Gen 10,9) wird uns von König Nimrod, dem Begründer des Babylonischen Reiches und sagenhaften Erbauer des Babylonischen Turmes, berichtet. Er, „ein tüchtiger Jäger vor dem Herrn“, wird hier auch als kongenialer Gründer einer Vielzahl von Städten, wie etwa Ninive und Kelach, geschildert. Nach einer anderen Version wird Nebukadnezar II. für den Erbauer des Babylonischen Turmes gehalten; was die Jagd betrifft, gilt aber Nimrod bis heute als Sinnbild der Jagd im Neubabylonischen Reich und – sprichwörtlich – als der „gewaltige“ Jäger. Da zur Zeit Nebukadnezar II. das Jagdwild zwischen Euphrat und Tigris bis auf einen geringen Bestand dezimiert war, sind berechtigte Zweifel an der Darstellung Nimrods als Sinnbild der Jagd im Neubabylonischen Reich angebracht.
Aus den noch erhaltenen Trümmern des riesigen Palastes von Assurbanipal II. (883–859 v. Chr.), dem assyrischen König, wurde unter anderem eine Bibliothek mit ca. 20.000 in Keilschrift abgefassten Tafeln samt prachtvollen Reliefs aus Alabaster zu Tage befördert, die allesamt von der Löwenjagd erzählen. Die Assyrer, die nicht den hohen Stand der babylonischen Kultur erreichten, von dieser aber die Schrift und auch deren künstlerische Ausdrucksformen und vieles andere übernommen haben, hinterließen uns mit diesen hervorragenden Darstellungen der Löwenjagd ein beredtes Beispiel für die schon erwähnten kulturellen Wechselwirkungen im mesopotamischen Raum. Der Palast des Großkönigs stand in Kalchu (auch Kalach), der Hauptstadt des Reiches. Die Reliefs zeigen die damals typischen Jagdmethoden; ihre jagdhistorisch-geistesgeschichtliche Bedeutung liegt aber darin, dass in ihnen die der Jagdausübung übergeordnete Maxime eine bildliche Darstellung erfährt; danach gewährt der König nicht nur Schutz vor menschlichen Feinden, sondern auch vor „feindlichem“ Raubwild. Ähnliche Darstellungen finden sich auch in der frühsumerischen Kunst, in der die Schutzfunktion allerdings dem Hirten zukommt, also dem Jäger ohne königliche Insignien. Diese Schutzfunktion aber bestimmte das gesamte Weltbild des altorientalischen Menschen, nachdem dieser sesshaft, d. h. Ackerbauer und Viehzüchter, geworden war.
Der Kampf des Königs (Hirten) wurde zu einem Symbol des Schutzes schlechthin. In den Stadtstaaten Mesopotamiens hatten die Worte Herrscher und König die gleiche Bedeutung wie das Wort Hirte. Die Jagd wurde hier gewissermaßen Teil einer Staatsdoktrin; sie bildete in den Königreichen Mesopotamiens eine untrennbare Einheit mit der staatlichen Ordnung, wie dies der Herde-Hirte-König-Terminologie zu entnehmen ist. In ihr manifestiert sich die bedingungslose Unterordnung von Mensch und Tier (Herde) unter den Hirten und den Herrscher und König, der als von den Göttern berufen und ausersehen verstanden wurde. Die vielen überkommenen Darstellungen der königlichen Jagden auf den Löwen, das Krokodil, die Wildstiere etc. sind unter diesen Aspekten zu sehen. Überall kämpft der König gegen wilde Tiere und Feinde des Landes.
Aber noch ein anderer Gesichtspunkt ist zu berücksichtigen. Neben den zahlreichen Darstellungen des Königs und des Hirten bei der Jagd auf den Löwen aus dem frühsumerischen, hethitischen und assyrischen Raum wurden auch eine ganze Reihe von zeremoniellen Jagd- und Fütterungsszenen von Priesterfürsten gefunden, die nur als symbolische, feierliche Handlungen, aber gleichzeitig auch als Fürsorge (Hege?) und Betreuung des Wildes zu deuten sind. Hier zeichnet sich der Beginn eines Machtkampfes zwischen dem Priesteramt und jenem des Königs ab. Das königliche Jagdprivileg und die Schutzfunktion des Königs auf der einen Seite, mit der das Töten etwa des „feindlichen“ Löwen verbunden war, und die kontradiktorischen, zeremoniellen Darstellungen dieses priesterlichen Jagdkultes andererseits spiegeln diesen Kampf zwischen König und Priester wider.
Assyrisches Reich: Königliche Löwenjagd, Nordpalast in Ninive ; 645–635 v. Chr. (Britisches Museum, London)
Exkurs: Jagd und Krieg bei den altorientalischen Völkern
Jagd und Krieg bildeten eine Einheit im Denken und Fühlen der altorientalischen Völker. Aber nicht nur im fernen China, auch in Europa waren Jagd und Krieg engstens verbunden; bis in die jüngste Vergangenheit. Staatslenkung, Krieg und Jagd zählten zu den am häufigsten ausgeübten Tätigkeiten des Adels. Diese Konstellation schon am Beginn geordneter Geschichtsschreibung samt ihren bildlichen Darstellungen erinnert an die Diagnose des griechischen Historikers und Staatslenkers Polybios, der als Verfasser einer Weltgeschichte hervortrat. Er vertrat die Auffassung, dass das monarchische Prinzip so tief in der menschlichen Psyche verankert sei, dass es auf Dauer nicht ausgeschaltet werden könne; Demokratie und Republik hingegen seien nur kürzere, manchmal längere Zwischenspiele. Tatsächlich blieb die Jagd über weite Strecken in der Hand der Aristokratie; erst mit der Französischen Revolution wurde dieses Adelsprivileg aufgehoben.