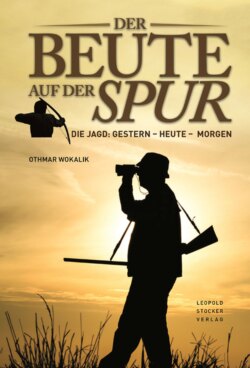Читать книгу Der Beute auf der Spur - Othmar Wokalik - Страница 9
Die „neolithische“ oder „agrarische Revolution“ Von der Jagd zur Domestikation
ОглавлениеWährend einer Zeitspanne von mehr als 1,5 Millionen Jahren durchstreiften die Horden und Sippen der Jäger und Sammler Bergtäler, Savannen und Wälder, um Wild zu erbeuten und damit ihren Nahrungsbedarf zu decken. Man geht heute davon aus, dass etwa 5 km2 Jagdgebiet erforderlich waren, um damals auch nur einen Menschen zu ernähren.
Allmählich gingen die Jägergruppen – besonders jene der ältesten Hochkulturen des Alten Orients – dazu über, nicht alle bejagten Tiere zu töten; sie begannen mehr und mehr junge Tiere zu fangen, um diese erst in Notzeiten dem Verzehr zuzuführen.
Ähnliche Methoden wurden noch im 19. Jahrhundert von den Beduinen Arabiens angewendet, um „lebende Fleischreserven“ vorrätig zu halten. In relativ kurzer Zeit schon hatten sich die gefangenen Jungtiere ihrer zugewiesenen Umgebung angepasst und suchten selbstständig ihr Futter. Auf diese Weise bildeten die Jägernomaden des Vorderen Orients die ersten halbzahmen Herden und wurden schließlich deren Hirten.
Aufgrund von Sichelklingen und Reibsteinen aus einem oberägyptischen Jägerlager (Toshka), mit denen Wildgetreide bearbeitet wurde, sowie zahlreichen Knochenresten von Antilopen und Gazellen, die offensichtlich in Gefangenschaft gehalten worden waren, ist davon auszugehen, dass die „Jagdtierhaltung“, letztlich verbunden mit dem Anbau von Getreide, in der Zeit von 13.000 bis 14.000 Jahren v. Chr. begonnen hat.
Das Alter der in Toshka gefundenen Arbeitsgeräte und Knochenreste rechtfertigt diese Annahme.
Dabei handelte es sich allerdings nicht um eine zielgerichtete Haustierhaltung nach heutigem Sprachgebrauch; diese begann erst, als Wildfänge in der Gefangenschaft durch zielgerichtete Züchtung vermehrt wurden. Gleichzeitig zu dieser neuen Produktionsform – sie wird als „neolithische“ (jungsteinzeitliche) oder „agrarische Revolution“ bezeichnet – entwickelte sich eine exklusive Form des Privatbesitzes. Die gezähmten Herden gingen in den Privatbesitz des Hirten, d. h. immer eines Mannes, über, nie in den Besitz einer Frau.
Der Wechsel von der okkupatorischen Wirtschaft der Jäger und Sammler zur Produktionswirtschaft des Ackerbauern und Viehzüchters ist – wie erwähnt – nicht nur an sich, sondern auch in seinem zeitlichen Kontext durch das Fundmaterial aus Vorderasien belegt. In diese Zeit fallen auch die ersten bislang bekannten Wildparks der Welt. Archäologische Grabungen am Tigris legten eine Fläche von 50 km2 frei, die als Wildgehege diente. Das für die Tiere nötige Frischwasser wurde über künstliche Kanäle zugeführt. Diese Wildparks waren nicht allein Nahrungsreserve; sie bildeten gleichzeitig ein Jagdreservat, auf das assyrische wie babylonische Könige gerne zurückgriffen, wenn sie großangelegte Jagden veranstalteten.
Die bildliche Darstellung einer solchen Jagd findet sich auf einem Relief aus Ninive; das Relief zeigt eine Rotwildjagd aus der Zeit des Königs Assurbanipal (669 bis ca. 627 v. Chr.). Jagdhistorisch interessant – man denke an die eingestellten Jagden des 18. und 19. Jahrhunderts im europäischen Raum – sind die auf dem Relief sichtbaren hohen Netze, die ein Ausbrechen des Wildes verhindern sollten.
Die Domestikation des Wildes beschränkte sich nicht auf eine profane „Vorratshaltung“, sondern diente auch kultischen Zwecken. Darstellungen und Funde belegen, dass in den Tempeln Indiens und Sumers zahlreiche Antilopen, Gazellen, Elefanten, aber auch Tiger und diverse Vögel in heiligen Hainen gehalten und dortselbst auch verehrt wurden.
1958 entdeckte der englische Archäologe James Mellaart (1925–2012) in Çatal Höyük (Anatolien) einen ausgedehnten Siedlungshügel mit Tempel. Die aus dem Tempel zutage geförderten Jagddarstellungen aus der Zeit um 5800 v. Chr. zeigen unter anderem einen Leopardenfries und eine Darstellung der „Göttin im Leopardenfell“, ein Indiz dafür, dass der Tempel den Jägern und Kriegern geweiht war.
Aufgrund diverser Funde in jungpaläolithischen Jägerstationen der Ukraine und in Sibirien ist davon auszugehen, dass auch Wölfe domestiziert und als Begleiter des Jägers eingesetzt wurden. Allerdings war der „Wolfshund“, im Gegensatz zu bisher vertretenen Thesen, nicht das älteste Haustier des Menschen.
Nicht nur Funde in der Türkei aus der Zeit um 9500 v. Chr. sowie in Idaho/USA mit Funden aus der Zeit um 9000 v. Chr., die auf Hundehaltung schließen lassen, weisen darauf hin, dass Jagdhunde in Höhlensiedlungen um 8000 v. Chr. als Spür- und Wachhunde eingesetzt wurden; es handelte sich hier um „Moorhunde“, die auch „Torfspitze“ genannt wurden.
Diese Bezeichnung hat nicht die Bedeutung einer rassischen Zuordnung; Versuche, frühgeschichtliche Hundefossilien rassisch einzuordnen, sind relativ alt. Rütimeyer bezeichnete 1861 den in Schweizer Pfahlbausiedlungen des Neolithikums gefundenen „Torfspitz“ als canis palustris, was bei wörtlicher Übersetzung aus dem Lateinischen Pfahl- oder Sumpfhund bedeutet. Aus dem ägyptischen Theben am Oberen Nil sind Elfenbeinschnitzereien aus der Zeit zwischen 4400 und 4000 v. Chr. überliefert, auf denen typische Laufhunde dargestellt sind. Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft ist anzunehmen, dass dieser Laufhund (Sloughi) der Stammvater aller Jagd- und Hirtenhunde ist. Die These, wonach der Einsatz von Bracken erstmals bei den Kelten erfolgte, hat sich als unrichtig erwiesen; bereits bei den Phönikern sind verschiedene Laufhunde mit langen Behängen nachgewiesen. Im mesopotamischen Raum hingegen – ganz besonders in Babylon – waren die gewaltigen Molosser Doggen die Jagdhunde schlechthin; verständlich, galt doch die Jagd auf den Löwen als die attraktivste und begehrteste im Babylonischen Reich.
Die Folgen der „neolithischen Revolution“, also die Mutation vom Sammler und Jäger zum Viehzüchter großen Stils, machte den Hund zum steten Begleiter des Menschen.