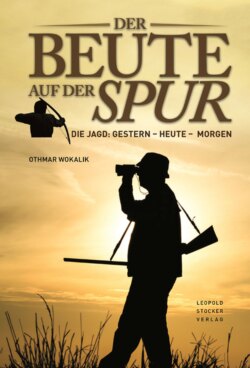Читать книгу Der Beute auf der Spur - Othmar Wokalik - Страница 16
Brot und Spiele: Mensch und Tier im antiken Rom
ОглавлениеZweifelsohne war die Jagd den Griechen ein Anliegen, denn die Legenden über das Wesen und den Sinn der Jagd wurden im Volk von Mund zu Mund tradiert. Andererseits aber fehlen Aufzeichnungen über die Art und Weise ihres Jagens und auch über die Menge des erbeuteten Wildes (Streckenergebnisse), wie sie aus dem alten Orient, besonders aus Mesopotamien, teilweise auch aus China, erhalten sind.
Im antiken Rom hatte die Jagd in freier Natur eine nur geringe Bedeutung.21 Mehr wissen wir von den im Zuge der Gladiatorenspiele veranstalteten Kampfjagden der Römer. Die Jagd außerhalb der Arena war im Gegensatz zu den altorientalischen und fernöstlichen Jagdgepflogenheiten jedenfalls einer strafferen rechtlichen Regelung und Positionierung im römischen Rechtssystem unterworfen; die Ausübung der Jagd selbst war im alten Rom frei; es bestanden keine Staatsaufsicht und keine zeitlichen Beschränkungen; auch keine Schonzeiten, keine besonders geschützten Wildarten und keine Reglementierung hinsichtlich der bei der Jagd eingesetzten Hilfsmittel. Die einzige aus der Antike überlieferte Einschränkung finden wir nicht bei den Römern, sondern bei den alten Griechen; im Umkreis der Stadt Athen nämlich war die Nachtjagd verboten, womit eine Ausrottung des Wildes durch gewerbsmäßige Wildbretlieferanten (Fleischmacher) verhindert werden sollte. Die Jagd der Römer galt als ein Aneignungsrecht, das jedem römischen Bürger zustand. Mit vollendeter Okkupation erwarb er das Eigentum am erlegten Wild, welches als herrenlose Sache (res nullius) galt.
Der Sklave, dem keine Rechtssubjektivität zukam, konnte demgemäß die Okkupation nur für seinen Herrn vornehmen. Dem Schutz des Grundeigentümers wurde durch das ihm zustehende ius prohibendi, ne quis ingrederetur Rechnung getragen, d. h., dass er kraft seines Einspruchsrechtes jeder fremden Person das Betreten seines Grundstückes und damit jede jagdliche Betätigung auf diesem verwehren konnte. Nach herrschender Ansicht beinhaltete dieses Prohibitionsrecht aber kein subjektives Jagdrecht des Grundeigentümers; soll heißen, dass der Jäger wohl auf das Prohibitionsrecht des Grundeigentümers stieß (also zurückgewiesen werden konnte); der Eigentumserwerb an der Beute aber in keiner Weise bedenklich war. Der Begriff des Wilddiebes war dem Römischen Recht unbekannt.
Nach anderer Meinung wird das Prohibitionsrecht als ausschließliches Jagdrecht des Grundbesitzers gesehen und das Wild als zu den Früchten dieses Grundstückes gehörend. Klar war die Rechtslage bei Jagdgehegen (roboraria, vivaria und leporaria), die ausschließlich von deren (Großgrund-)Besitzern benutzt werden durften. Die Jagd als Betätigung der Oberschichten in diesen Gehegen war juristisch von der Jagd in freier Landschaft abgekoppelt. Die im Gehege lebenden Tiere waren keine Jagdobjekte; sie hatten – in einem umzäunten Raum lebend – ihre Freiheit verloren und waren in den Besitz eines Einzelnen, d. h. des Halters des Geheges, übergegangen: Die Okkupation galt damit als beendet.22
Römisches Mosaik, die jagende Diana darstellend, ausgegraben in Utica, Hauptstadt der römischen Provinz Africa, 2. Jh. n. Chr.
Vom eingehegten Wild zu unterscheiden waren die Tiere in eingefriedeten Wäldern (insilvis circum saeptis) die als im Zustand der Freiheit lebend angesehen wurden.
Um sich die Gunst der Masse zu erhalten, gingen die Mächtigen Roms in zunehmendem Maße dazu über, diese durch Brot und Spiele zu erwerben oder zu erhalten; eine bis heute gebräuchliche Vorgangsweise. Das Mittel dazu waren die Zirkusspiele, unter denen sich – nebst unzähligen anderen Darbietungen – besonders die Tierhetzen und Kampfjagden großer Beliebtheit erfreuten. Sie fanden in dem zwischen den Hügeln des Aventin und Palatin gelegenen, 600 m langen und 200 m breiten Circus Maximus statt. Diese Arena bot in der endgültigen Ausgestaltung 255.000 marmorne Sitzplätze. Die Dauer der Spiele wurde von ursprünglich einem Tag nach und nach auf 14 Tage ausgedehnt. Die Römer jagten (Lebendfang) Raubtiere und Elefanten überwiegend für den Zirkus, um im Kampf mit ihnen ihre Männlichkeit zu beweisen. Am Stiftungstag des Diana-Tempels, dem 13. August, war es auch Sklaven gestattet, als Zuseher an den Ereignissen im Circus Maximus teilzunehmen; ein Feiertag für Sklaven. Man unterschied Kampfjagden der Gladiatoren mit wilden Tieren und Tierkämpfe, etwa zwischen einem Nashorn und einem Elefanten, einem wilden Stier und einem Tiger oder einem Bären und einem Büffel. War dieser Teil der Spiele vorbei, so verwandelte man den Schauplatz in einen künstlichen Wald, in dem man bemüht war, tunlichst aufregende Jagden zu inszenieren, wobei die „jagenden Gladiatoren“, mit Spieß und Bogen bewaffnet, von einer Hundemeute begleitet wurden. Anstelle dieses verwegenen Spiels mit Leoparden, Tigern, Bären und Stieren hat man gelegentlich auch Herden von Antilopen und Giraffen in die Arena getrieben und dort mit Pfeilen und Lanzen erlegt. Unter den Flaviern wurde das heutzutage weltweit bekannte Kolosseum, ein vier Stockwerke hoher Ovalbau, für 50.000 Menschen erbaut. Das mit allen technischen Raffinessen ausgestattete Bauwerk bot auch die Möglichkeit zur Aufführung der beim Publikum äußerst beliebten Naumachien, d. h. von Seeschlachten, zumal die Arena wasserdicht gemacht und mithilfe eines raffinierten Kanalisationssystems innerhalb kurzer Zeit mit Wasser gefüllt werden konnte. In den Kellern des Kolosseums wiederum befanden sich die Gehege und Stallungen für die Tierhaltung.
Die Ausbildung der Kämpfer für die Kampfjagden erfolgte in zwei Gladiatorenschulen, die sich in Capua und Ravenna befanden. In diesen Schulen wurden auch Gladiatoren für den Einzelkampf gegen gefährliche Tiergattungen, die bestiarii, ausgebildet. Einem Bericht des römischen Historikers Titus Livius (59 v. Chr. bis 17 n. Chr.) zufolge wurden bei Kampfspielen in der Zeit des ersten römischen Kaisers Augustus insgesamt 10.000 Gladiatoren eingesetzt und 3.500 afrikanische Wildtiere getötet.
Interessant ist ein Bericht von Plinius (Offizier, Flottenkommandant, Staatsbeamter, Historiker und Schriftsteller), der in seiner „Naturalis historia“ (Naturkunde), einer Enzyklopädie in 37 Büchern, darüber berichtet, dass bei diesen Kampfspielen auch Elche aus den Waldgebirgen der „Barbaren“ nach Italien geholt wurden.
Auch Julius Caesar berichtet in seinem allen ehemaligen Lateinschülern bekannten Buch „De bello gallico“ (V. Buch) Einzelheiten über die Begegnungen mit Elchen und die Fangmethoden, wie sie ihm von den Einwohnern geschildert wurden.
Die Armee war unter anderem damit beauftragt, während ihrer Feldzüge auch wilde Tiere für die Schaukämpfe in Rom zu „requirieren“. Der griechische Geograph und Historiker Strabon (etwa 64/63 v. Chr. bis um 20 n. Chr.) berichtet in seinen Reiseaufzeichnungen von römischen Expeditionen nach Zentralafrika und in die arabische Wüste, von Entdeckungsreisen auf dem Atlantik bis hin zu den Kanarischen Inseln und in den Nordatlantik hinein.
Daneben gab es den lanista, einen Manager, Unternehmer und Fechtmeister zur Ausbildung der Gladiatoren, der auch mit der Beschaffung wilder Tiere befasst war. Der rege Handel mit Großtieren aus aller Herren Länder war ein einträgliches Gewerbe.
Ebenso begehrt, weil einträglich, war auch der Beruf des magistros, des Tierfängers und Wärters, mussten die Tiere doch (lebend) nach Rom gebracht werden. Der hohe Bedarf an Wildtieren hatte letztlich aber deren gebietsweise Ausrottung zur Folge. Der Berberlöwe Nordwestafrikas, dessen Heimat das heutige Algerien und Mauretanien war, wurde das erste Opfer dieses Massenbedarfes. Das gleiche Schicksal ereilte bald dem Nordafrikanischen Elefanten (Atlaselefant). Ab ca. 58 v. Chr. wurden in Rom schließlich auch Flusspferde bei Kampfspielen eingesetzt.
Für das Fangen der Tiere bediente man sich überwiegend der Fallgrube, die – soweit es um den Fang von Raubkatzen ging – mit Ziegen oder Schafen als lebende Kirrung versehen wurde. Daneben gab es verschiedene Fangmethoden mit Netzen und Tüchern. Die Kenntnisse der Wildtierhaltung waren damals sehr ausgeprägt; die Tiere wurden mit schnellen Ruderschiffen transportiert. Nach Plinius war es ein Römer namens Lupinus, der als Erster eine transportgerechte Wildtierfütterung eingeführt hat.
Für die Fütterung der Wildtiere und deren Haltung in den Zwingern des Kolosseums war erfahrenes Jagdpersonal erforderlich; es bestand sowohl in Rom als auch in Griechenland aus Berufsjägern (venatores), die in einem eigenen Berufsverband organisiert waren.
Erst im 6. Jahrhundert wurden die Kampfjagden durch Kaiser Anastasius (491–518) unter Androhung von Strafen verboten. Das Einfangen und Töten von Löwen wurde schon in der späteren Kaiserzeit untersagt. Im Folgenden einige Beispiele zu Anlass, Ausmaß sowie Zahl und Art der eingesetzten Tiere:
• Circensische Spiele der Aedilen Scipio Nasica und Publius Lentulus, 168 v. Chr.: 63 Panther, 40 Bären und (die Zahl ist unbekannt) Elefanten;
• Circus des Censors Gnaeus D. Ahenobarbus: 100 Bären gegen 100 Jäger;
• Kampfspiele im Circus des Consuls Pompejus (106–48 v. Chr.): über 600 Löwen. Besonderheit: Kampf eines Nashornes gegen einen Elefanten;
• Sieg über die Thraker (106 n. Chr.) durch Kaiser Trajan (98–117 n. Chr.): 10.000 als Gladiatoren eingesetzte Gefangene töten über 11.000 wilde Tiere;
• Kaiser Philippus Arabs (244–249 n. Chr.) bringt aus dem Feldzug gegen die Perser 32 Elefanten, 10 Elche, 10 Tiger, 30 Leoparden, 60 Löwen und 40 Wildpferde für eine Kampfjagd nach Rom mit.
Den sozialen und geistesgeschichtlichen Nährboden, auf dem diese Metzeleien gedeihen konnten, beschreibt Theodor Mommsen folgendermaßen: „Wie bei den furchtbaren ökonomischen Zuständen die sozialen Verhältnisse sich gestalten mussten, ist im Allgemeinen leicht zu ermessen. Die Steigerung des Raffinements, der Preise, des Ekels und der Leere im besonderen zu verfolgen“, ist
weder erfreulich noch lehrreich. Verschwendung und sinnlicher Genuss war die Losung überall bei den Parvenüs so gut wie bei den Liciniern und Metellern; nicht der feine Luxus gedieh, der die Blüte der Zivilisation ist, sondern derjenige, der in der verkommenden hellenischen Zivilisation Kleinasiens und Alexandrias sich entwickelt hatte, der alles Schöne und Bedeutende zur Dekoration entadelte und auf den Genuss studierte, mit einer mühseligen Pedanterie, einer zopfigen Tüftelei, die ihm den sinnlich wie dem geistig frischen Menschen gleich ekelhaft macht. Was die Volksfeste anlangt, so wurde, durch einen von Gnacus Aufidius beantragten Bürgerschluss, die in der catonischen Zeit untersagte Einfuhr überseeischer Bestien wieder gestattet, wodurch denn die Tierhetzen in schwunghaften Betrieb kamen und ein Hauptstück der Bürgerfeste wurden.23
Diese Schilderung eines Großen der europäischen Geschichtsschreibung ist von bleibender Aktualität.
Für den Hundehalter und somit auch den Jäger erwähnenswert ist die Tatsache, dass auch Hunde für das Gemetzel in der Arena eingesetzt wurden. Dabei handelte es sich um mächtige Kampfhunde, die für den Einsatz gegen Mensch und Tier systematisch gezüchtet wurden24, nicht verwunderlich war es doch Xenophon (430–350 v. Chr.), der berühmte Schüler des Sokrates und Zeitgenosse Platons, der erstmals ein Buch über Zucht und Dressur des Hundes verfasste und nach dem heutigen Stand der Wissenschaft als „Stammvater“ aller Kynologen gilt. Sein Leitfaden für den Hundefreund erlebte noch im Mittelalter unter dem Titel „Kynagiticus“ eine Neuauflage.25
Bei den Haustieren im Allgemeinen wurden im Römischen Reich schon die ersten Nutzrassen gezielt herangezüchtet. Der Hund als Jagdgehilfe hatte bei den Römern wohl nicht die Bedeutung wie dies heutzutage der Fall ist; in den ländlichen Bereichen aber wurden bei Hetzjagden Wind-, Stöber- und in der Meute jagende Hunde eingesetzt (Ziemen).