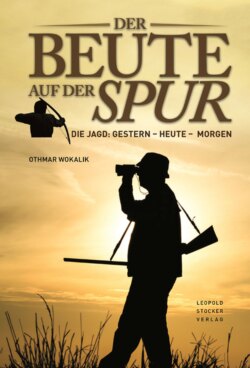Читать книгу Der Beute auf der Spur - Othmar Wokalik - Страница 13
Die Jagd im Alten Ägypten
ОглавлениеMit Ägypten betreten wir den Boden, auf dem eine der bedeutendsten Kulturen des Altertums, ja unseres Globus’ herangewachsen ist. Die Geschichte dieser Kultur am Nil reicht bis in das 4. Jahrtausend v. Chr. zurück. Aufgrund diverser Funde ist aber anzunehmen, dass die Entwicklung dieser Kultur schon Ende des 5. Jahrtausends v. Chr. einsetzte. Ausgehend von den Anfängen der auf Schriftquellen beruhenden geschichtlichen Überlieferung im Alten Orient, zählt das 4. Jahrtausend nicht zum Altertum, wird aber als Zeit des Übergangs zur Vorgeschichte von der Lehre akzeptiert. Über diese Zeit berichten uns Felszeichnungen, die Tausende Kilometer westlich vom klassischen Siedlungsraum der Altägypter am Nil, nämlich in der westlichen Sahara, entdeckt wurden. Nicht zuletzt aufgrund dieser Felszeichnungen weiß man, dass die Sahara ursprünglich über weite Flächen von Strömen durchzogen und mit Grünland bedeckt gewesen war, dessen fortschreitende Austrocknung ca. Ende des 5. Jahrtausends v. Chr. das Einsetzen der Wüstenbildung zur Folge hatte.
Damit begann die allmähliche Entvölkerung dieses Siedlungsraumes auf der Suche nach Wasser und ertragreichen Böden. In dem noch dicht bewachsenen „Tal des großen Stromes“ (Nil) mit seinen unzähligen Verästelungen fanden die Ägypter der Frühzeit den Ersatz für ihr ursprüngliches Siedlungsgebiet. Das Tal des Stromes versprach reichen Ertrag, weil die jährlichen Überschwemmungen die vermissten Niederschläge ersetzten und die vom Nil mitgeführten Senkstoffe das Land stets neu düngten.
Auf einer in der Westsahara gefundenen Felszeichnung lassen sich mehrere Epochen unterscheiden; die ältesten, die Mammuts darstellen, stammen noch aus der Steinzeit. Das Mammut und die anderen dargestellten Wildtiere untermauern die These von der grünen Sahara. Ob die mit Speer und Schild abgebildete Figur einen Jäger zeigt, ist wohl nicht einwandfrei zu klären, kann aber aufgrund der dargestellten Wildtiere angenommen werden.
Infolge der erhaltenen schriftlichen und bildlichen Dokumente aus der Geschichte Ägyptens lässt sich die Tradition der Jagd bis in die Zeit des Alten Reiches (2600–2190 v. Chr.) zurückverfolgen. Neben dem Vorrecht der Pharaonen, Nilpferde und Wildstiere zu jagen, zeigen uns bildliche Darstellungen in den Kult- und Opferkammern der Aristokraten und hohen Beamten dieser Zeit, dass sie vor allem der Jagd auf Flugwild und dem Fischfang, besonders in dem an Üppigkeit in Flora und Fauna kaum zu überbietenden Nildelta, ergeben waren.
Die Treibjagd auf Großwild ist ebenso wie die Verwendung von Fallen ebenfalls bereits für das Alte Reich nachgewiesen. Auf den schon erwähnten Felszeichnungen aus der Sahara und denen, die am Nil gefunden wurden, sind Szenen der Fallenjagd dargestellt. Besonders häufig wurden Trittfallen zum Einsatz gebracht. Eine aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. stammende, in Oberägypten (Nechen) gefundene Wandmalerei zeigt eine kranzförmig angelegte Falle, in der sich Antilopen gefangen haben.
Bei der Jagd auf Flugwild in der weiten Sumpflandschaft des Nildeltas bediente man sich verschiedener Lockvögel. Hier lagen, wie erwähnt, die bevorzugten Jagdreviere der Ägypter. Fische und Nilpferde wurden aus dem Boot harpuniert. Die Boote waren aus Papyruspflanzen gefertigt, einem damals wichtigen Faserrohrstoff, der auch als unentbehrliches Schreibmaterial Verwendung fand. Die Jagd auf Vogel und Fisch war im Alten, teilweise auch im Mittleren Reich, ein Privileg des Herrschers, welcher der Marschengöttin Sechmet als der Herrin der Jagd und somit der Herrin des Vogel- und Fischfanges diente.
Die aufwendigen Jagden der Höflinge und hohen Beamten fanden sehr oft in Begleitung ihrer Frauen und Kinder, stets aber unter Mithilfe ihrer Bediensteten statt. Die Vögel wurden in ihren Nestern und auch während der Brutzeit erlegt oder, nachdem sie von abgerichteten kleinen Raubtieren, wie Ginsterkatzen oder Ichneumonen (Schleichkatzen), aufgescheucht worden waren, mit dem Wurfholz erbeutet, was eine beachtliche Fertigkeit in der Handhabe dieses Gerätes erforderte.
Beim Fang mit dem Netz kamen sowohl Wurfnetze als auch Stellnetze zum Einsatz. Die ebenso naturgetreuen wie eindrucksvollen Darstellungen von aus dem Papyrusdickicht abstreichenden Wildgänsen und Enten gehören zu den schönsten Tierdarstellungen in der altägyptischen Kunst. Es waren überwiegend Nilgänse, Grau- und Blässgänse, verschiedene Reiherarten, Löffler, Blässhühner, Spießenten und Rotkopfenten, die im üppigen Nildelta bejagt wurden. Die Wildente wurde anfänglich kaum bejagt; erst relativ spät, d. h. seit der 12. Dynastie (200 v. Chr.), wird häufig von der Jagd auf Enten berichtet.
Auch die Domestikation von Wildtieren, wie sie ab der 5. Dynastie überliefert ist, ebenso wie die Anlage von Tiergärten etwa ab der Zeit um 1500 v. Chr., waren in Ägypten üblich. Von einem Geflügelhof vor ca. 4.500 Jahren berichtet uns ein Kalksteinrelief (5. Dynastie). Das Relief zeigt, dass dort Kraniche und Wildgänse gehalten und gefüttert wurden. Aus den in der Nähe des Tempels Deir el-Bahari ausgegrabenen, umfassenden bildlichen Darstellungen und Berichten wissen wir, dass die Königin Hadschepsut um 1500 v. Chr. einen Tiergarten anlegen ließ, in welchem nicht nur heimische Tierarten, sondern auch Großwild aus Nordafrika und indische Elefanten gehalten wurden. Damit war die verlässliche Versorgung des Königshauses nicht nur mit Wildgeflügel, sondern auch mit Wildbret gewährleistet.
Erwiesen ist damit aber auch eine erstaunliche infrastrukturelle Transportkapazität, handelt es sich doch bei diesen Tieren um Großwild, welches aus weitentlegenen Weltgegenden (Indien) importiert wurde.
Die Jagd auf Großwild war bis zu Beginn der 18. Dynastie (1555–1330 v. Chr.) infolge der gänzlichen Ausrottung der Wildbestände im nordafrikanischen Steppengebiet – die beliebten Nilpferdjagden ausgenommen – so gut wie unbekannt. Erst auf ihren ausgedehnten vorderasiatischen Kriegs- und Jagdzügen wurden die Ägypter mit den Jagdmethoden der assyrischen Könige auf Großwild vertraut.
Ein für die Jagdgeschichte einmaliger archäologischer Fund waren in diesem Zusammenhang 350 Tontafeln in babylonischer Keilschrift in der Ruinenlandschaft von Tell el-Amarna aus der Zeit um ca. 1350 v. Chr. Auf diesen Tontafeln in der vormaligen Residenz des Pharao Amenophis IV. finden sich umfangreiche Berichte über die Jagderfolge des Pharao. Aus einem dieser Berichte geht hervor, dass Thutmosis III. in der Steppe von Niya bei einer seiner Jagden die unvorstellbare Menge von 120 Elefanten erlegt habe, wenn der Bericht zutreffend ist. Ein solcher Jagderfolg war wohl nur aufgrund der Teilnahme von Adeligen und/oder Kriegern an dieser Jagd möglich geworden.
Auch die Löwenjagd findet in dieser Zeit häufig Erwähnung, so in Form einer Abbildung auf einer Truhe aus der Grabausstattung des Königs Tutanchamun (1347–1338 v. Chr.). Von den hier dargestellten acht Löwen hat der junge Pharao bereits sieben tödlich verwundet, während er auf den achten, einen flüchtigen Löwen, mit dem Bogen zielt.
Auf einem Skarabäus aus dieser Periode wird berichtet, dass König Amenophis III. innerhalb eines Dezenniums 102 Löwen gestreckt habe. Aus einem weiteren Bericht erfahren wir, dass es dem König gelungen sei, in nur vier Tagen aus einer Herde von 170 Wildstieren insgesamt 96 zu erlegen. Nach dem Vorbild der Perser gingen die Ägypter infolge der gewaltigen Ausdehnung ihres Herrschaftsbereiches – wie die Assyrer und Griechen auch – dazu über, Elefanten in großer Zahl einzufangen, zu zähmen und die Tiere sodann als Jagd- und Kriegselefanten, aber auch als Last- und Zugtiere einzusetzen.
Vom persischen Großkönig wird unter anderem berichtet, dass er über eine Herde von 9.000 Elefanten verfügte; die Elefanten wurden von den indischen Hilfstruppen gestellt und waren zur Zeit Alexander des Großen eine „Revolution“ in der Geschichte des Jagd- und Kriegswesens.
Unter dem ägyptischen König Ptolemaios II. (283–247 v. Chr.) wurde der Lebendfang von Elefanten im Großen betrieben. Die gefangenen Tiere wurden vorwiegend aus Äthiopien auf speziell hierfür konstruierten Elefantenbooten über das Rote Meer nach Ägypten gebracht.
Davon abgesehen war Elfenbein nach und nach zur Handelsware geworden, was schließlich dazu führte, dass der Elefant in Äthiopien, Libyen, Mauretanien, besonders aber in Nordafrika und Vorderasien, ausgerottet wurde. Das gleiche Schicksal erlitten – wenn auch nicht aus kommerziellen Gründen – der europäische Löwe in Griechenland und der Berberlöwe in Nordafrika. Das Ausmaß der erhaltenen schriftlichen Aufzeichnungen und bildlichen Darstellungen der Ägypter zeigt, dass die Jagd in diesem alten Kulturraum jedenfalls eine überragende, wenn auch andere Bedeutung als bei den Sumerern, Assyrern und Babyloniern hatte.
Bei vordergründiger Betrachtung der schriftlichen, bildlichen und steinernen Zeugen ist ein Unterschied zwischen dem Jagdverständnis der verschiedenen Völker des Alten Orients nicht auszumachen. Bei näherer Untersuchung gibt es Indizien, die auf eine unterschiedliche, ja grundsätzlich andere Sichtweise der alten Ägypter hinweisen. Zum einen war das Jagen auf Großwild – von den Nilpferdjagden abgesehen – über weite Strecken der ägyptischen Geschichte unbekannt; und auch diese Jagd wurde letztlich aus Sicherheitsgründen dem Personal überlassen; die Nobilität nahm daran nur mehr als Zuseher teil und die Löwenjagd hatte in Ägypten bei Weitem nicht die Bedeutung wie in Assur und Babylon. Außerdem wurde der Löwe offensichtlich nicht als ein mit allen Mitteln zu bekämpfender Feind gesehen. Zu den Beständen des Museo Egizio in Turin gehört eine Statuette aus Sandstein (ca. 1140 v. Chr.) aus dem Neuen Reich (20. Dynastie), eine Königsplastik, die den König in schreitender Pose zeigt, während er mit der linken Hand einen gefangenen Libyer am Haarschopf gepackt hält. Zwischen den Beinen des gefangenen Libyers ist ein Löwe als begleitendes Jagdtier des Königs dargestellt. Die Aussage dieses Sujets, den König als Überwinder der Feinde zu präsentieren, hatte, wie erinnerlich, bei den altorientalischen Völkern seit dem Beginn ihrer Geschichte Tradition.
Die Besonderheit dieser Rundplastik besteht aber darin, dass der Löwe den vom König am Schopf gehaltenen Libyer frontal angreift und in den linken Oberschenkel beißt; er kämpft also auf der Seite seines Herrn, des Königs, gegen den Feind. Die Aussage dieser Rundplastik steht im krassen Widerspruch zu dem Feindbild „Löwe“ bei den Babyloniern und Assyrern, der als Feind der Herden mit allen Mitteln zu bekämpfen und zu vernichten war.
Die ägyptischen Herrscher kamen, wie erwähnt, erst wieder in der 18. Dynastie im Zuge ihrer ausgedehnten Kriegs- und Jagdzüge nach Vorderasien mit den Jagdmethoden der assyrischen Könige und damit besonders mit der Löwenjagd in Berührung. Eine Ausnahme in der Jagd der Ägypter, die für ihre Leidenschaft für die Jagd auf Flugwild bekannt waren, war die absolute Schonung des Ibis, des Mondvogels der Ägypter, der als heilig galt. „Ägypten wäre verloren, wenn es nicht von den Ibissen beschützt würde“, schreibt Claudius Aelian18 (um 200 v. Chr.). Bei den beliebten Vogeljagden in den Papyrussümpfen durfte dieser schöne, schneeweiße Vogel nicht bejagt, geschweige denn getötet werden. Er genoss im ganzen Land Verehrung. Seine vorsätzliche Tötung wurde mit Todesstrafe geahndet. Dem Mondgott Thot geweiht, wurde er besonders in Hermopolis, der Stadt, in welcher der Mondgott die Ortsgottheit verkörperte, zum Symbol der heiligen Tiere des ganzen Landes.
Bemerkenswert ist der Umstand, dass der ibisköpfige Gott Thot im Alten Reich als das Sinnbild der Schrift, des Kalenders, der Zeitrechnung, besonders aber der Weisheit und des Herzens galt. Der Ibis wurde in vielen Tempeln gehalten und letztlich auch nach allen Regeln der Kunst mumifiziert, wobei man ihm durch Einziehen des Kopfes und des Halses eine herzförmige Gestalt verlieh. In vielen Quellen der antiken Literatur ist davon die Rede, dass er jede Menge von Insekten, von der Heuschrecke bis zum Skorpion, aber auch Schlangen vertilgte.
Im Grab des Pharaos Imhotep (3. Dynastie) in der Stadt Sakkara wurden Tausende Ibis-Mumien gefunden. In Hermopolis wurden Gräbergänge freigelegt, in denen Ibis-Mumien in rund vier Millionen Tonkrügen beigesetzt waren. Auch in anderen Tempeln entdeckte man umfangreiche Ibis-Friedhöfe. Es wird vermutet, dass die zahlreichen Ibisse in den diversen Tempeln der Städte die vielen Abfälle der Fisch- und Fleischläden beseitigt und damit der Sauberkeit und Hygiene einen veritablen Dienst erwiesen haben; nicht zuletzt darauf und wegen der Vertilgung von Heuschrecken und Skorpionen dürfte die große Verehrung dieses Vogels im ganzen Land zurückzuführen sein.
Wenn im Spätsommer die ersten Ibisse in Unterägypten auftauchten, galt dies als Zeichen für die nahende Überschwemmung und damit die Anlieferung des fruchtbaren Nilschlammes. Der Ibis war der zentrale Gegenstand beim Fest der Wasserweihe. Der Priesterschaft des Alten Ägypten war es zu verdanken, dass die Ibisse als heilige Vögel im ganzen Land absoluten Schutz genossen. Wo Ibisse schöpften, galt das Wasser als absolut rein. Mit diesem Wasser pflegten sich die ägyptischen Priester denn auch mit Vorliebe zu waschen.
Unvereinbar mit der Behandlung, die man diesem Vogel angedeihen ließ, sowie den mit seiner Gegenwart verbundenen Vorstellungen war allerdings die Ansicht, dass das Fleisch des Vogels giftig sei; lediglich die Leber wurde bei seinem Hinscheiden als Opfergabe verwendet.
Der religiöse Machtkampf der Priesterschaft, der den Sturz der alten Götterbilder zum Ziel hatte, führte zur völligen Ausrottung des Vogels. Als eine neue Priesterschaft die Macht errungen hatte, beseitigte sie auch den alten Mythos der Ibis-Priester (Mittleres Reich), was zur gezielten Vernichtung der Ibis-Bestände führte. Die Bevölkerung wurde mit dem Hinweis darauf, dass die Eier des Ibisses todbringendes Gift enthielten, aufgefordert, sämtliche Gelege zu zerstören. Man verbreitete das Gerücht, dass aus den Ibis-Eiern Basilisken kämen, deren Blick tödlich sei. Diese Kampagne machte sich eine, damals in weiten Teilen Ägyptens grassierende und gefürchtete Augenkrankheit, eine chronische Bindehautentzündung, zunutze. Tatsächlich war diese Krankheit nach den Rekonstruktionen der ärztlichen Wissenschaft unserer Tage auf eine kleine Mücke, die „Kriebelmücke“, zurückzuführen. Sie war die Überträgerin von kleinen, parasitären Fadenwürmern. Die Krankheit führte beim Betroffenen über kurz oder lang zur Erblindung.
Geistesgeschichtlich interessant ist die Art und Weise, wie die Priesterschaft es zuwege brachte, die Bevölkerung ohne Beeinträchtigung ihres Ansehens zur systematischen Vernichtung dieses Vogels zu verleiten; man hielt nach wie vor an dem radikalen Verbot, den Ibis zu töten, fest, propagierte aber, wie erwähnt, die Zerstörung sämtlicher Gelege, was notgedrungen die Ausrottung des Vogels zur Folge hatte. Man denkt hier unwillkürlich an mediale zeitgenössische Manipulationen.
Die Verehrung des Ibisses in Ägypten ist keine bloße Reminiszenz. Heilige Tiere sind auch in unserer Gegenwart, besonders in den ostasiatischen Ländern, besonders im Buddhismus und ebenso im Hinduismus, präsent. Mythische Legenden bestimmen hier die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Besonders die 2.500 Jahre alte Lehre Buddhas fordert – allerdings aus ethischen Gründen – die Verehrung heiliger Tiere, wie etwa von Rindern und Gazellen.
Während Jagd und Krieg im mesopotamischen Raum eine letzten Endes religiös überhöhte, staatsdoktrinäre Symbiose eingegangen sind, mit dem Leitgedanken, die Feinde des Reiches – dazu zählten eben auch bestimmte Tiergattungen – zu bekämpfen, fehlt Ähnliches in der altägyptischen Kultur. Eine als Feind klassifizierte Wildart, die es unter Einsatz militärischer Mittel zu bekämpfen galt, wie dies im mesopotamischen Raum der Fall war (Löwe u. a.), kannten die Ägypter nicht.