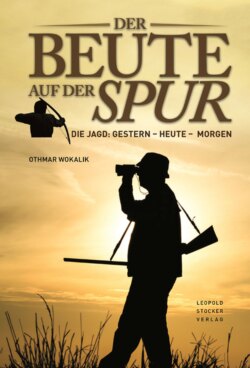Читать книгу Der Beute auf der Spur - Othmar Wokalik - Страница 20
ОглавлениеIm „Kompromissfrieden“ des Kallias (449 v. Chr.) blieben die ionischen Küstenstädte zwar unter der persischen Oberhoheit, aber die Ägäis und zum Teil die Küste Kleinasiens waren für die persisch-phönikische Flotte gesperrt. Die Handelsbeziehungen zwischen dem Abendland und Persien blieben aber trotz politisch-militärischer Turbulenzen intakt. Selbst unter den Sassaniden (3.–7. Jh. n. Chr.) und auch unter der Herrschaft der arabischen Kalifen waren die hochwertigen Produkte der Metallkunst aus Persien eine begehrte Handelsware; vorrangiges Thema dieser Handwerkskunst war nach wie vor die Jagd. Die Darstellungen der Jagdszenen zeigten eine andersartige künstlerische Gestaltung als die assyrischen und altägyptischen. Ihr vorrangiges Thema war die Löwenjagd, besonders aus der Zeit Schapurs II. Der Iran ist dieser altpersischen Tradition des Metallhandwerkes bis heute treu geblieben, wie auf der Jagdweltausstellung 1971 zu sehen war. Dieses altpersische Kunsthandwerk mit seinem Zentrum Damaskus überdauerte auch die Eroberungen der Kalifen von Bagdad (7.–11. Jh. n. Chr.). Im Jahre 635 erstürmten die Araber Damaskus; es wurde ein Zentrum der Waffenschmiedekunst. Damaszener Dolche und Degen waren und sind infolge ihrer hervorragenden Verbindung von Härte und Elastizität weltberühmt und Wunschtraum vieler Jäger und Sammler. Das Einlegen von Edelmetalldrähten ergab prunkvolle Jagdwaffen, deren Schönheit durch Tauschierung noch erheblich gesteigert wurde. Griffe, Schäfte und auch Beschläge waren mit Juwelen und Edelsteinen zusätzlich verziert. Diese prunkvollen Waffen waren als repräsentatives Geschenk in aller Welt gefragt.
Importiert wurde im Zuge dieser umfangreichen europäisch-fernöstlichen Handelsbeziehungen auch das Wissen um die Verwendung des Pferdes bei der Jagd, eine Jagdpraxis, die damals in Persien einen seltenen Höhepunkt erreicht hatte. Die bei den Persern und Arabern perfektionierte Kunst, reitend zu jagen, diente als Vorbild der frühmittelalterlichen Jagd in Europa.
Die persischen Großkönige („Herrscher über alle Menschen vom Anfang bis zum Untergang der Sonne“) und ihre Prunkjagden wurden zu Lehrmeistern der höfischen Jagd. Besonders die schon erwähnten Achämenidenkönige Kambyses und Kyros sahen in der Jagd – ähnlich den Babyloniern und Assyrern – nicht nur ein Vergnügen, sondern auch eine Vorübung für den Krieg. Bei den persischen Prunk-Treibjagden kamen 7.000 bis 8.000 Menschen zum Einsatz, deren Aufgabe es war, das Wild von weit her zusammenzutreiben; es waren dies vermutlich die größten Treibjagden in der Geschichte der Jagd.
In großen Wildparks mit einer genau reglementierten Wald- und Jagdwirtschaft wurden Rehe, Hirsche, Sauen, Wildesel und Antilopen in großer Zahl gehalten. Aufgabe des Personals war überwiegend die Hege der Wildtiere bis zum Beginn der Hofjagden. In eigenen Baumschulen wurden fremdländische Pflanzen kultiviert, damit die Tiere über dementsprechende und ausreichende Äsung verfügten.
Die Begleiter des Großkönigs waren mit Speer, Säbel sowie Pfeil und Bogen bewaffnet. Die Jagd begann, sobald der König den ersten Schuss abgegeben hatte. Das Wild wurde überwiegend im Reiten mit Pfeil und Bogen erlegt.
Diese kurze Reminiszenz zeigt den nicht unerheblichen östlichen bis fernöstlichen kulturellen und eben auch jagdkulturellen Einfluss auf das europäische frühe Mittelalter. Die Anfänge des Mittelalters, die Frühperiode, begannen mit der Gründung des Frankenreiches unter den Merowingern, einer Sippe der salischen Franken (842–911 n. Chr.). Sie war die bedeutendste und folgenschwerste Reichsgründung der Germanen, die sich in der Folge als die belebende Kraft, sowohl der germanischen wie auch der abendländischen Geschichte, erwies.
Das Jagdrecht im frühen Mittelalter
Was das (germanische) Jagdrecht im frühen Mittelalter anbelangt, stehen einander zwei Lehrmeinungen gegenüber. Die eine, ältere, betrachtet das Jagdrecht als Ausfluss des Grundeigentums, d. h. als Zubehör von Grund und Boden; die jüngere Theorie gelangt zu dem Ergebnis, das Jagdrecht der germanischen Stämme sei mindestens bis zur Institutionalisierung von Bannforsten ein Recht auf freien Tierfang gewesen.
Vor allem Lindner, der sich am ausführlichsten mit den Quellen des germanischen Jagdrechtes auseinandergesetzt hat, kommt zu dem Ergebnis, dass im frühen Mittelalter grundsätzlich freier Tierfang geherrscht habe.29 Dietze definiert den Rechtsstandpunkt eindeutig, wenn er sagt: Bei den Germanen herrschte ursprünglich freie Pirsch in den Marken und auf dem eigenen Grundbesitz.30
Die gravierendste Phase in der Entwicklung des frühmittelalterlichen Jagdrechtes war die Inforestation und die Jagdregalität im fränkischen Rechtskreis. Sie ist gekennzeichnet durch die Entstehung und Verbreitung der Bannforste, die bis zum Beginn der Neuzeit das Fundament der jagdrechtlichen Entwicklung wurden; ihre fortgesetzte Ausdehnung war das Kriterium des frühmittelalterlichen Jagdrechtes schlechthin. Die erstarkte königliche Zentralgewalt und das Feudalsystem der merowingischen und karolingischen Dynastien bestimmte das Imperium zwischen der Nord- und der Ostsee einerseits und der Apenninenhalbinsel im Süden andererseits; darüber hinaus auch das Gebiet zwischen Theiss im Osten und dem Ebro im Westen.
Das Erstarken der königlichen Zentralgewalt begann im 6. Jahrhundert; die jeweiligen Herrscher waren bestrebt, sich in allen Belangen der Jagd eine Sonderstellung zu verschaffen. Ab dem 7. Jahrhundert war es im Gegensatz zum altgermanischen Volksrecht nur den Mitgliedern der königlichen Familie gestattet, die Jagd in bestimmten Bezirken auszuüben.
Die Rechtsentwicklung
Die am Ende des Mittelalters weit fortgeschrittene Feudalisierung der Jagd hatte für die subjektive Jagdberechtigung weitreichende Folgen. An sich umfasst jedes Recht begrifflich auch die Befugnis, es auszuüben. Das bedeutet im konkreten Fall, das ein jeder Rechtsinhaber im Rahmen der objektiven Normen jagen darf; ein Umstand, der ab dem „Hochmittelalter“ und auch noch Jahrhunderte danach aber nicht zum Tragen kam; der Feudalismus entzog der freien Pirsch und dem freien Tierfang im wahrsten Sinne des Wortes nach und nach den Boden. Die immer weitere Ausdehnung der Bannbezirke ging Hand in Hand mit der Entwicklung des Lehenswesens, das den Unterschied zwischen Obereigentum des Lehensgebers und Untereigentum des Lehensnehmers schuf, wobei dem Lehens- und Gerichtsherrn neben Zinsen und Abgaben auch das Jagdrecht verblieb; zumeist als Abgeltung dafür, dass er dem Belehnten den Kriegsdienst abnahm. Durch das Wormser Konkordat erhielt schließlich auch die Hohe Geistlichkeit eine selbstständige Jagdberechtigung.
Mit dem Zerfall der absoluten Gewalt, über die Karl der Große noch verfügte, und der damit verbundenen Dezentralisierung ging das Recht, Bannforste zu errichten, als Hoheitsrecht vom Kaiser auf die Landesherren über. Das Recht des Wildbannes wurde als ein unabdingbarer Anspruch auf die Ausübung der Jagd im ganzen jeweiligen Hoheitsgebiet definiert.
Dieser Modifikation des Jagdrechtes verdanken wir ein für das europäische Waidwerk signifikantes Kulturgut, nämlich – die Waidmannssprache. Sie entwickelte sich allmählich und simultan zur Installierung der zunächst königlichen, sodann landesherrlichen Jagdhoheit. Aus den höfischen Jagdhelfern des Königs, später der Landesherren, die mit der Vorbereitung der groß angelegten königlichen (landesherrlichen) Jagden betraut waren, entwickelten sich allmählich Berufsjäger mit ausgeprägtem Standesbewusstsein, die sich zunehmend einer berufsadäquaten Sprache bedienten. Ein Teil dieses waidmännischen Sprachschatzes war schon zur Zeit des freien Tierfanges als Bestandteil der Gemeinsprache üblich; bei den Germanen galt das Recht der freien Pirsch und des freien Tierfanges; jedermann jagte. Soweit die neuere Lehrmeinung.