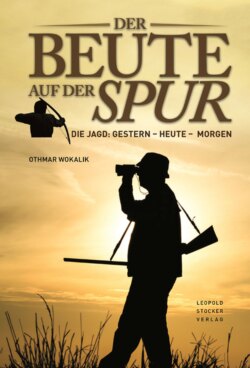Читать книгу Der Beute auf der Spur - Othmar Wokalik - Страница 17
Exkurs: Das Tier als göttlicher Begleiter
ОглавлениеDas Tier als Begleiter der Götter spielte in der Antike sowohl in Symbolik und Heraldik als auch in der Mythologie und Religion eine exponierte Rolle: In Griechenland gehörten der Adler zu Zeus, die Biene zu Demeter, die Bärin zu Artemis – und bei den Germanen gehörte das Pferd zu Thor und zu Wotan. Man denke auch an die Wölfe Roms und den Adler Deutschlands als Wappentier. Romulus, der sagenhafte Gründer Roms, und sein Bruder Remus wurden von einer Wölfin gesäugt. Die Schlange, das den Menschen fremdeste Tier, das am wenigsten begreifliche, zählt zugleich auch zu den gefürchtetsten; ihr Gift tötet. In der Genesis wird sie verflucht „unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes und dazu verdammt, Staub zu fressen“ (Gen 3,14). Andererseits aber wird sie als Heilszeichen hoch verehrt; die Gnostik sah in ihr ein Christussymbol. Ihr ehernes Nachbild heilte die vom tödlichen Schlangenbiss Verwundeten (Num 21,8 f.). Die gekrönte Schlange und auch der kaiserliche Drache Chinas vermitteln die gleiche Heilssymbolik. Auch im alten Indien hatte das Schlangensymbol große Bedeutung.
Drei ineinandergewundene Fische wiederum waren schon während des Mittelalters das Symbol für die Dreieinigkeit. Tieren mit übermenschlichen Kräften, wie etwa Stiere, Löwen, Elefanten, wurden und werden im asiatischen Raum göttliche Ehren zuteil; sie treten auch als kosmische Symbole in Erscheinung.
Weitverbreitet ist auch die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren und diese Unterscheidung ist vielfach identisch mit der Unterscheidung von Haustieren und Tieren der (unreinen) Wildnis (Alfons Kirchgässner).
Am Grundsätzlichen dieser in Bild und Stein sichtbar gewordenen Beziehung zwischen Mensch und Tier hat sich wenig geändert, „denn das Tier ist uns immer noch zu nahe, als dass wir nicht geheimnisvolle Gemeinsamkeiten mit ihm verspürten“, und deshalb gehört nach Ortega y Gasset
zum guten Jäger eine Unruhe im Gewissen angesichts des Todes, den er dem bezaubernden Tier bringt. Damit ist nichts gegen die Jagd gesagt, sondern in diesem Gefühl der Unsicherheit leuchtet der allgemeine, problematische, zweideutige Charakter unserer Beziehung zu den Tieren durch.26
Die Existenz wissenschaftlicher Disziplinen wie der Tierpsychologie und der Tiersoziologie sind einmal mehr der – unserer Gegenwart gemäße – Versuch, das Tier zu begreifen, zu definieren und ihm gerecht zu werden. Schon das Magische in den Tierbildern der primitiven (Altsteinzeit) wie auch der Kunst neuzeitlicher Naturvölker zeugen von der Vielfalt der Verständnis- und Deutungsversuche, die der Mensch dem Tier angedeihen ließ; ganz zu schweigen von den Hochkulturen des Altertums. Der jüdische Gott Jahwe soll in Nordisrael als Stier dargestellt und verehrt worden sein (Alfons Kirchgässner); man denke auch an das goldene Kalb, ein israelisches Kultsymbol, das nach der Sage erstmals von Aaron am Sinai hergestellt wurde (Ex 32).
Das hier angesprochene Thema ist also ebenso alt wie global; wir finden es rund um den Erdball „in primitiven Gesellschaften“ wie auch in „Gesellschaftsordnungen zivilisierter Völker“ und in den verschiedensten Zeitabschnitten.
Eine besondere Wertschätzung in diesem Reigen wurde dem Bären zuteil. Er galt als das stärkste und damit königlichste Tier des Nordens, ein Sinnbild der Kraft und der Wildheit. Auch die indischen Mythen und Volksmärchen erzählen, so wie von Affenstämmen auch, von ganzen mächtigen „Bärenvölkern und Bärenkönigen“. Indische Gelehrte erklären diese sagenhaften Bären ganz ähnlich den „wilden Leuten“ und Waldmenschen unserer heimischen Überlieferung, als eine Erinnerung an „Barbarenstämme“, die noch lange außerhalb der vedischen27 Kultur lebten. Wir finden den Bären in unseren Heiligengeschichten als Helfer frommer Einsiedler – gleich wie in Sibirien und im europäischen Teil Russlands auch – als ritterlichen Kämpen, der die Schwachen schont:
Jäger, Pilzsammler, Kräuterfrauen hieß es, sollen sich, so ihnen ein Bär entgegentritt, auf den Boden werfen, denn er lässt sie, wenn sie den Kampf aufgeben, regelmäßig am Leben.28
Trotz aller „aufgeklärter“ Volten in der Moderne ist diese mythische Beziehung zwischen Mensch und Tier lebendige Gegenwart, hat sich doch erst vor Kurzem auch die Filmindustrie dieses Themas angenommen. Der Film mit dem Titel „Der 13. Ritter“ flimmerte nicht nur über die Kinoleinwand, sondern auch über die Bildschirme des Fernsehens. Er zeigte in epischer Form den Kampf der Ritterschaft (Heldenepos) gegen „wilde Leute“, die in Höhlen wohnen und beim Kämpfen ein Bärenfell samt Bärenhaupt tragen.
Die bedeutendste deutsche Minneallegorie („Jagd nach Liebe“) des Hadamar von Laber (um 1300–1360) wurde 2005 als konzertante Aufführung (Clemencic Consort) in Form einer CD auf den Markt gebracht. Als Medium zur Darstellung seiner Allegorie wählte Hadamar die Jagd. Beim Aufbruch zur Jagd (nach der Geliebten) gruppiert der Jäger seine Hunde; jeder seiner Hunde verkörpert eine bestimmte Eigenschaft oder ein bestimmtes Gefühl des Jägers. Bezeichnenderweise trägt der Leithund den Namen „Herz“. Augenfällig im Sinne der hier behandelten Thematik ist die Tatsache, dass Tiere, nämlich die Hunde des Jägers, als Symbole menschlicher Regungen auserkoren wurden.