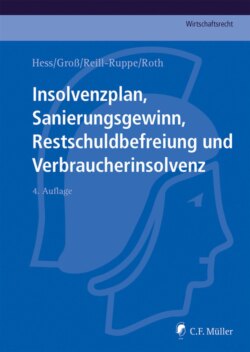Читать книгу Insolvenzplan, Sanierungsgewinn, Restschuldbefreiung und Verbraucherinsolvenz - Paul Groß - Страница 53
I. Zweck und Wesen des Plans
Оглавление109
Der Zweck des Insolvenzplans ist es, den Beteiligten einen Rechtsrahmen für die einvernehmliche Bewältigung der Insolvenz im Wege von Verhandlungen und privatautonomen Austauschprozessen zu ermöglichen. Darin liegt der entscheidende Beitrag zur Deregulierung der Insolvenzabwicklung. Ein Höchstmaß an Flexibilität der Regelungen gestattet es den Beteiligten, die für sie günstigste Art der Insolvenzabwicklung zu entdecken und durchzusetzen.
110
Ein Plan, der nach den gesetzlichen Regelungen zustande kommt, kann von sämtlichen Vorschriften über die insolvenzmäßige Zwangsverwertung und Verteilung abweichende Regelungen treffen. Der Plan wird damit zu einem universellen Instrument der Masseverwertung. Die Versilberung des Schuldnervermögens kann im Interesse der Sanierung des Schuldners oder seines Unternehmens unterbleiben. Forderungen können gestundet und ganz oder teilweise erlassen werden. Der Verwertungserlös kann anders verteilt werden als bei einer insolvenzmäßigen Gesamtvollstreckung; beispielsweise können Gläubigergruppen für ihre Forderungen in Anteilsrechten des Schuldners oder einer Auffanggesellschaft abgefunden werden, soweit das Gesellschaftsrecht solche Gestaltungen gestattet. Die schematische Gleichbehandlung von Gläubigern einer Rangklasse, die bei der insolvenzmäßigen Zwangsverwertung sachgerecht ist, kann durch differenzierte, den typischen Interessen der Gläubiger besser gerecht werdende planmäßige Regelungen verdrängt werden. Inhalt eines Plans kann nicht nur die Sanierung des Schuldners, sondern auch die übertragende Sanierung seines Unternehmens sein. Auch ein Stufenplan, der etwa die zeitweilige Fortführung des Schuldnerunternehmens und dessen anschließende Liquidation vorsieht, ist zulässig. Sämtliche Mischformen der herkömmlichen Typen von Liquidationen und vergleichsrechtlichen Regelungen sind statthaft. Einen Typenzwang der möglichen Plangestaltungen gibt es nicht. Sämtliche Arten der Masseverwertung werden den Beteiligten gleichrangig zur Verfügung gestellt.
111
Es ist Vorsorge dagegen getroffen, dass das Instrument des Plans von einzelnen Beteiligtengruppen zur Durchsetzung verfahrenszweckwidriger Sondervorteile genutzt werden kann. Der Sinn des Plans ist es nicht, gegenüber der zivilrechtlichen Haftungsordnung und der Verteilungsordnung der Gesamtvollstreckung Vermögensverlagerungen herbeizuführen. Der Plan ist dem Ziel der bestmöglichen Haftungsverwirklichung untergeordnet. Das Verfahren verbürgt allen Beteiligtengruppen angemessene, dem Rang ihrer Rechte bei einer insolvenzmäßigen Gesamtvollstreckung entsprechende Beteiligung an dem gemäß einem Plan realisierten Wert des Schuldnervermögens. Nur dann, wenn diese Teilhabe gewährleistet ist, kann ein Plan gegen den Willen einer Beteiligtengruppe bestätigt werden. Ein Plan kann darüber hinaus keinen einzelnen Beteiligten zwingen, den Vermögenswert, der ihm bei einer insolvenzmäßigen Gesamtvollstreckung zufließen würde, im Interesse anderer ganz oder teilweise hinzugeben, etwa im Unternehmen des Schuldners investiert zu lassen.
112
Die Bestätigung eines Plans setzt nicht notwendig voraus, dass dieser für die zustimmenden Beteiligten aus dem Schuldnervermögen mindestens die gleichen Zahlungen sicherstellt, wie sie bei einer insolvenzmäßigen Zwangsverwertung zu erwarten wären. In den Verhandlungen und bei der Abstimmung über einen Plan können die Beteiligten vielmehr alle ihre Interessen an einer bestimmten Art der Masseverwertung zur Geltung bringen, nicht nur ihr Interesse an Zahlungen aus dem Schuldnervermögen. Dadurch wird es möglich, solche Interessen, etwa den Wunsch einzelner Gläubigergruppen nach der Erhaltung einer bewährten Geschäftsbeziehung, marktkonform im Insolvenzverfahren zu gewichten. So wird den Beteiligten eine vollständigere, marktwirtschaftlich korrektere Bewertung der einzelnen Verwertungsvarianten möglich. Die Verfahrensvorschriften haben lediglich sicherzustellen, dass einzelne Beteiligtengruppen ihre Sonderinteressen nicht zulasten anderer Beteiligter verfolgen können.
113
Der Plan ist kein Vergleich. Vergleich und Zwangsvergleich sind in ihrer Grundstruktur Verträge des Schuldners mit seinen Gläubigern zur Abwendung oder Beendigung des früheren Konkursverfahrens. Sie sind in erster Linie auf die Sanierung des Schuldners durch Schuldenregulierung angelegt. Damit wurden im früheren Recht drei Regelungsthemen miteinander verquickt: die Mitspracherechte des Schuldners, die Entscheidungsfreiheit der Gläubiger über die Art (Sanierung oder Liquidation) und die Form (Gesamtexekution oder Vergleich) der Masseverwertung sowie die Restschuldbefreiung des Schuldners.
114
In dem einheitlichen Insolvenzverfahren sind diese Materien jeweils besonders geregelt:
| – | Die Mitwirkungsrechte aller Beteiligten – gesicherte Gläubiger, ungesicherte Gläubiger, nachrangige Gläubiger, Schuldner und an ihm beteiligte Personen – werden einheitlich, unabhängig von der Verwertungsform und dem angestrebten Verfahrensziel, zugemessen. Die Zustimmung des Schuldners zu einem Plan ist im Regelfall entbehrlich. |
| – | Der Plan steht für alle Verwertungsarten des Schuldnervermögens, nicht nur für Sanierungen, zur Verfügung. |
| – | Die Restschuldbefreiung ist kein notwendiges Element einer planmäßigen Regelung; Schuldner und mithaftende Eigentümer dürfen lediglich auch hinsichtlich ihrer Nachhaftung durch eine planmäßige Regelung gegen ihren Willen nicht schlechter gestellt werden als bei einer insolvenzmäßigen Liquidation. |
115
Der Plan ist mithin die privatautonome, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Übereinkunft der mitspracheberechtigten Beteiligten über die Verwertung des haftenden Schuldnervermögens unter voller Garantie des Werts der Beteiligtenrechte.
116
Der Plan bezweckt nicht eine Rechtswohltat für den Schuldner. Auf subjektive Würdigkeitvoraussetzungen kommt es beim Schuldner nicht an. Für die Zulässigkeit eines Plans ist die Mitwirkung des Schuldners oder – bei Personengesellschaften – eines persönlich haftenden Gesellschafters nicht erforderlich. Ein Plan kann gegen den Willen des Schuldners oder der an ihm beteiligten Personen freilich nur bestätigt werden, wenn er den Wert der Vermögensrechte auch dieser Beteiligten achtet.
117
Sieht ein Plan die Fortsetzung des Unternehmens durch den Schuldner, organisationsrechtliche Zugeständnisse oder etwa einen Eigentümerbeitrag vor, so ist hingegen bereits nach den allgemeinen Prinzipien der Wirtschaftsverfassung die Zustimmung der betroffenen Beteiligten erforderlich. Aus der vom GG verbürgten Vereinigungsfreiheit folgt ferner, dass kein Beteiligter gegen seinen Willen genötigt werden darf, Mitglied einer Gesellschaft oder einer anderen Personenvereinigung zu werden. Dabei kommt es auf den Wert der ihm angebotenen Mitgliedschaft nicht an.