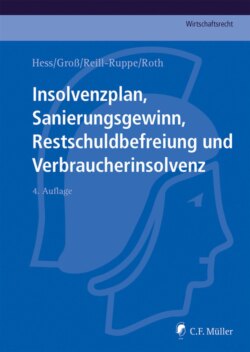Читать книгу Insolvenzplan, Sanierungsgewinn, Restschuldbefreiung und Verbraucherinsolvenz - Paul Groß - Страница 94
III. Rechtsnatur des Insolvenzplans
Оглавление265
Die von der gesetzlichen Liquidation abweichende Regelung der Insolvenz wird bei dem Insolvenzplan übereinstimmend mittels einer Übereinkunft zwischen den beteiligten Gläubigern und dem Schuldner erzielt. Beim Insolvenzplan zeigt sich das Modell einer Übereinkunft im Erfordernis einer Annahme des Plans durch die beteiligten Gläubigergruppen (§§ 244 ff. InsO) und einer Zustimmung des Schuldners.
266
Bedeutsam für den Insolvenzplan ist, dass die Zustimmung (bzw. der Ablehnung) zu einem vorgeschlagenen Vergleich oder Plan seitens der beteiligten Gläubiger eine dem Mehrheitsprinzip unterworfene Abstimmung zugrunde liegt (§ 244 InsO). Wird die notwendige Mehrheit erreicht, bindet die Annahme auch die ablehnenden, abwesenden und unbekannten Gläubiger (§ 254 Abs. 1 InsO). Letztere werden also kraft Gesetzes zwangsweise in die getroffene Regelung miteinbezogen. Dieser Mehrheitszwang stellt ein wesentliches Charakteristikum des Insolvenzplans dar.
267
Der Insolvenzplan ist ein im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens zustande kommender Vertrag bürgerlichen Rechts zwischen den Gläubigern und dem Schuldner. Der Insolvenzplan ist ein Vertrag, und zwar richtigerweise eine mehrseitige Verwertungsvereinbarung, auf den nicht die allgemeinen Regeln des Schuldrechts, sondern die Regeln, die für Beschlüsse von Gesellschaftsversammlungen entwickelt wurden, anwendbar sind; ein bestätigter Insolvenzplan kann weder vom Schuldner noch von einem Plangaranten selbst dann nicht angefochten werden, wenn sie arglistig getäuscht worden waren (RG 21.3.1930 – VII 340/29 – RGZ 127, 372, 375).
268
Das Ziel des Insolvenzplans ist es, eine privatautonome Gestaltung der Rechtsstellung von Gläubigern und Schuldner zu erreichen. Da der Plan erst durch die Gläubigerabstimmung, einem gesellschaftsähnlichen Beschlussakt zustande kommt und die Regeln der Rechtsgeschäftslehre nicht durchgängig anwendbar sind, stellt die Vorlage des Insolvenzplanvorschlages kein bindendes Angebot i.S.v. §§ 145 ff. BGB dar, sodass sie bis zur Bestätigung durch das Gericht zurückgenommen, geändert und ein anderer Plan vorgelegt werden kann. Die privatautonome Gestaltung kommt zustande durch die Zustimmung der Gläubiger (§§ 285, 289 InsO) und die Zustimmung des Schuldners, die nach § 247 InsO als erteilt gelten und dessen Widerspruch im Rahmen des § 247 Abs. 2 InsO unbeachtlich sein kann. Dass die Vertragsautonomie in den Vordergrund tritt, ergibt sich auch aus dem fehlenden Gestaltungselement des Gerichts.
269
Anderer Auffassung sind Smid/Rattunde (Insolvenzplan, Rz. 368 ff., 372), die meinen, dass der Urteilscharakter des Insolvenzplans deshalb in den Vordergrund trete, weil dem Insolvenzgericht über § 231 InsO eine umfassende Vorprüfungskompetenz hinsichtlich des Plans zustehe und das Insolvenzgericht über die bloße Rechtmäßigkeitskontrolle hinaus „materiell“ Einfluss auf den Inhalt des Plans ausübe. An anderer Stelle erläutern Smid/Rattunde (a.a.O. Rz. 489) den materiellen Einfluss des Insolvenzgerichts auf den Plan, wenn sie § 231 Abs. 1 InsO als ein Aufsichtsinstrument darstellen, mit dem dem Insolvenzgericht die Möglichkeit eingeräumt werden soll, nach der eigenen Auffassung missbräuchliche Plangestaltungen abzuwenden und deshalb berechtigt sei, z.B. in die Gruppenbildung einzugreifen.
270
Diese Auffassung ist rechtsirrig. Gerade die vom Gesetzgeber gewollte Stärkung der Privatautonomie verbietet es dem Gericht, ein eigenes Gestaltungsrecht in Bezug auf den Insolvenzplan einzuräumen, wonach das Gericht keine über die reine Kontrolle von Verfahren und Inhalt der privatautonomen Einigung hinausgehenden öffentlichen Interessen durchsetzt.
271
Die Stärkung der Privatautonomie ergibt sich daraus, dass die InsO zur Sicherung der vorrangig zu wahrenden Gläubigerinteressen auf privatautonome, durch marktkonforme Regelungen und auf die Abkehr jeglicher Form staatlicher Lenkung setzt.
272
Maßgeblich ist, dass der Vergleich zwischen den Ergebnissen ökonomischer Insolvenzanalyse und dem in der InsO verfolgten Konzept der Marktkonformität aufzeigt, dass der Gesetzgeber die Leitlinien wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse vollständig aufgegriffen und sich zu Eigen gemacht hat. Dies gilt sowohl für die Zielrichtung und Ausgestaltung des Insolvenzverfahrens insgesamt als auch für die im Insolvenzplan verwirklichte Konzeption eines Sanierungsverfahrens.
273
Die von dem Gesetzgeber über die §§ 1, 217 ff. InsO gewollte marktkonforme Bewältigung der Insolvenz rückt die traditionellen Ziele des Insolvenzrechts
| – | den Grundsatz der gleichmäßigen Befriedigung der Gläubiger (der durch die anerkannten Aus- und Absonderungsrechte schon in der Vergangenheit ausgehöhlt war), |
| – | die Vermeidung volkswirtschaftlicher Schäden (was schon deshalb zweifelhaft ist, weil im Wirtschaftskreislauf nichts verloren geht, sondern das Kapital auf die Marktteilnehmer verlagert wurde, die keine oder geringe Verluste hinnehmen müssen), |
| – | die Befriedung eines geschäftlichen Konflikts |
in den Hintergrund.
274
Für Dinstühler (InVo 1998, 333, 344 f.) erscheint es unumgänglich und sachgerecht, den Insolvenzplan als „Rechtsgebilde sui generis“ zu begreifen, der zwar grundsätzlich zwischen den Planbeteiligten im Abstimmungs-, also Mehrheitswege vereinbart, aber hierdurch nicht wirksam wird. Sein „Abschluss“ vollziehe sich nicht in den Formen des Privatrechts, sondern nach speziellen insolvenzverfahrensrechtlichen Grundsätzen. Hierfür sind primär die §§ 235 ff. InsO, ergänzend aber auch die Vorschriften der ZPO maßgeblich (vgl. § 4 InsO). Zum Zustandekommen eines Insolvenzplans gehören die Vorlage des Plans eines zur Planinitiative Berechtigten (§ 218 InsO), eine gerichtliche Plausibilitätskontrolle (§ 231 InsO), die Abhaltung eines gerichtlichen Erörterungs- und Abstimmungstermins (§§ 235 ff. InsO), die vorgesehenen Mehrheiten und Zustimmungen bzw. deren Überwindung (Obstruktionsverbot) sowie die gerichtliche Bestätigung (§ 248 InsO). Dabei hat die Bestätigung durch einen rechtskräftigen Beschluss zu erfolgen, der sogar Maßgeblichkeit gegenüber nicht zustimmenden Beteiligten entfaltet.
275
Jeder Versuch, diese Momente einer einheitlichen dogmatischen Zuordnung zuzuführen, führte zu Friktionen und tue den Dingen Gewalt an. Will man daher auf dogmatische Strukturen überhaupt zurückgreifen, könne man lediglich Teilaspekte des Insolvenzplans und des Insolvenzplanverfahrens an den überkommenden dogmatischen Kategorien der Rechtsordnung messen. So lässt sich formulieren, dass der Insolvenzplan seinem überwiegenden Inhalt nach auf Tatbestände des Bürgerlichen Rechts, etwa Vergleiche (§ 779 BGB), Erlasse (§ 397 BGB), Stundungen, Novationen, Erfüllungsgeschäfte, Erfüllungssurrogate etc. zurückgreift. Sein Zustandekommen vollziehe sich indes nach (vorrangig besonders ausgestalteten) Verfahrensgrundsätzen. Die erforderlichen Anträge, Abstimmungen und Zustimmungen lassen sich daher ihrer Natur nach als Prozesshandlungen begreifen, wobei sich für die Mehrheitsbildung etwa noch ein Vergleich zur materiellen Willensbildung im Gesellschaftsrecht anbietet. Die gerichtliche Bestätigung lasse sich schließlich nur als Eigenheit des Insolvenzplans verstehen, mit der die Maßgeblichkeit der Planregelungen für alle Planbetroffenen, insbesondere im Hinblick auf die vorgesehene Gestaltung und Veränderung der Rechtslage einschließlich der sachenrechtlichen Verhältnisse hervorgebracht wird.
276
Eine einheitliche dogmatische Einordnung und Klassifizierung des Insolvenzplans in den bekannten dogmatischen Strukturen sei daher nicht möglich.
277
Leipold (KTS 2006, 109) möchte sich statt der Vertragstheorie der Verfahrenstheorie anschließen, sodass es sich bei dem Insolvenzplan um einen privatrechtsgestaltenden Verfahrensakt handelt. Dies hat zur Folge, dass die Wirksamkeit des Insolvenzplans allein an verfahrensrechtlichen Kriterien zu messen ist, während die Anwendung materiell-rechtlicher Regeln über das Zustandekommen von Verträgen, über Willensmängel u.Ä. von vornherein nicht in Betracht kommt.