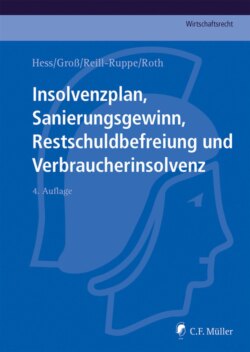Читать книгу Insolvenzplan, Sanierungsgewinn, Restschuldbefreiung und Verbraucherinsolvenz - Paul Groß - Страница 97
VI. Eingriff in Anteils- und Mitgliedschaftsrechte
Оглавление300
Durch das ESUG lässt es der Gesetzgeber zu, dass der Insolvenzplan in die Anteils- und Mitgliedschaftsrechte eingreifen kann, wenn der Schuldner keine natürliche Person ist. Die Gesetzesmaterialien weisen darauf hin, dass vor dem ESUG das bisher geltende deutsche Insolvenzrecht bei einer Sanierung mittels eines Insolvenzplans die Rechte der Anteilsinhaber des insolventen Unternehmens unberührt lässt.
301
Für die Verzahnung der Beschlüsse der Gesellschafter mit dem Insolvenzplan sieht § 249 InsO die Möglichkeit vor, im Insolvenzplan dessen Bestätigung davon abhängig zu machen, dass vorher Maßnahmen wie ein Fortsetzungsbeschluss eine Kapitalerhöhung oder eine Auswechselung von Gesellschaftern erfolgt sind. Die Gefahr, dass ein erfolgversprechendes Sanierungskonzept von den Anteilseignern blockiert werden könnte, wurde bei den Gesetzgebungsarbeiten zur InsO als gering eingeschätzt. Man war zuversichtlich, dass die Anteilseigner schon deshalb konstruktiv an einer Sanierung des Unternehmens durch einen Insolvenzplan mitarbeiten würden, weil andernfalls eine übertragende Sanierung folgen würde, d.h. die Übertragung des Unternehmens auf einen anderen Rechtsträger.
302
In der Rechtswirklichkeit ist die übertragende Sanierung aber nicht immer ein gleichwertiger Ersatz für die Sanierung des Unternehmensträgers durch einen Insolvenzplan. Steuerliche Aspekte wie die Nutzung von Verlustvorträgen und die Vermeidung von Grunderwerbsteuer können gegen eine Übertragung sprechen. Das insolvente Unternehmen kann Inhaber von Rechtspositionen sein, die nicht oder nur mit Schwierigkeiten und Kosten übertragen werden können; Beispiele sind Lizenzen, Genehmigungen und günstige langfristige Verträge. In einer solchen Situation hatten die Anteilsinhaber ein Blockadepotenzial, das noch dadurch verstärkt wird, dass für Gesellschafterbeschlüsse über Kapitalmaßnahmen i.d.R. Dreiviertelmehrheiten erforderlich sind (vgl. für die Kapitalerhöhung § 182 AktG, § 53 GmbHG).
303
Durch die Neuregelung kann durch den Insolvenzplan nicht mehr nur in Rechte der Gläubiger eingegriffen werden, sondern es können auch die Rechte der am Schuldner beteiligten Personen umgestaltet werden. Mit dem Institut des „Insolvenzplans“ und der Idee des privatautonomen Aushandelns wurde mit der InsO ein Schritt in die richtige Richtung getan. Die juristische Verfestigung der Position der Alteigentümer trotz ökonomischer Wertlosigkeit kann als Konstruktionsfehler bezeichnet werden. Sie führt zu Verletzungen der eigentlich intendierten Befriedigungsrangfolge, löst unerwünschte ex-ante-Effekte aus und verursacht höhere Transaktionskosten. Weiter wird auf die nicht erhobenen steuerlichen Hemmnisse hingewiesen Die Abstimmung der steuerlichen Vorschriften zur Nutzung von Verlustvorträgen mit den Zwecken des Insolvenzrechts ist misslungen. Erstens sind die Kriterien des Fiskus, an denen die Legitimität der Verlustverrechnung festgemacht wird, nur schwerlich verteidigbar. Zweitens stützen die Vorschriften, soweit sie auf den Wechsel von Anteilsrechten rekurrieren, die Partei, die i.d.R. die Insolvenz verschuldet und deren Position ökonomisch häufig wertlos ist. In Betracht kommen Kapitalmaßnahmen wie insbesondere die Umwandlung von Forderungen in Gesellschaftsanteile, der sog. Debt-Equity-Swap.
304
Im Unterschied zum bisherigen Insolvenzplanverfahren sind grundsätzlich auch die Inhaber von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten bei der Gruppenbildung und Abstimmung zu berücksichtigen. Eine Beteiligung ist jedoch nur dann erforderlich, wenn durch den Plan tatsächlich in ihre Rechte eingegriffen wird.
305
Die im Plan getroffenen gesellschaftsrechtlichen Regelungen treten – wie sämtliche anderen vorgesehenen Rechtsänderungen – mit der Rechtskraft der gerichtlichen Bestätigung des Plans in Kraft, ohne dass es der im Normalfall evtl. notwendigen Mitwirkungshandlungen der Organe bedarf (Beispiel: Kapitalmaßnahmen, für die eine Zustimmung der Hauptversammlung erforderlich ist). Dadurch wird das Blockadepotenzial der Gesellschaftsorgane und insbesondere der Anteilsinhaber minimiert und eine zügige und effektive Sanierung des schuldnerischen Unternehmens ermöglicht.
306
Diese Regelung ist verfassungsmäßig unbedenklich, weil der Eingriff in die Anteils- und Mitgliedschaftsrechte keine Verletzung der Grundrechte aus Art. 14 GG darstellt. Mit der Einleitung eines Insolvenzverfahrens stellen die Anteils- und Mitgliedschaftsrechte vor dem Hintergrund des § 199 InsO keinen Vermögenswert mehr dar (Hölzle NZI 2011, 124, 127).