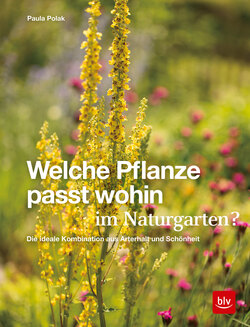Читать книгу Welche Pflanze passt wohin im Naturgarten? - Paula Polak - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEine bunt gemischte Blumenwiese entsteht auf eher mageren Böden, hier mit Kornade (Agrostemma githago), Margerite (Leucanthemum vulgare) und Färber-Hundskamille (Anthemis tinctoria).
Sonniger, magerer Standort für bunte Beete
Ein sonniger, trockener, etwas nährstoffreicherer Standort ist in der Natur die Ausgangslage für eine magere Wiese. Wenn er richtig angelegt, bepflanzt und betreut wird, verspricht dieser Standort auch im Garten eine besondere Artenfülle und Pflegeleichtigkeit. »Etwas nährstoffreicher«, das ist allerdings ein bisschen vage. Es meint Folgendes: Ein reiner Kies- oder Schotterboden enthält ein absolutes Minimum an Nährstoffen, die sich in den sandigen Anteilen befinden. Schnell bildet sich aber selbst darauf eine dünne Humusauflage, die durch Verrottung von Laub und die Tätigkeit von Bodenlebewesen wie Regenwürmern entsteht, und schon wird die Vegetation vielfältiger. Auf Dauer bleiben karge Standorte nur in Hanglagen erhalten, wo Humus vom Wind verweht wird, oder bei intensiver Beweidung durch Schafe. Hier können sich wenig Nährstoffe anreichern und zarte Arten bleiben konkurrenzfähig. »Etwas nährstoffreicher« meint also einen geringen Humusanteil im Boden. Viele der dort wachsenden Pflanzen sind Arten der klassischen Blumenwiesen, wie es sie heute in der Landschaft kaum noch gibt, etwa Margeriten, Wiesen-Salbei und Malven. Wollen Sie eine solche bunte, vielfältige Wiese in Ihrem Garten haben, muss der magere Boden von Haus aus vorhanden sein oder Sie müssen die vorgesehene Fläche entsprechend vorbereiten.
Ist Ihr Boden an sich mager, zeigt sich das am schütteren natürlichen Bewuchs und am sandigen bis steinigen Boden. Wachsen dort schon hübsche Pflanzen, reicht es aus, an den offenen Stellen ein paar Ihrer Wunscharten aus diesem Kapitel einzusäen. Den Boden sollten Sie dazu leicht aufkratzen und die Samen nach der Aussaat festtreten. Ist der vorhandene Bewuchs für Sie unattraktiv, mähen Sie ihn einfach ab. Fräsen Sie anschließend die Fläche gründlich und entfernen Sie grobe Pflanzenteile mit dem Rechen. Danach können Sie eine geeignete Blumenwiesenmischung ansäen, möglichst mit Saatgut aus der Region. Drücken Sie die Samen mit der Rasenwalze an, damit sie Bodenschluss bekommen. Graben Sie die Samen nicht ein, außer es wird in der Anleitung explizit so empfohlen. Die meisten Arten für solche Wiesen sind Lichtkeimer, sie brauchen Sonnenlicht, um zu keimen.
Ein Tipp zur Aussaat: Samen von Blütenstauden sind oft so fein wie eine Nadelspitze. Daraus werden jedoch stattliche Pflanzen mit Blattrosetten, die je nach Art, z. B. bei den Königskerzen, einen Durchmesser von 50 cm erreichen können. Die meisten sind zwar nicht ganz so groß, aber Ysop und Wiesen-Salbei benötigen immerhin etwa 25 cm Platz, selbst Margeritenrosetten bekommen schnell einen Durchmesser von 10 cm. Sät man also zu dicht, ersticken sich die Pflanzen gegenseitig. Um dies zu verhindern, strecken Sie das Saatgut mit Sand. Rechnen Sie nur für das Saatgut ca. 2–3 g/m².
Auf mageren trockenen Böden können Sie auch Farbbeete anlegen, z.B. diesen blauen Traum aus Steppen-Salbei (Salvia nemorosa) und Stauden-Lein (Linum perenne).
Wenn der Boden nährstoffreich ist, ist seine Farbe dunkel und der Bewuchs üppig. Sie können dann mit Pflanzen aus dem Kapitel »Beste Bedingungen...« (>) einen Hochstaudensaum anlegen oder den Boden abmagern, um Pflanzen aus diesem Kapitel zu verwenden. Dazu gibt es mehrere Wege.
Rote Spornblume (Centranthus ruber) und Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia) lieben karge Ecken.
Den Boden abmagern
Das Unterste nach oben kehren: Tragen Sie die bestehende Grasnarbe ab, fräsen oder pflügen Sie die Fläche bis zu 40 cm Tiefe, wenn möglich sogar bis 60 cm. Dadurch gelangt der magere Unterboden an die Oberfläche. Fräsen Sie vor dem Winter, dann schafft die Frostgare einen feinkrümeligen Boden. Im Frühling rechen Sie diesen glatt.
Abmagern mithilfe von Starkzehrern: Tragen Sie die Grasnarbe ab und bauen Sie auf der Fläche Sonnenblumen an, diese durchwurzeln den Boden bis zu 3 m tief. Auch Kürbis oder Mais ziehen viele Nährstoffe aus dem Boden. Düngen Sie nicht und schneiden Sie die Pflanzen nach dem Winter ab, graben Sie die Wurzeln aus und kompostieren Sie diese. Sie können dies ruhig über mehrere Jahre praktizieren. Dann fräsen Sie und die Wunschwiese kann angesät werden. Für diese Methode eignen sich auch andere bodenverbessernde Pflanzen wie Ringelblume, Bienenfreund und Buchweizen, nur keine Schmetterlingsblütler wie Bohnen und Klee. Diese binden Luftstickstoff und düngen so den Boden zusätzlich.
Bodenaustausch der obersten 20–50 cm: Diese Methode ist wirklich nur sinnvoll, wenn der Boden kontaminiert oder voller Bauschutt ist. Der Abtransport einer großen Menge Erdreich mit Lkw verursacht zu viel CO2-Ausstoß.
Auch für Lavendel (Lavandula angustifolia) und Großblütige Königskerze (Verbascum densiflorum) gilt: bloß nicht düngen!
Gestaltete Staudenbeete
Nährstoffarme Böden eignen sich nicht nur für Blumenwiesen, sondern auch für schön gestaltete Beete. Die Bodenvorbereitung erfolgt dazu wie oben beschrieben. Jede Art der Staudenbeetgestaltung ist mit Wildstauden möglich: Blockbepflanzung, Drifts, Tuffs oder eine Mischpflanzung, die am natürlichsten wirkt. Dafür kombinieren Sie 15 % Gerüstbildner, 25 % Begleitstauden, 10 % Füllpflanzen und 50 % Bodendecker. Verteilen Sie dazu erst die Stauden mitsamt den Töpfen auf der Fläche, um Abstände zu optimieren. Zuerst platzieren Sie die Gerüstbildner, z. B. Königskerze, Nachtkerze und Wegwarte, dann die Begleitstauden usw. Achten Sie beim Einpflanzen darauf, dass sich keine unerwünschten Pflanzen am Wurzelballen befinden. Die Pflege solcher Pflanzungen beschränkt sich dann auf etwas Jäten im ersten Jahr und einen Rückschnitt der Stauden pro Jahr.
Buddleja davidii ist in der freien Landschaft nicht unumstritten, steht bei Schmetterlingen aber ganz hoch im Kurs.
Tierisch geliebte Gehölze
Im Sinne der Artenvielfalt und unserer Freude an Blüten sowie aus strukturell-gestalterischen Gründen, sollten Sie zu den Blumenwiesen und Beeten dieses Standorts auch noch die passenden Gehölze pflanzen. In der Tabelle auf Seite 61 finden Sie geeignete Gehölze, die sich auf mageren, sonnigen, trockenen Standorten wohlfühlen. Gehölze bieten nicht nur Pollen und Nektar für Insekten, sondern auch Früchte, die gerne von Vögeln und Säugetieren genutzt werden. Sie bieten ihnen auch Schutz und Nistmöglichkeiten. Das und seine Vitamin-C-haltigen Früchte sind die Gründe, warum ich auch den für Insekten uninteressanten, weil windbestäubten Sanddorn (Hippophae rhamnoides) empfehle. Sanddorn wie Schlehe (Prunus spinosa) haben allerdings einen Nachteil: Sie vermehren sich stark durch Ausläufer. Deshalb plane ich sie vorwiegend vor Rasen oder Wiesen, die regelmäßig gemäht werden. Im Beet muss man die Austriebe zwischen den Stauden laufend ausstechen. Zum Sommerflieder (Buddleja davidii) rate ich, obwohl er eine aus Naturschutzgründen fragliche Art ist. In der Landschaft hat er sich als invasiv erwiesen, er keimt noch am trockensten, magersten Ort und verdrängt so seltene Trockenrasenpflanzen. Im Garten, wenn er nicht gerade an ein Naturschutzgebiet grenzt, sollten Sie ihn dennoch pflanzen. Er ermöglicht es Faltern, die wertvolle Eiweißquelle Pollen zusammen mit dem Nektar aufzusaugen.
Balkon und Terrasse
Die hier angeführten Stauden und Gehölze passen grundsätzlich auch in Gefäße auf Balkon oder Terrasse, vorausgesetzt, das Substrat ist etwas nährstoffreicher und wasserdurchlässig. Dafür nehmen Sie 50 % Bio-Gartenerde und 50 % regionalen Sand, ersatzweise Quarzsand aus dem Baumarkt gemischt mit etwas Gartenkalk. In Gefäßen müssen Sie die Pflanzen gießen und düngen, denn die Erde trocknet schnell aus, die Nährstoffe sind schnell verbraucht.