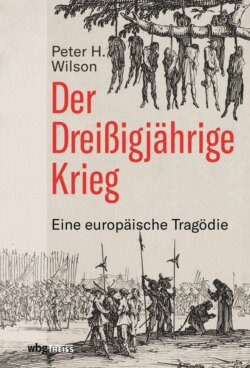Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Peter H. Wilson - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Aufruhr im Herzen der Christenheit Das Heilige Römische Reich
ОглавлениеAuch vor 1618 war das Geschehen im Heiligen Römischen Reich durchaus nicht undramatisch – aber das Drama, von dem hier die Rede ist, war doch eher im Gerichtssaal als auf dem Schlachtfeld angesiedelt. Die Mitteleuropäer des 16. Jahrhunderts sahen sich in diverse langfristige – und oft auch langatmige – Rechtsstreitigkeiten verwickelt, die von späteren Generationen als ermüdend und belanglos abgetan worden sind. Stattdessen verdichtete man die Jahrzehnte vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges zu einem griffigen Narrativ, demzufolge es eine fortschreitende, konfessionelle wie politische Polarisierung gewesen sei, die unausweichlich zum Krieg geführt habe. Da es mitunter sehr schwerfällt, die Komplexitäten des Alten Reiches angemessen darzustellen, ist ein solches Vorgehen nur zu verständlich.
Im 18. Jahrhundert musste selbst der unermüdliche Johann Jakob Moser (der neben seiner Juristenkarriere auch noch die Zeit fand, 600 protestantische Kirchenlieder zu schreiben und acht Kinder großzuziehen) seine Gesamtdarstellung der Reichsverfassung nach immerhin mehr als 100 Bänden abbrechen. Anscheinend besteht die einzige Möglichkeit, sich dem Problem zu nähern, tatsächlich darin – wie T.C.W. Blanning so treffend bemerkt hat –, eine Vorliebe für das Anomale zu kultivieren, denn das Alte Reich und seine Teile passten in keine denkbare Schublade.14 In eine ähnliche Richtung geht die viel zitierte Einschätzung des Naturrechtsphilosophen Samuel Pufendorf, der 1667 erklärte, das Reich sei weder eine „reguläre Monarchie“ noch eine Republik, sondern sei „unregelmäßig“ und gleiche einem „Monstrum“. Doch vielleicht bietet eine andere zeitgenössische Metapher den besseren Ausgangspunkt für weitere Überlegungen. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts begannen Naturphilosophen wie René Descartes, die Welt auf mechanische Weise zu erklären. Alles, lebendige Wesen wie die Bewegung der Himmelskörper, interpretierten sie als komplexe mechanische Apparate. Vor diesem ideengeschichtlichen Hintergrund erscheint das Alte Reich als ein träger, sperriger Schwertransporter, in dessen Innerem gleichwohl eine ausgefeilte und komplizierte, dabei überraschend robuste Maschinerie von Gewichten und Gegengewichten ihr Werk tat. Die Könige von Frankreich, Schweden und Dänemark mochten mit ihren Schwertern auf dieses Gefährt einschlagen, indessen der osmanische Sultan es mit seinem Szepter traktierte: So zerbeulten sie vielleicht seine äußere Hülle und brachten auch ein paar der empfindlicheren Teile im Inneren durcheinander – aber den gemächlichen, schwerfälligen Gang des großen Ganzen hielten sie nicht auf.
Mauern, Türme, Herrschaftssitze Was diesen Koloss vorantrieb, war die harte Arbeit von Millionen von Kleinbauern und anderen einfachen Leuten, die in den 2200 Städten, den mindestens 150 000 Dörfern, den zahlreichen Mönchs- und Nonnenklöstern sowie anderen Gemeinschaften im ganzen römisch-deutschen Reich lebten. Dort, auf der Ebene der Gemeinschaften, spielte sich das wirkliche Leben ab: Menschen heirateten, bekamen Kinder, gaben und nahmen Arbeit, brachten die Ernte ein, stellten Waren her und trieben Handel. Diese Gemeinschaften sind es auch, die Matthäus Merians berühmte Kupferstichsammlung Topographia Germaniae dominieren, ein monumentales Verlagsvorhaben, das zur Hochzeit des Krieges in den 1630er-Jahren begonnen und erst 40 Jahre später abgeschlossen wurde.15 Die zuletzt 30 Bände der Topographia enthalten kaum eine Schilderung der natürlichen Umgebung, sondern versammeln, nach Gegenden gruppiert und alphabetisch geordnet, Beschreibungen all jener Ortschaften, die Merian und seine Mitarbeiter entweder selbst besucht oder von denen sie gehört oder gelesen hatten. Die zahlreichen beigegebenen Kupferstiche liefern mit ihren Mauern, Kirchtürmen und Herrschaftsbauten eine perfekte Veranschaulichung der drei Elemente, aus denen sich jedes der abgebildeten Gemeinwesen zusammenfügte, und lassen zudem erkennen, wie diese mit den Machtstrukturen des gesamten Reiches zusammenhingen.
In der Darstellung wird jeder Ort deutlich von der ihn umgebenden Landschaft abgesetzt; die Merian-Ansichten zeigen die Stadtgemeinschaft in ihrem klar umgrenzten sozialen Raum. Die meisten der gezeigten Städte und Siedlungen liegen an Flüssen, die für die Kommunikation mit dem Rest der Welt unerlässlich waren, aber auch zur Abfallentsorgung und als erste Barriere gegen Angreifer dienten. Anders als die meisten heutigen Flüsse folgten die Flüsse des 17. Jahrhunderts noch ihrem natürlichen Lauf. Während der Schneeschmelze oder nach starkem Regen schwollen sie an, traten über die Ufer und ergossen sich über Auen und Niederungen. Größere Flüsse änderten mit der Zeit ihren Lauf, schufen Inseln und Nebenarme, die kluge Brückenbauer in die Planung ihrer weit gespannten Meisterwerke einbezogen. Aus dem Mittelalter stammende Mauern umschlossen Städte und größere Dörfer, nach außen oft ergänzt durch einen Verteidigungsgraben, der mit dem Wasser aus Flüssen und Bächen gefüllt wurde. Zu diesen hohen, aber vergleichsweise dünnen Mauern mit ihren markanten Türmen und Torwerken gesellten sich mit der Zeit weitere, modernere Verteidigungsanlagen, die vor der Stadt angelegt wurden, um diese vor Artilleriebeschuss zu schützen. Einige Städte hatten sich schon im 16. Jahrhundert derartige Befestigungen zugelegt, aber in den meisten Fällen geschah dies erst in den zunehmend kriegsgeprägten 1620er-Jahren – entweder durch völlige Neubauten oder durch die Modernisierung bestehender Anlagen. Die nunmehr dicken, gedrungenen Festungswälle mit ihren mächtigen, steinernen Bastionen erstreckten sich in einigem Abstand rings um den mittelalterlichen Stadtkern. Neuere Vorstädte schlossen sie bisweilen ein, mitunter wurden diese aber auch rigoros niedergerissen, um ein rundherum freies Schussfeld zu erhalten. Nur ein geübtes Auge konnte die ausgeklügelten geometrischen Muster erkennen, mit denen die neuen Befestigungsanlagen die Landschaft überzogen, denn das Geflecht von Wällen, Vorwerken und Gräben wurde, betrachtete man es aus Bodensicht, meist von zusätzlichen Erdwällen verdeckt, die sich bis weit in das Umland erstreckten. Bei den wenigen Gebäuden, die außerhalb der Befestigungsanlagen verblieben, handelte es sich entweder um Gewerbebauten wie Sägemühlen oder Ziegelöfen oder um kirchliche Stiftungen wie Mönchs- oder Nonnenklöster, die ihrerseits wieder eigene Gemeinschaften bildeten.
Sogar kleinere Dörfer und Weiler wurden eingezäunt – einerseits, um wilde Tiere fernzuhalten, aber andererseits auch, um dem Orts- und Heimatgefühl der Bewohner Ausdruck zu verleihen. Die Stadttore wurden bei Einbruch der Dunkelheit verschlossen und waren selbst in vergleichsweise friedlichen Zeiten stets bewacht. Wer sie durchschritt, wurde nach dem Woher und Wohin seines Weges gefragt; mitgeführte Waren mussten nicht selten verzollt werden. Die Stadtmauern – genauer gesagt: die Schwierigkeit ihrer Erweiterung und die damit verbundenen hohen Kosten – sorgten dafür, dass sich in ihrem Inneren die Häuser dicht an dicht drängten, in größeren Städten mit einem dritten oder sogar weiteren Stockwerken versehen wurden und überhaupt jeglicher verfügbare Raum – ob im Keller oder unter dem Dach – genutzt wurde. Stein oder Backstein kamen oft nur im Erdgeschoss zum Einsatz; den Rest des Hauses errichtete man als Fachwerkbau. Feuer war eine ständige Gefahr und richtete oft wesentlich größeren Schaden an als der Krieg. Die Enge in den Städten schärfte so auch die Neugier und Wachsamkeit ihrer Bewohner: Ein allzeit betrunkener Nachbar war nicht nur ein Ärgernis, sondern im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Zudem waren die Gemeinwesen der Frühen Neuzeit nur in den seltensten Fällen groß genug, um auch nur den Anschein von Anonymität zuzulassen. Das gesellschaftliche Leben spielte sich weitgehend von Angesicht zu Angesicht ab, und Fremde oder Außenseiter zogen Blicke, Erkundigungen, nicht selten auch Verdächtigungen auf sich. Das Herannahen des Krieges brachte ganze Scharen von bewaffneten Fremden, die von den Hügeln oder aus dem Dunkel der Wälder in Richtung der Siedlungen zogen. Sie sprachen ungewohnte Dialekte, vielleicht sogar fremde Sprachen. Jeder neue Soldatentrupp bedeutete weitere hungrige Mäuler in der Stadt; oft waren es am Ende mehr Soldaten als Stadtbewohner, die verpflegt sein wollten. Stellte man sich dem Eindringen der fremden Truppen entgegen, riskierte man die Beschädigung oder gar Zerstörung wohlvertrauter Bauten. Schlugen die Soldaten eine Bresche in die Mauer, war der Schutzraum der Stadtgemeinschaft verletzt. Der folgende Einfall endete für gewöhnlich in Plündern, Brandschatzen und Schlimmerem.
Die Kirchtürme, die sich so imposant über die Mauern und Dächer der Stadt erhoben, verwiesen auf eine zweite, spirituelle Dimension der Siedlung, die immer auch eine Gemeinschaft der Gläubigen war. Kirchen wurden in der Regel aus Stein errichtet und zählten zu den größten Bauten am Ort. In den Kupferstichen Merians sind sie mit großer Sorgfalt abgebildet und beschriftet; jede Kirche wird dort mit ihrem Namen bezeichnet, die bedeutenderen unter ihnen erhalten manchmal sogar eine eigene Bildtafel. Selbst eher kleine Städte konnten vier oder mehr Kirchen haben, die jeweils das Zentrum eines Pfarrbezirks bildeten. Größere (Kirch-)Dörfer deckten auch den Seelsorgebedarf der umliegenden Weiler, mit Mönchs- und Nonnenklöstern standen weitere Gotteshäuser bereit. Die Anzahl und Größe dieser Bauten belegt nicht nur die große Bedeutung des Glaubens in der damaligen Zeit, sondern auch die wirtschaftliche Stärke einer frühneuzeitlichen Amtskirche, die in allen maßgeblichen Gemeinwesen vertreten war.
Die andere Sorte von Gebäuden, die ein Reisender schon von fern entdeckt haben würde, waren die repräsentativen Bauten der weltlichen Macht. Rathäuser, Paläste oder Vogteien waren die neben den Kirchen größten Gebäude in den Städten der Frühen Neuzeit. Sie waren in der Regel weit massiver konstruiert als gewerblich genutzte Gebäude; wesentlich schmuck- und eindrucksvoller waren sie ohnehin. Wie die Kirchen standen auch sie symbolisch für alle Einwohner: sowohl als klar umrissene Gemeinschaft von Ortsansässigen wie auch als Angehörige eines größeren Gemeinwesens. Die Städte und die meisten Dörfer erfreuten sich einer beträchtlichen Autonomie, was die Regelung ihrer inneren Angelegenheiten betraf, die in den Händen von gewählten Vertretern der wahlberechtigten Einwohnerschaft lag; wahlberechtigt waren in der Regel männliche, verheiratete Hausbesitzer und Familienväter. Die Befugnisse der gewählten Gemeindevertreter konnten sich im Einzelnen stark unterscheiden, umfassten aber in der Regel die niedere Gerichtsbarkeit, begrenzte Vollmachten zur Erhebung von Abgaben und Diensten für gemeinschaftliche Aufgaben sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeinschaftlichen Besitzes an Grund und Gütern. Entscheidend war, dass zu diesen Befugnissen meist das Recht gehörte, über die Niederlassung ortsfremder Personen zu entscheiden sowie all jene zu bestrafen, die gegen die Regeln der Gemeinschaft verstießen. Dennoch war keine Dorf- oder Stadtgemeinschaft vollkommen autark: Jeder, der ein Rathaus, den Amtssitz eines Dorfvorstehers oder ein anderes zentrales Verwaltungsgebäude aufsuchte, würde dort ein geschnitztes, gemeißeltes oder aufgemaltes Wappen vorfinden, das auf eine höhere Macht als die der städtischen oder dörflichen Obrigkeit verwies – eine höhere Macht, der ebenjene Rechenschaft schuldig war.
Die Reichsverfassung war es, die Tausende von Städten, Dörfern und anderen Gemeinschaften in einem hierarchisch geordneten System überlappender Jurisdiktionen miteinander verknüpfte. Obwohl sich der Titel von Merians Topographia Germaniae auf Deutschland zu beziehen scheint, ist ihr Gegenstand doch das Heilige Römische Reich – ein Gebiet, das auf einer Fläche von noch immer rund 680 000 Quadratkilometern nicht nur das gesamte heutige Deutschland, Österreich, Luxemburg und Tschechien umfasste, sondern weite Teile Westpolens sowie Lothringen und das Elsass, die heute in Frankreich liegen, noch dazu. Obwohl sie in Merians Topographia fehlen, waren auch die heutigen Niederlande und Belgien um 1600 noch größtenteils mit dem Heiligen Römischen Reich verbunden, genauso wie – auf einer Fläche von weiteren 65 000 Quadratkilometern – diverse Territorien in Oberitalien; in den Institutionen des Reiches waren diese Gebiete gleichwohl nicht vertreten.16
Der Kaiser und die Fürsten Das Reich als Ganzes symbolisierte das spätmittelalterliche Ideal einer geeinten Christenheit. Sein Herrscher war der einzige christliche Monarch, der den Kaisertitel trug, was ihn über alle anderen gekrönten Häupter des Abendlands erhob. Der kaiserliche Anspruch auf die weltliche Oberherrschaft in Europa entsprang der Vorstellung, das Heilige Römische Reich stelle die lückenlose Fortsetzung des Römischen Reiches der Antike dar und sei somit, wie dieses, mit dem letzten der vier großen Weltreiche zu identifizieren, die im biblischen Buch Daniel prophezeit worden waren. Dieses Ideal einer allumfassenden Herrschaft war jedoch von den Schauplätzen ihrer praktischen Umsetzung, von der „Politik vor Ort“, denkbar weit entfernt – eine unmittelbare Herrschaft des Kaisers über die zahlreichen ihm untertanen Territorien war ausgeschlossen. Stattdessen wurde die kaiserliche Autorität über das Reich durch eine Stufenfolge von Zuständigkeiten und Befugnissen vermittelt, die letztlich auf mittelalterlich-feudale Ursprünge zurückging. Der Kaiser war der oberste Lehnsherr einer Heerschar ihm untergebener, geringerer Autoritäten, die untereinander ebenfalls durch Lehnseide verbunden waren. Mit der Zeit waren die Rangunterschiede zwischen den verschiedenen Fürsten des Reiches immer schärfer hervorgetreten, insbesondere weil sich das Reich in den Jahren nach 1480 einer Vielzahl von inneren wie äußeren Problemen hatte stellen müssen. Namentlich war es zu einer grundsätzlichen Trennung gekommen zwischen jenen Autoritäten, Fürsten und anderen, die dem Kaiser direkt unterstellt waren – die reichsunmittelbar waren –, und jenen mittelbaren Reichsständen, die einer dem Kaiser nachgeordneten Instanz unterstanden.
Die reichsunmittelbaren Landesherren waren im Besitz kaiserlicher Volllehen (Reichslehen), die ihnen der Kaiser in seiner Eigenschaft als ihr Lehnsherr verliehen hatte. Diese setzten sich in der Regel aus mehreren sogenannten Unter- oder Afterlehen zusammen, die ihrerseits von Lehnsleuten der reichsunmittelbaren Landesherren – mittelbaren Lehnsleuten des Kaisers also – gehalten wurden, oder aus Jurisdiktionen, die andere, dem kaiserlichen Lehnsnehmer untergebene Körperschaften innehatten. Auf diese Weise waren Städte, Dörfer und andere Gemeinschaften durch ein komplexes, juristisch und politisch definiertes Netz von Rechten, Privilegien und Machtbefugnissen miteinander verknüpft. Diese Rechte wiederum verliehen ihren Inhabern Anspruch darauf, von ihren Untergebenen respektiert und loyal unterstützt zu werden, sowohl materiell als auch mit Dienstleistungen. Der Grundherr eines Dorfes etwa, dem dort auch die (niedere) Gerichtsbarkeit zukam, durfte von dessen Bewohnern Folgsamkeit und Treue erwarten, dazu einen Anteil ihrer Ernte sowie – in einem bestimmten Umfang – auch ihrer Zeit und Arbeitskraft zur Erfüllung gewisser Aufgaben. Im Gegenzug erwartete man von ihm, dass er seine Untertanen gegen äußere Übel verteidigen, ihr Gemeinwesen als solches auch im weiteren Rahmen des Reiches beschützen sowie – im Innern – Streitigkeiten schlichten und ernstere Probleme lösen werde.
Die Bedeutung einer solchen Gemeinschaft als sozialer und politischer Raum ging damit einher, dass alle diese Rechte letztlich im Grund und Boden verwurzelt waren: Wem sie zukamen, der hielt auch die Macht über das dazugehörige Gebiet in Händen. Herrschaftstitel verschiedener Herkunft und Qualität schlossen sich dabei nicht zwangsläufig aus: Wer im Besitz eines reichsunmittelbaren, mithin vom Kaiser verliehenen Lehens war, konnte zugleich auch Lehnsnehmer eines anderen Adligen sein. Auch hatte der große Einfluss und Reichtum der Kirche ein Heer von geistlichen Herren hervorgebracht, die traditionell eine enge Verbindung zum Kaisertum pflegten und sich deshalb gemeinsam auch als „Reichskirche“ betrachteten. Die materielle Grundlage dieser Reichskirche bestand in den Siedlungen und Gütern, die ihr kraft kaiserlicher und anderer Lehen und Hoheitsrechte unterstellt waren. Allerdings waren diese territorialen Machtbefugnisse der Kirche keineswegs deckungsgleich mit ihrem geistlichen Machtbereich, der sich auch auf die Kirchsprengel in den Territorien weltlicher Herrscher erstreckte. Schließlich konnten sich mehrere Herren die Macht in ein und demselben Hoheitsbereich teilen oder innerhalb eines Geltungsbereiches je unterschiedliche Hoheitsrechte halten.
Die meisten der beschriebenen Rechte wurden durch Erbschaft erworben und innerhalb der 50 000 bis 60 000 Adelsfamilien des Reiches weitergegeben. Die überwiegende Mehrheit dieser Familien gehörte dem Landadel an, dessen niedere Gerichtsbarkeit der höheren Gerichtsbarkeit des (wesentlich exklusiveren) reichsunmittelbaren Adels unterstellt war. Insgesamt gab es auf der obersten Ebene der Lehnsordnung etwa 180 weltliche und 130 geistliche Lehen, die zusammen die Territorien des Reiches ausmachten. Ihre Größe variierte beträchtlich, wobei kein direkter Zusammenhang zwischen der Ausdehnung eines bestimmten Territoriums und seinem politischen Einfluss bestand. In der Entstehungszeit des Heiligen Römischen Reiches hatte sich dessen Bevölkerung vor allem im Süden und Westen des deutschen Sprachraums konzentriert. Die Bevölkerungsdichte in diesen Gebieten ermöglichte es, dort eine größere Anzahl von Grundherrschaften aufrechtzuerhalten als im dünner besiedelten Norden und Osten; die letztgenannten Regionen traten erst Anfang des 16. Jahrhunderts vollständig in den Geltungsbereich der Reichsverfassung ein.
Bis 1521 hatte die Konsolidierung der Reichsverfassung die weltlichen und geistlichen Herren in drei Gruppen gegliedert. Die kleinste, aber ranghöchste bildeten die sieben Kurfürsten, also jene sieben Reichsfürsten, deren Lehen in der Goldenen Bulle von 1356 mit dem exklusiven Recht verknüpft worden waren, den Kaiser zu „küren“. Die herrschende Gesellschaftsordnung räumte dem Klerus als „erstem Stand“ den Vorrang noch vor dem Adel ein – erfüllten doch die Kleriker durch ihr beständiges Gebet für das Seelenheil der ganzen Christenheit eine unentbehrliche gesellschaftliche Funktion. Der ranghöchste Kurfürst war deshalb der Erzbischof von Mainz, gefolgt von seinen Amtsbrüdern in Köln und Trier; keiner der drei herrschte über mehr als 100 000 Untertanen. Unter den weltlichen Kurfürsten stand der böhmische König an erster Stelle (Böhmen war das einzige Territorium des Reiches, das mit einer eigenen Königswürde verbunden war, siehe Kapitel 3). Das Königreich Böhmen war außerdem das größte Kurfürstentum; es erstreckte sich über 50 000 Quadratkilometer, und seine 1,4 Millionen Einwohner lebten in 102 Städten, 308 Marktgemeinden, 258 Burgen und Schlössern sowie 30 363 Dörfern und Weilern, die insgesamt 2033 Pfarrkirchen vorweisen konnten. Das zweitgrößte – wenn auch rangniedrigste – Kurfürstentum war Brandenburg mit 36 000 Quadratkilometern Fläche, aber nur 350 000 Einwohnern. Kursachsen war kleiner, mit rund 1,2 Millionen Einwohnern aber dichter bevölkert. Die Kurpfalz, rangmäßig an zweiter Stelle hinter den Ländern der böhmischen Krone platziert, erstreckte sich über insgesamt rund 11 000 Quadratkilometer mit etwa 600 000 Einwohnern, die sich auf zwei räumlich getrennte Territorien verteilten: die am Rhein gelegene Unter- oder Rheinpfalz sowie die nördlich des Herzogtums Bayern gelegene Oberpfalz. Zusammen herrschten die Kurfürsten über etwa ein Fünftel des Gebietes und rund ein Sechstel der Bewohner des Heiligen Römischen Reiches.
Die restlichen Reichslehen lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen. Zu der ersten gehörten 50 geistliche und 33 weltliche Lehen, deren Inhaber im Fürstenrang standen (wobei ihre konkreten Titel und Adelsprädikate vom Bischof und Erzbischof über den Herzog bis zum Landgrafen und Markgrafen reichten). Die Lehen der weltlichen Fürsten wurden formal durch Erbschaft oder Kauf erworben; in beiden Fällen war die Zustimmung des Kaisers nötig, um die Übertragung zu legitimieren. Die geistlichen Fürsten wurden von den Dom- oder Stiftskapiteln der jeweils bedeutendsten Kirche ihres Territoriums gewählt. Auch dabei musste, zumindest der Form nach, der Kaiser sowie in diesem Fall zusätzlich der Papst seine Zustimmung geben. Die Anzahl der Reichsfürsten lag stets unter der Gesamtzahl der Reichslehen, da sowohl die Kurfürsten zusätzliche Lehen an sich ziehen konnten als auch andere Reichsfürsten mehr als ein Reichslehen zur selben Zeit halten konnten; selbst Fürstbischöfe besetzten zuweilen mehr als einen Bischofsstuhl zugleich. Unter den Fürstendynastien des Reiches erwiesen sich die Habsburger als die Geschicktesten, was diese Art der Einflussmaximierung betraf: Schließlich herrschten sie nicht nur über ihre österreichischen Erblande, sondern auch über das Königreich Böhmen mit seinen Nebenländern sowie über ihre 17 niederländischen Provinzen – alles in allem über ein Territorium von 303 000 Quadratkilometern, was rund 40 Prozent der Gesamtfläche des Heiligen Römischen Reiches entspricht. Einschließlich der 1526 unter habsburgische Herrschaft gekommenen ungarischen Gebiete lag die Zahl der habsburgischen Untertanen um 1600 bei über sieben Millionen – gegenüber rund 17 Millionen Einwohnern im restlichen Reichsgebiet. Diese Hausmacht war es, die den Habsburgern zwischen 1438 und dem Ende des Alten Reiches 1806 im Ringen um den Kaiserthron eine beinah unangefochtene Monopolstellung sicherte. Den anderen Fürsten, von denen die wenigsten über mehr als 100 000 Untertanen geboten, waren die Habsburger haushoch überlegen.
Zur zweiten Klasse von Reichslehen, der etwa 220 Lehnsnehmer angehörten, zählten wesentlich kleinere Territorien, deren Inhaber nicht im Fürstenrang standen. Sie waren Grafen, Prälaten oder sonstige Herren; selten hatten sie mehr als ein paar Tausend Untertanen. Daneben gab es noch rund 400 niederadlige Familien – Ritter und Freiherren –, die als Reichsritterschaft zusammen 1500 weitere kaiserliche Lehen hielten. Jeweils für sich betrachtet, waren ihre Herrschaften auch nicht größer als die des – wesentlich zahlreicheren – landständischen Adels, dem der Distinktionsgewinn der Reichsunmittelbarkeit versagt geblieben war, und bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts spielte der reichsritterschaftliche Adel in der Politik des Reiches keine nennenswerte Rolle mehr.
Die Reichsstädte Die übergroße Mehrheit der Stadt- und Landgemeinden unterstand in der ein oder anderen Form fremder Jurisdiktion, doch eine Minderheit blieb von herrschaftlicher Lenkung und Kontrolle frei. An erster Stelle sind hier die etwa 80 „Freien und Reichsstädte“ zu nennen, die größtenteils in Schwaben und Franken lagen, den alten Kernlanden des Reiches im Süden und Westen. Zu ihnen zählten die meisten urbanen Zentren des Reiches, namentlich Augsburg, mit rund 48 000 Einwohnern größte Stadt des Reiches und etwa viermal so groß wie Berlin zur selben Zeit. Augsburg führte eine kleine Spitzengruppe aus Nürnberg, Hamburg, Köln, Lübeck und Straßburg an, die jeweils rund 40 000 Einwohner hatten. Es folgten Städte wie Frankfurt, Bremen, Ulm und Aachen mit jeweils rund 20 000 Einwohnern sowie eine wesentlich größere Anzahl von Reichsstädten wie Nordhausen, Heilbronn, Rothenburg oder Regensburg, deren Einwohnerzahl unter 10 000 lag. Die meisten zählten sogar weniger als 4000 Einwohner, obwohl manchen (wie etwa Schwäbisch Hall) eine stattliche Anzahl von Dörfern der Umgebung unterstand. Der Einfluss der Reichsstädte beruhte zum Teil auf ihrer unmittelbaren Beziehung zum Kaisertum, die sie vor der Eingliederung in die umgebenden Territorien bewahrte. Jeder, der im Jahr 1619 den Vogt des Dorfes Eriskirch am Bodensee aufsuchte, erblickte über dem Portal des Amtshauses das Emblem der Reichsstadt Buchhorn, des heutigen Friedrichshafen (das noch immer dasselbe Wappen führt). Das „redende“ buchhornische Wappen – eine Buche und ein Signalhorn – zeigte an, dass Eriskirch unter der Herrschaft der nahe gelegenen Reichsstadt stand, die das Dorf 1472 erworben hatte. Der prominent darüber platzierte Reichsadler symbolisierte die Loyalität der Buchhorner Bürgerschaft zu Kaiser und Reich, wobei der doppelköpfige Reichsadler für die Verbindung der Kaiserkrone mit dem römisch-deutschen Königtum stand. Rund um den Reichsadler war die Ordenskette des Ordens vom Goldenen Vlies zu sehen, eines 1429 zum Schutz und zur Verteidigung der Kirche gestifteten, ursprünglich burgundischen Ritterordens. Die Aufnahme in den Orden vom Goldenen Vlies war die höchste Auszeichnung, die die Habsburger zu vergeben hatten; sie unterstrich den Anspruch ihrer Familie auf die traditionelle Rolle des Kaisers als Hüter der Christenheit. Auf der Brust des Adlers verwies der Bindenschild in den rot-weiß-roten Farben Österreichs noch einmal auf die Habsburger, auf deren Anspruch auf die Kaiserkrone und die Zugehörigkeit der Stadt Buchhorn zu dem habsburgisch regierten Reich.17
Die Reichsverfassung Der Kaiser und seine Vasallen teilten sich die Lenkung des Reiches, doch angesichts des hierarchischen Charakters der Reichsverfassung konnten die damit verbundenen Rechte und Pflichten nur ungleich verteilt sein. Der Kaiser war oberster Lehnsherr und Souverän; er verfügte über eine beträchtliche Anzahl von Hoheitsrechten, die sich nicht von seiner Herrschaft über bestimmte Territorien herleiteten, sondern direkt mit der Kaiserkrone verbunden waren. Unter diesen stachen die sogenannten Reservatrechte hervor, die der Kaiser ohne Mitwirkung oder Zustimmung des Reichstages ausüben durfte. Der genaue Umfang der kaiserlichen Vorrechte blieb absichtlich vage – schließlich hätte eine rechtliche Festlegung den misslichen Eindruck erweckt, dem universalen Herrschaftsanspruch des Kaisers seien irgendwelche Grenzen gesetzt. Allerdings sahen sich der Kaiser und die reichsunmittelbaren Fürsten gezwungen, zur besseren Bewältigung dringlicher Aufgaben die Einzelheiten ihrer Lehnsbeziehung genauer zu bestimmen. Hierdurch entstanden zusätzliche Autoritäten auf diversen niederen Ebenen der Reichshierarchie, die zwischen dem Kaiser und den einzelnen Bestandteilen seines Reiches vermittelten. Wenn mit der Kaiserkrone auch ein habsburgisches Quasi-Monopol verbunden schien, so musste die Betonung doch auf dem „Quasi-“ liegen: Einen tatsächlichen Rechtsanspruch auf den Thron besaßen die Habsburger nicht. Stattdessen mussten sie vor jeder Kaiserwahl mit den Kurfürsten verhandeln, um die Bestätigung des jeweils nächsten habsburgischen Thronanwärters sicherzustellen. Man konnte die Kurfürsten nämlich dazu bewegen, einen bereits vorab designierten Kaiser anzuerkennen, der als „erwählter römischer König“ bezeichnet wurde und der nach dem Tod seines Vaters die Herrschaft übernehmen würde. Andernfalls war ein Interregnum vorgesehen, dessen Einzelheiten die Goldene Bulle regelte: Die kaiserlichen Vorrechte würden in einem solchen Fall vom sächsischen (im Norden) beziehungsweise dem pfälzischen Kurfürsten (im Süden) ausgeübt, bis sich die sieben Kurfürsten innerhalb einer bestimmten Frist – die die Goldene Bulle ebenfalls festlegte – versammelt haben würden, um unter dem Vorsitz des Mainzer Kurfürsten (in seiner Eigenschaft als Reichserzkanzler) einen neuen Kaiser zu wählen. Hierfür konnte freilich nicht jeder Beliebige kandidieren; das Kaiseramt war schließlich keine repräsentative Staatspräsidentschaft auf Lebenszeit, sondern die Würde eines souveränen Monarchen. Gewisse „monarchische Qualitäten“ (nicht zuletzt der Abstammung) musste man also, dem Verständnis der Zeit entsprechend, schon mitbringen.
Das Anwachsen seiner Macht und Güter prädestinierte das Haus Habsburg geradezu, einen Kaiser nach dem anderen zu stellen – schließlich autorisierten die kaiserlichen Prärogativen ihren Träger zwar, weitreichende Exekutiventscheidungen zu fällen, gaben ihm aber nur spärliche Mittel an die Hand, diese auch durchzusetzen. Die Kurfürsten erwarteten deshalb vom Kaiser, dass dieser nicht nur zur Finanzierung des kaiserlichen Hofes und diverser Reichsinstitutionen seinen eigenen Besitz aufwenden, sondern auch bei der Verteidigung des Reiches gegen die Osmanen und andere, christliche Feinde einen Großteil der Kosten tragen würde. Allerdings erkannten die Kurfürsten, dass Veränderungen in der Kriegführung dies zunehmend unmöglich machten, wenn nicht auch der Rest des Reiches sein Scherflein beitrug. Die Reichsfürsten und -städte sahen dies ebenfalls ein, und die Bereitschaft, Reichssteuern zu zahlen, wurde zur entscheidenden Voraussetzung der Reichsunmittelbarkeit: Wer Reichssteuern zahlte, war anders als die große Mehrheit der Grundherren und Städte, die lediglich in die Staatskassen der ihnen übergeordneten Territorien einzahlten. Zahlungen in die Reichskasse waren als „Römermonate“ bekannt – nach den Kosten der Eskorte, die Karl V. zu seiner Krönung nach Rom geleiten sollte. Ein jedes Territorium wurde nach einem Schlüssel veranlagt, durch den sein spezifischer Zahlungsanteil am Monatssold von 24 000 Soldaten festgelegt wurde. Abgaben wurden entweder als Bruchteile oder als Vielfaches dieses Basistarifs erhoben; eingetrieben wurden sie entweder als Einmalzahlungen oder in Raten über mehrere Monate, manchmal sogar Jahre.
Bis 1521 war die Einschreibung in das Reichssteuerregister zum entscheidenden Faktor dafür geworden, ob ein bestimmtes Territorium auf den Reichstagen vertreten war oder nicht, mithin ob es als Reichsstand anerkannt wurde oder nicht. Der Reichstag war kein Parlament im heutigen Sinne, sondern verkörperte das frühneuzeitliche Repräsentationsprinzip: Sobald es um Angelegenheiten ging, die alle betrafen, war der Monarch verpflichtet, sich mit den „edelsten“ seiner Untertanen – dem Adel – darüber zu beraten. Entsprechend der hierarchischen Gesamtstruktur des Reiches fanden die Beratungen des Reichstages in drei gesonderten Kollegien (oder Kurien) statt: Kurfürsten, Fürsten und Reichsstädte blieben in ihren Kurien jeweils unter sich. Insbesondere die Zusammensetzung des Reichsfürstenrates befand sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch im Wandel; die bestehenden Mitglieder des auch als Fürstenbank bekannten Gremiums, die über jeweils eine Virilstimme verfügten, zögerten, den wesentlich zahlreicheren Grafen und Prälaten, die sich bislang eine Handvoll Stimmen (die sogenannten Kuriatstimmen) geteilt hatten, einen gleichberechtigten Platz in ihren Reihen zu gewähren. Die Initiative im Reichstag lag beim Kaiser, der die Themen der Beratung vorschlug. Im Anschluss an diese fällten die einzelnen Kurien einen Mehrheitsentscheid, wobei der Reihe nach jeder Stimmberechtigte seine Meinung zum Gegenstand kundtat (oder durch einen bevollmächtigten Vertreter mitteilen ließ); es galt eine strenge Rangfolge. Anschließend berieten sich jeweils zwei Kollegien miteinander: In der Regel sprachen die Kurfürsten zuerst mit dem Reichsfürstenrat, bevor sie sich den Vertretern der Reichsstädte zuwandten. Wenn dann schließlich – in einem nicht selten langwierigen Prozess – ein für alle Seiten akzeptabler Kompromiss formuliert worden war, wurde dieser gemeinsame Beschluss aller drei Kurien als „Empfehlung“ dem Kaiser vorgelegt – und in der Tat konnte dieser frei entscheiden, ob er seine Zustimmung erteilte oder nicht. Stimmte er zu, so wurde der betreffende Entschluss als „Reichsschluss“ in den bei Ende des Reichstages erlassenen „Reichsabschied“ aufgenommen und erlangte so bindende Wirkung. Als Reaktion auf neu entstandene Probleme hatte sich das System der Reichstage nach 1480 verhältnismäßig rasch herausgebildet, und seine Gesetzgebung schuf Präzedenzfälle, die dann in die Reichsverfassung aufgenommen wurden. Wenngleich der Kaiser formal nicht verpflichtet war, den Reichstag zu konsultieren, so wurden die Reichsabschiede mit der Zeit doch zur einzigen Möglichkeit für ihn, reichsweit verbindliche Abmachungen zu treffen; außerdem erlaubten es die Reichstagsberatungen dem Kaiser, sich ein Bild von der Meinungs- und Stimmungslage unter den Reichsständen zu machen, und verliehen seinen Entscheidungen größere Legitimität. Obwohl der Reichstag eine so schwerfällige Institution war, beriefen die Kaiser des 16. Jahrhunderts doch mit einiger Regelmäßigkeit Reichstage ein, die ein insgesamt beträchtliches Korpus von Gesetzen verabschiedeten sowie – wegen der kostspieligen Verteidigung gegen die Osmanen – immer regelmäßigere Steuerzahlungen bewilligten (siehe Kapitel 4).
Zusätzliche Abgaben wurden erhoben, um die andere verfassungsmäßige Hauptaufgabe des Reichstags wahrzunehmen, nämlich die innere Ordnung des Reiches zu sichern sowie Streit unter den Reichsfürsten und -städten zu schlichten. Der Wormser Reichstag von 1495 beschloss einen „Ewigen Landfrieden“, wodurch der Kaiser und alle seine Vasallen verpflichtet wurden, ihre Streitigkeiten zur unabhängigen Schlichtung vor ein neu geschaffenes Höchstgericht, das Reichskammergericht, zu bringen, das ab 1527 in der Reichsstadt Speyer residierte. Der Kaiser durfte lediglich den Präsidenten des Reichskammergerichts sowie einige seiner Beisitzer ernennen. Die Reichsstände schlugen dann weitere Kandidaten vor, die von den amtierenden Richtern bestätigt werden mussten. Der Amtseid, den sie bei Antritt ihrer Tätigkeit zu leisten hatten, entband sie von jeglichen Pflichten, die sie einem territorialen Landesherrn gegenüber haben mochten. Das Rechtssystem des Heiligen Römischen Reiches hat in der Nachwelt einen ziemlich schlechten Ruf gehabt, nicht zuletzt, weil es an der Lösung jener Probleme scheiterte, die schließlich den Dreißigjährigen Krieg herbeiführten. Allerdings erlaubte seine Weiterentwicklung dem Reich einen Fortschritt von brutaler Selbstjustiz zu einem immerhin einigermaßen geregelten Fehdewesen und schließlich zur friedlichen Klärung vor Gericht. Dort ging es nicht so sehr darum, eine absolute Wahrheit oder Schuld festzustellen, sondern allseits akzeptable – und folglich auch umsetzbare – Lösungen zu finden. In den 1520er-Jahren wurde das Rechtssystem erweitert und befasste sich fortan auch mit Beschwerden und Unruhen, die innerhalb einzelner Territorien aufgekommen waren, sowie mit Streitigkeiten zwischen Territorien. Die Kurfürsten und die größeren Reichsstände schufen zwar eigene Gerichtswesen, die teils außerhalb der Jurisdiktion des Reichskammergerichts lagen; Berufungen an die und Interventionen seitens der Reichsgerichtsbarkeit blieben jedoch weiterhin möglich. Der Kaiser akzeptierte die weitgehende Unabhängigkeit des Reichskammergerichts nicht zuletzt deshalb, weil er selbst noch ein weiteres Gericht ins Leben gerufen hatte. Dieser Reichshofrat residierte in Wien und befasste sich mit allen Fragen, welche unmittelbar die kaiserlichen Vorrechte betrafen. Da jene aber notorisch unklar definiert waren, ließen sich auf ihrer Grundlage auch Verfahren in Angelegenheiten eröffnen, für die eigentlich das Reichskammergericht zuständig sein sollte. Wenngleich die Schaffung des Reichshofrates die Möglichkeit von Zuständigkeitskonflikten zwischen den beiden höchsten Gerichten des Reiches heraufbeschwor, schlug doch in Wien nun so etwas wie das „zweite juristische Herz“ des Heiligen Römischen Reiches, das im Fall einer Überlastung des Reichskammergerichts mit einem „erhöhten Puls“ für Abhilfe sorgen konnte.
Die Entscheidungen der Gerichte wurden durch regionale Institutionen vollstreckt, die auf der Ebene zwischen dem Reich und seinen Territorien angesiedelt waren. Die einzelnen Territorien wurden einem von zehn Reichskreisen zugeordnet, aus denen Kandidaten für das Reichskammergericht ausgewählt und die zu dessen Finanzierung notwendigen Beiträge erhoben wurden. Außerdem waren auf der Ebene der Reichskreise spezielle Reichssteuern und Truppenkontributionen fällig, die zur Wahrung des inneren Friedens oder zur Verteidigung des Reiches nach außen herangezogen werden konnten. Bis 1570 hatten sich im Reichsrecht genügend Normen herausgebildet, um einem autonomen Vorgehen der Reichskreise beträchtlichen Handlungsspielraum zu eröffnen. Jeder Reichskreis hatte seine eigene Versammlung, den Kreistag, auf dem jedoch – anders als auf dem Reichstag – jeder Vertreter eine eigene Stimme hatte, die in einem gemeinsamen Plenum zum Tragen kam; somit erhielten die kleineren Stände ein proportional größeres Gewicht. Die Kreistage wurden entweder vom Kaiser oder durch einen Reichsabschied einberufen, oder sie trafen sich auf Initiative der dazu in der jeweiligen Region berechtigten Landesfürsten (in der Regel waren dies ein weltlicher und ein geistlicher Fürst je Reichskreis). Die Kreistage boten ein zusätzliches Forum zur Klärung von Streitigkeiten, Formulierung politischer Strategien und zur Abstimmung des sich daraus ergebenden Handelns. Ihre Entwicklung unterschied sich in Abhängigkeit davon, wie regelmäßig sie von ihren Mitgliedern in Anspruch genommen wurden. Die Gebiete der Habsburger waren in einem Burgundischen und einem Österreichischen Reichskreis zusammengefasst, die naturgemäß habsburgischer Kontrolle unterstanden; die böhmischen Territorien waren von der Organisation der Reichskreise ausgenommen. Die vier rheinischen Kurfürsten schlossen sich zum Kurrheinischen Reichskreis zusammen, obgleich große Teile ihrer Territorien fern der Rheinebene zerstreut lagen. Die kleineren Territorien des Westens und des Südens fanden sich in dem kompakteren Niederrheinischen (oder Westfälischen), dem Oberrheinischen, Schwäbischen, Fränkischen sowie dem Bayerischen Reichskreis vereint. Letzterer wurde vom Herzogtum Bayern dominiert, dem mit 800 000 Einwohnern größten Territorium, das reicher als die Kurfürstentümer war (und 1623 selbst zum Kurfürstentum aufstieg). Allein die Existenz 13 weiterer Kreisstände – darunter der Erzbischof von Salzburg – verhinderte eine völlige Alleinherrschaft des bayerischen Herzogs über den Bayerischen Reichskreis. Die Gebiete im Norden unterteilten sich in den Obersächsischen Reichskreis im Osten und den Niedersächsischen Reichskreis im Westen. Der erstgenannte wurde von den Kurfürstentümern Brandenburg und Sachsen dominiert; im zweiten herrschte größeres Gleichgewicht zwischen einer ganzen Reihe von Bistümern und Herzogtümern.
Die politische Kultur des Alten Reiches Die meisten Inhaber von Reichslehen waren somit zugleich Reichsstände und Kreisstände, das heißt, sie waren sowohl im Reichstag als auch in ihrem jeweiligen Kreistag vertreten. Der Kaiser konnte also entweder in seiner Eigenschaft als ihr unmittelbarer Lehnsherr an sie herantreten, oder er bediente sich dazu seiner Vertreter im Reichstag, an den Reichsgerichten oder bei den Kreistagen. Über die allermeisten Einwohner seines Reiches konnte der Kaiser, da diese unter der Herrschaft eines oder mehrerer ihm untergeordneter Landesfürsten lebten, nicht direkt verfügen – die Untertanen in seinen eigenen Erblanden bildeten die Ausnahme. Durch ihre Mitwirkung in den diversen Institutionen des Alten Reiches konnten die Territorialfürsten als Sachwalter der „teutschen Libertät“ auftreten, wie sie in der Reichspolitik des 17. Jahrhunderts aufgefasst wurde. Bei diesem Freiheitsverständnis, das keineswegs mit dem Gedanken einer Gleichheit oder Brüderlichkeit aller Untertanen einherging, drehte sich alles um eine Reihe von ständischen Libertäten, durch die einer rechtlich bestimmten, als Körperschaft greifbaren Gruppe von Individuen bestimmte Privilegien, Exemtionen und Rechte zugesprochen wurden. Die Territorialherren erfreuten sich – in ihrer Eigenschaft als Reichsstände – einer Reihe von Sonderrechten, die sie vor ihren Vasallen oder Untertanen auszeichneten. So besaßen sie etwa das Privileg, vom Kaiser bei bestimmten Entscheidungen zurate gezogen zu werden und somit an der gemeinschaftlichen Regierung des Reiches beteiligt zu sein. Die reichsständischen Freiheiten brachten jedoch auch Pflichten mit sich – so etwa die Pflicht, Rechte und Selbstbestimmung des eigenen Territoriums, der eigenen Untertanen und ihrer Gemeinschaften zu verteidigen. An diesem Punkt tritt das ausgeklügelte System der Gewaltenteilung und der gegenseitigen Kontrolle, durch das der römisch-deutsche „Reichskoloss“ sich auszeichnete, am deutlichsten zutage. Jeder Grundherr oder Landesfürst im ganzen Reich war darauf bedacht, seinen jeweiligen Platz in der Reichshierarchie zu behaupten. An so etwas wie Unabhängigkeit dachte keiner. Selbst den größten Kurfürstentümern mangelte es an den notwendigen Ressourcen für eine unabhängige politische Existenz. Stattdessen bezogen sämtliche Landesherren ihre Autorität und ihr Ansehen aus ihrer Zugehörigkeit zum römisch-deutschen Kaiserreich, denn diese erhob sie zugleich über die Adligen anderer Länder, die in ihren Augen „nur“ Untertanen „bloßer“ Könige waren. Allerdings unterschieden die Vertreter des reichsständischen Adels durchaus zwischen Kaiser und Kaiserreich: Loyal waren sie beiden gegenüber, aber ihre Bindung an den Kaiser war persönlicher Natur; dem Reich fühlten sie sich als kollektive Körperschaft verpflichtet.
Im 16. Jahrhundert setzte überall in Europa – und also auch im Heiligen Römischen Reich – eine Transformation der politischen Systeme ein, in deren Verlauf die persönlichen Beziehungen zu einem Lehnsherrn zunehmend durch die Subordination unter einen abstrakten, unpersönlichen Staat ersetzt wurden, dessen Lebensdauer die seiner einzelnen Herrscher überstieg. Die Krönung Kaiser Maximilians II. im Jahr 1562 war die letzte Kaiserkrönung, an der sämtliche Kurfürsten persönlich teilnahmen. Während niederadlige Grafen und Prälaten, die um ihre volle Anerkennung als Reichsstände bemüht waren, auch weiterhin selbst beim Reichstag erschienen, ließen andere, regierende Herren ihre Interessen in der Regel durch gelehrte Juristen vertreten. Viele Reichsstädte scheuten die hohen Kosten, die mit dem Entsenden einer ganzen Delegation verbunden waren, und entsandten einen einzigen Vertreter, der für sie abstimmen sollte. Natürlich behielten persönliche Treffen in einer Zeit, in der ein Brief von Berlin nach Heidelberg bis zu zwei Wochen unterwegs sein konnte, weiterhin große Bedeutung. Im direkten Gespräch konnten die Herren gemeinsame Interessen entdecken – zum Beispiel die Jagd oder den Kunstgenuss –, die unter Umständen jahrelange politische oder sogar konfessionelle Spannungen zu lösen vermochten. Und wenn selbst ein gemeinsamer Gottesdienstbesuch oder der reichliche Genuss alkoholischer Getränke keine gesellige Stimmung herbeizuführen vermochten, hielt die vielschichtige Reichsverfassung immer noch genug Möglichkeiten zum Dialog bereit.
Dem raschen „Durchdrücken“ eines bestimmten Anliegens zogen die meisten politischen Akteure des Reiches ein geduldiges Taktieren vor: Man wartete ab, bis die Leidenschaften sich etwas gelegt hatten, oder man verschob die Verhandlungen gleich auf eine andere Organisationsebene der Reichsverfassung, wo die Verbündeten zahlreicher oder die Erfolgsaussichten größer waren. Das lange Beratungsverfahren bot die Chance, unliebsame Lasten ganz einfach loszuwerden, indem man sich auf eine Änderung der Umstände berief, die seit Gesprächsbeginn eingetreten sei. Oder man zögerte den Abschluss hinaus, indem man dringenden Rücksprachebedarf mit weiteren Parteien geltend machte. Die Reichspolitik vollzog sich so durch eine Reihe formeller, in unregelmäßigen Abständen stattfindender Versammlungen von Herrschern und Abgesandten. Dazu kamen bei Bedarf weitere, kleinere Zusammenkünfte zur Erörterung spezifischer Fragen etwa des Münzwesens oder der Steuerpolitik. In den Zwischenzeiten wurde der Kontakt durch Boten oder informelle persönliche Treffen aufrechterhalten. Die große Anzahl von – jeweils für sich genommen – recht schwachen Einzelgliedern erschwerte politische Alleingänge, wirkte dem Extremismus entgegen und verwässerte jede Absicht so weit, dass alle sich auf den entstehenden Kompromiss einigen konnten.
Gebremst durch diesen schwerfälligen Mechanismus, konnte das Heilige Römische Reich nur mit Mühe ein entschlossenes Handeln an den Tag legen, doch verlieh er ihm zugleich eine besondere Stärke, die es dem Reich ermöglichte, den längsten und blutigsten Bürgerkrieg seiner Geschichte zu überstehen. In der modernen Demokratie übernimmt der Staat die Verantwortung dafür, dass die im Mehrheitsverfahren gefassten Beschlüsse auch umgesetzt werden. Die in der Abstimmung unterlegene Minderheit sieht sich dann der ganzen Macht des Staates gegenüber – und wenn sie sich dennoch zum Widerstand entschließt, dann kann die Situation in Gewalt ausarten, denn für eine Missachtung der Staatsgewalt gibt es keine rechtliche Grundlage. Im Alten Reich war eine solche Trennung unbekannt, da Gesetzgebung (Legislative) und Gesetzesvollzug (Exekutive) im Prinzip die gemeinsame Aufgabe von Kaiser und Reichsständen blieben. Die Minderheit stand also stets gegen die Mehrheit – aber niemals gegen das Reich an sich. Es war, als wäre der Prozess der Entscheidungsfindung noch nicht voll ausgereift und bliebe selbst die Mehrheitsmeinung so lange vorläufig, bis auch die Minderheit ein Einsehen gehabt hätte. Dieser Sachverhalt war offenkundig problematisch – ermöglichte er es den Vertretern einer abweichenden Meinung doch, selbst dann noch auf die völlige Umkehrung einer unliebsamen Entscheidung zu hoffen, wenn die Mehrheit, deren Meinungsäußerung so dreist ignoriert wurde, schon längst frustriert war. Das ständige Aufschieben kontroverser Entscheidungen konnte eine endgültige Regelung unmöglich machen. Allerdings blieb die Gefahr eines Gewaltausbruchs erheblich reduziert, solange ein Kompromiss zumindest möglich schien. Außerdem lehnte keine der beiden Seiten das Reich als solches ab, welches so das akzeptierte Forum der Entscheidungsfindung blieb. Wer eine abweichende Meinung vertrat, lehnte dadurch eine bestimmte Auslegung der Gesetze ab, nicht jedoch die Institutionen, die diese Gesetze erließen oder durchsetzten. Während die Bewohner des Heiligen Römischen Reiches also durchaus über die korrekte Interpretation der Reichsverfassung stritten, bestritten sie doch niemals das Existenzrecht des Reiches an sich. Am Ende sollte auch ihr Friedensschluss im Rahmen des Reiches erfolgen.