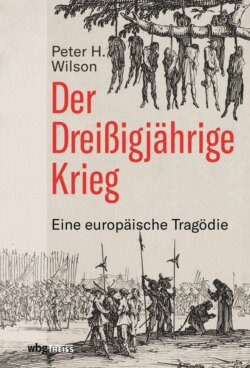Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Peter H. Wilson - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Wiedererstarken des Katholizismus
ОглавлениеDie führenden Köpfe der Habsburger gelangten zu der Überzeugung, dass die Zukunft ihrer Dynastie ganz davon abhing, ob sie den Katholizismus wieder zur Grundlage politischer Loyalität würden machen können. Das war durchaus kein unrealistisches Ziel, bedenkt man, dass eine Minderheit der Stände noch immer katholisch und die protestantische Seite von heftigem Streit zerrüttet war. Zudem blieben – bei allen konfessionellen Differenzen – auch die meisten Protestanten treue Untertanen der Habsburger. Die in den 1570er-Jahren erzwungenen religiösen Freiheiten waren – als besondere Privilegien – dem Adel und den Städten einzelner habsburgischer Länder verliehen worden und mussten außerdem von allen Mitgliedern der betroffenen Stände als Bestandteil ihrer gemeinsamen Standesrechte angenommen werden. Den Ständen fehlte eine Plattform, auf der sie ihr Verhalten dem Herrscherhaus gegenüber koordinieren konnten; eine brauchbare Generalversammlung aller Landstände der Habsburgermonarchie war nämlich noch nicht zustande gekommen. In diesem Zusammenhang wirkte sich die Dreiteilung von 1564 tatsächlich zum Vorteil der Herrscherfamilie aus, da sie die alte Sitte, mit jedem der Landstände einzeln zu verhandeln, stärkte und überdies dafür sorgte, dass ein österreichischer Generallandtag nach dem frühen 17. Jahrhundert nie wieder zusammentrat. Die Weigerung Böhmens, die anderen vier Länder der böhmischen Krone als gleichberechtigt anzuerkennen, hatte schon zuvor bewirkt, dass es ab 1518 für beinah ein Jahrhundert keinen böhmischen Generallandtag mehr gegeben hatte. Die Initiative lag also in den Händen der Habsburger, und deren Aussichten auf Erfolg standen nicht schlecht – vorausgesetzt, die verschiedenen Zweige der Familie würden geschlossen auftreten und an einem Strang ziehen.
Rudolf II. Als Kopf der österreichischen Hauptlinie des Erzhauses war es an Rudolf II., die Führungsrolle zu übernehmen, nachdem er 1576 als Nachfolger seines verstorbenen Vaters Maximilian Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geworden war.45 Im Alter von elf Jahren war Rudolf 1563 zusammen mit seinem jüngeren Bruder Ernst nach Madrid geschickt worden, um dort fern der Gefahr einer protestantischen „Ansteckung“ erzogen zu werden und außerdem die Beziehungen zu dem mächtigen spanischen Zweig der Familie zu pflegen. Das geradezu sprichwörtlich düstere und formelle Umfeld des spanischen Hofs hinterließ bei beiden Knaben bleibenden Eindruck; auch die raue Wirklichkeit monarchischer Machtausübung erlebten sie dort aus nächster Nähe. Der von Schiller verewigte Don Carlos, Infant von Spanien und Sohn Philipps II. aus dessen erster Ehe, war psychisch labil und wurde – nachdem er einen geradezu pathologischen Hass auf seinen Vater entwickelt hatte – inhaftiert. Carlos’ ohnehin zarte Gesundheit wurde durch Hungerstreiks des Prinzen sowie rabiate Gegen- und Heilmaßnahmen seiner Wärter und Ärzte weiter zerrüttet. Sein Tod im Alter von nur 23 Jahren löste 1568 sogleich Gerüchte aus, er sei vergiftet worden, um eine politische Last loszuwerden. Die aufständischen Niederländer beschuldigten später ausdrücklich Philipp II., er habe seinen Sohn ermorden lassen. Wenngleich dieser Vorwurf bestimmt nicht zutrifft, trug das unerbittliche Verhalten des Königs, der sich nicht vom Schreibpult und seinen Staatsgeschäften wegrührte, während sein Sohn qualvoll zugrunde ging, doch Züge von entsetzlicher Grausamkeit. Gut möglich, dass dieses Geschehen Rudolf davon überzeugte, er werde es mit der unerbittlichen Pflichterfüllung seines spanischen Onkels niemals aufnehmen können. Jedenfalls bemerkten die Zeitgenossen im Verhalten des jungen Prinzen eine Veränderung, als dieser 1571 nach Wien zurückkehrte. Obwohl er das steife spanische Hofzeremoniell an die Donau mitbrachte, war klar, dass er für das Königreich seines Onkels nur wenig übrighatte. Entgegen dem beträchtlichen Druck seiner Familie, er solle gefälligst für einen männlichen Erben sorgen, weigerte Rudolf sich, Philipps Lieblingstochter Isabella zu heiraten, und zeugte stattdessen etliche illegitime Kinder – mindestens sechs – mit seiner langjährigen Geliebten Katharina Strada. Die enge Beziehung zu Katharina war eine Ausnahme, denn Rudolf konnte mit den Lebenden ansonsten nur wenig anfangen: Immer mehr zog er sich in einen übersteigerten Ahnenkult zurück. Diejenigen, denen doch einmal eine Audienz mit ihrem Kaiser gewährt wurde – was oft erst nach monatelangem Warten geschah –, waren von Rudolfs Intelligenz, seiner großen Wissbegierde und umfassenden Bildung beeindruckt. Der Kaiser wurde ein passionierter Kunstsammler und Mäzen von Astronomen, Alchemisten und Poeten. Seine Jahre in Spanien hatten ihm einen übergroßen Sinn für die eigene Majestät und Erhabenheit eingeimpft, der ihn davon abhielt, Verantwortung an jene zu delegieren, die ihm helfen wollten. Wenn Rudolf auch keineswegs arbeitsscheu war, so drängten sich in seinem Kopf doch zu viele Pläne und Ideen auf einmal, was Unentschlossenheit zur Folge hatte – dies umso mehr, als selbst kleinste Misserfolge ihn sofort entmutigten.
Diese Charakterzüge Rudolfs II. wurden gleich zu Beginn seiner Regierungszeit offenbar, als er beschloss, mit der Stärkung des Katholizismus in seiner Residenzstadt Wien ein positives Zeichen zu setzen. Im Jahr 1577 hatten Angehörige des örtlichen Klerus und der Wiener Laienschaft gemeinsam die Fronleichnamsbruderschaft wiederbelebt und planten für den Mai des darauffolgenden Jahres eine große Prozession durch ganz Wien. An der Spitze dieses Fronleichnamszuges marschierte Rudolf höchstpersönlich, begleitet von seinen Brüdern Ernst und Maximilian sowie dem Herzog Ferdinand von Bayern und anderen katholischen Würdenträgern. Die Prozession stellte eine unmissverständliche Provokation an die Adresse der überwiegend protestantischen Wiener Bevölkerung dar, vergleichbar etwa den alljährlichen Märschen des (allerdings protestantischen) Oranier-Ordens im heutigen Belfast in Nordirland. Als lutherische Ladenbesitzer und Marktleute sich weigerten, den Weg frei zu machen, war die kaiserliche Leibwache nicht zimperlich, wobei auch der Milchkrug eines Händlers umgestoßen wurde. Die daraufhin losbrechenden Ausschreitungen, die als „Wiener Milchkrieg“ in die Geschichte eingingen, verstörten den Kaiser zutiefst und lösten in den Jahren 1579/80 eine ernste Erkrankung aus, von der er sich nie mehr ganz erholen sollte. Es ist zu bezweifeln, dass Rudolf tatsächlich, wie manchmal behauptet, an einer wahnhaften Psychose litt (wenn auch mindestens eines seiner illegitimen Kinder ebenfalls schizoide Züge aufwies). Stattdessen diagnostizierten Rudolfs Ärzte eine schwere Depression beziehungsweise – in der Sprache der Zeit – „Melancholie“.46 Vermutlich trug die hohe Intelligenz des Kaisers noch zu seinem Leiden bei, denn sie ließ ihn mit scharfem Blick wahrnehmen, wie groß der Abstand zwischen seinem eigenen Majestätsgefühl einerseits und den harschen Realitäten einer eingeschränkten Handlungsfähigkeit andererseits tatsächlich war. Obgleich er nie in einem herzlichen Verhältnis zu seiner Mutter gestanden hatte, beraubte ihn ihr Weggang nach Spanien 1581 doch einer seiner wenigen verbliebenen Vertrauenspersonen. Nach der Verlegung seines Hofes nach Prag zwei Jahre später schottete der Kaiser sich noch stärker ab als zuvor, verkroch sich im Hradschin, der Prager Burg hoch über der Stadt, weigerte sich tagelang, auch nur eine Menschenseele zu sehen oder selbst wichtige Dokumente zu unterzeichnen. Im März 1591 lief eines seiner chemischen Experimente aus dem Ruder, versengte Rudolfs Bart und Wange und tötete einen früheren Oberststallmeister, der das Pech hatte, zum Zeitpunkt der Explosion direkt neben seinem Kaiser zu stehen. Dieser Unglücksfall stürzte Rudolf in nur noch tiefere Verzweiflung, und er schloss sich nun über Monate am Stück in seinen Gemächern ein. Rudolfs hartnäckige Weigerung, zu heiraten, verursachte unter seinen Verwandten wachsende Beunruhigung und veranlasste Philipp II. dazu, 1597 die Vermählung seiner Tochter Isabella mit einem Bruder des Kaisers, dem Erzherzog Albrecht, in die Wege zu leiten. Als die Heirat zwei Jahre später tatsächlich zustande kam, vertiefte dies Rudolfs Misstrauen gegenüber Spanien und zwang ihn schließlich dazu, sich den Enttäuschungen seines eigenen Lebens zu stellen. Seine förmliche Besessenheit von der Astrologie begünstigte einen Verfolgungswahn, der sich mit dem Herannahen der Jahrhundertwende weiter verschlimmerte – insbesondere, nachdem Rudolf die Vorhersagen des Astronomen und Mathematikers Tycho Brahe für den September 1600 dahingehend interpretiert hatte, dass ein Mordkomplott gegen ihn, den Kaiser, im Gange sei. Auch wurden die Stimmungsschwankungen Rudolfs immer extremer; er schlug nach Höflingen und verletzte einen von ihnen sogar ernsthaft.
Melchior Khlesl Der Umzug Rudolfs II. nach Prag und sein anschließender Nervenzusammenbruch verstärkten die Fliehkräfte, die nach allen Seiten an der Habsburgerdynastie zerrten. Die Regierungsverantwortung in den österreichischen Erbländern wurde Rudolfs jüngerem Bruder Ernst übertragen, doch weder Ernst noch sein Nachfolger (ab 1595) Matthias vermochten viel Zeit für die Stärkung des Katholizismus aufzuwenden – das überließen sie dem Sohn eines lutherischen Bäckermeisters aus Wien: Melchior Khlesl. Der war als Student an der Wiener Universität zum katholischen Glauben konvertiert und stieg, mit der Unterstützung des Jesuitenordens und des Hauses Habsburg, bis 1580 zum Kanzler seiner Alma Mater auf. 1588 wurde er zum Bischof von Wiener Neustadt, zehn Jahre darauf zum Bischof von Wien erhoben. Khlesl, ein raffinierter, mit allen Wassern gewaschener Mann, dessen scharfe Zunge seinem Scharfsinn in nichts nachstand, machte sich rasch zahlreiche Feinde – vor allem weil er mit der Zeit zu der Überzeugung gelangte, er selbst sei als Einziger kompetent genug, die Habsburger zu beraten, deshalb etablierte Machtstrukturen ignorierte und lieber auf eigene Faust Politik betrieb. Man hat ihn, der seinen Machiavelli genauso gründlich studiert hatte wie die Bibel, oft als waschechten Machtpolitiker im Gewand eines Geistlichen dargestellt. Von einem Kardinal Borromäus trennten ihn fraglos Welten: Ab 1590 verbrachte Khlesl mehr Zeit am Prager Kaiserhof als in seinen beiden Bistümern. Diese Rückkehr des Absentismus allein spricht Bände im Hinblick auf das quälend langsame Voranschreiten der katholischen Kirchenreform. Dennoch blieb die Religion ein zentraler Bestandteil von Khlesls Weltbild, wenn auch eher als Grundlage der rechten Ordnung denn als gefühlsmäßige, spirituelle oder gar mystische Bezugsgröße.47
Khlesl nahm Wien ins Visier, wo sich der Protestantismus munter ausbreitete – unter anderem dank der Existenz des Ständehauses der niederösterreichischen Landstände, zahlreicher Stadtpalais des lutherischen Adels sowie des mittlerweile zur festen Tradition gewordenen „Auslaufs“, der jeden Sonntag Tausende Wiener ihre Stadt verlassen ließ, um auf den umliegenden lutherischen Landgütern Gottesdienst zu halten. Der bereits erwähnte Wiener Milchkrieg von 1578 diente als Vorwand, einen katholischen Magistrat einzusetzen und das Abhalten von lutherischen Gottesdiensten im Ständehaus zu untersagen; wer außerhalb der Stadt einen protestantischen Gottesdienst besuchte, musste mit Geldstrafen rechnen. Ein Jahr nach Beginn seines Rektorats entschied Khlesl, dass an der Wiener Universität fortan nur noch Katholiken einen Abschluss erlangen sollten. In der Folge arbeitete er mit den neuen Ratsherren zusammen, um rund 90 der 1200 Häuser innerhalb der Stadtmauern Wiens in kirchlichen Besitz zu überführen, damit sie als Gotteshäuser oder katholische Bildungseinrichtungen verwendet werden konnten.48 Die katholische Präsenz in der Stadt wurde durch die Rückkehr des kaiserlichen Hofes nach dem Tod Rudolfs II. im Jahr 1612 weiter verstärkt. Hofleute, Adlige und ihre Dienerschaft verdrängten die lutherischen Wiener Stadtbürger aus den begehrten Wohnlagen rund um die Hofburg, insbesondere während der Inflationszeit der frühen 1620er-Jahre, als reiche Katholiken sich hübsche Palais in „langer“, das heißt entwerteter Münze leisteten. Aber schon in der Zeit von Rudolfs Thronbesteigung bis zum Jahr 1594 hatte sich die Anzahl der Wiener Katholiken auf 8000 vervierfacht.
Der Zusammenbruch des Bauernaufstands bis 1598 ermunterte Khlesl, seine Aktivitäten auf ländliche Gebiete auszudehnen. Der Landeshauptmann von Oberösterreich wurde mit einer bewaffneten Eskorte ausgesandt, um katholische Gemeindepriester auf ihre neuen Posten zu geleiten und außerdem die protestantische Ständeschule in Linz zu schließen. Im Jahr darauf zog Khlesl selbst an der Spitze von 23 000 niederösterreichischen Pilgern in das steirische Mariazell, womit er eine Tradition begründete, die zunächst unregelmäßige, ab 1617 dann sogar jährliche Wiederholung fand. Andere Pilgerstätten wurden ausgebaut, vor allem solche, die einen Bezug zur österreichischen Geschichte oder zu den Habsburgern aufwiesen; so sollte die Verknüpfung von katholischer Frömmigkeit und Obrigkeitstreue weiter gestärkt werden. Diese Entwicklungen blieben nicht ohne Widerspruch. Als 1600 in Linz die Fronleichnamsprozession eingeführt werden sollte, ergriffen wütende Linzer Bürger den Zelebranten und ertränkten ihn im Fluss. Wie bereits der Wiener Milchkrieg diente auch diese Episode als Vorwand, die Rechte der Protestanten noch weiter zu beschneiden; im vorliegenden Fall wurden sämtliche lutherischen Lehrer aus Oberösterreich ausgewiesen. Als die Salzbergleute des Salzkammerguts aus Protest ihr Handwerkszeug in den Seen ihrer Heimat versenkten, entsandte Erzherzog Matthias im Februar 1602 1200 Bewaffnete, die sie wieder an die Arbeit treiben sollten. So eindrucksvoll indes das Wiedererstarken des Katholizismus im Habsburgerreich auf den ersten Blick scheinen mochte, fehlte ihm doch ein festes Fundament: Noch um 1600 lehnten drei Viertel der 50 000 Einwohner Wiens den offiziellen Glauben ihrer Stadt ab.
Die katholische Strategie Größeren Erfolg brachten die Rekatholisierungsmaßnahmen in Innerösterreich, wo die Verbindung von religiöser und politischer Loyalität, nach wenig verheißungsvollen Anfängen, systematischer verfolgt wurde. Der Erzherzog Karl war ein frommer Katholik, hatte sich jedoch mit Blick auf seine Schulden und die Höhe seines Etats zur Grenzverteidigung 1578 gezwungen gesehen, das bereits erwähnte Brucker Libell einzugehen. Zwar hatte er gehofft, dies geheim halten zu können, aber zum Entsetzen des Erzherzogs konnten es die protestantischen Stände Innerösterreichs im Hochgefühl ihres Triumphs kaum erwarten, eine unautorisierte Druckfassung der ihnen gemachten Zugeständnisse zu veröffentlichen. Papst Gregor XIII. zeigte wenig Verständnis für diesen (wie er es wohl sah) obrigkeitlichen Fauxpas – und exkommunizierte den Erzherzog umgehend. Der traf sich, gestraft wie er war, im Oktober 1579 in München mit seinem Bruder, Erzherzog Ferdinand von Tirol, und seinem Schwager, Herzog Wilhelm V. von Bayern. Seine Verwandten akzeptierten Karls Beteuerung, der in Umlauf gebrachte Text des Brucker Libells verzerre zwar seine tatsächlichen Absichten, doch wäre eine Rücknahme der nun allgemein als gültig betrachteten Zugeständnisse viel zu gefährlich. Gerade einmal drei Monate zuvor hatten 5000 Wiener vor der Hofburg gegen die katholische Religionspolitik der Habsburger demonstriert. Keiner der Erzherzöge verfügte über mehr als eine Handvoll Truppen; alles, was ihre Gegner dazu drängen konnte, gemeinsame Sache zu machen, war deshalb tunlichst zu vermeiden. Eine wesentlich weniger auf Konfrontation ausgerichtete Politik musste also her, und das Münchner Treffen führte zur Formulierung eines entsprechenden Programms, das gewissermaßen die Blaupause für alle weiteren religionspolitischen Maßnahmen der Habsburger bis 1618 abgab.
Darin wurde festgehalten, dass die zum gegenwärtigen Zeitpunkt gemachten Zugeständnisse das absolute Maximum an Entgegenkommen darstellten, mit dem die Protestanten rechnen konnten. Anstatt bestehende protestantische Privilegien aufzuheben, würden die Erzherzöge in Zukunft auf deren möglichst „katholischer“ Interpretation beharren, wodurch jeglichen protestantischen Aktivitäten, die in den entsprechenden Vereinbarungen nicht ausdrücklich (positiv) gestattet worden waren, ein Riegel vorgeschoben werden sollte. Die Habsburger hatten durchaus kein Interesse daran, die protestantischen Stände völlig niederzuwerfen, denn ganz ohne die Stände konnten sie nicht regieren. Stattdessen sollten die Protestanten in den Ständeversammlungen isoliert werden, indem man ihnen weitere Zugeständnisse verwehrte, während loyale Katholiken belohnt und gefördert werden sollten. Hierbei konnten sich die Habsburger auf ihre (im Übrigen unbestrittenen) Prärogativen als Erzherzöge, Könige und Kaiser stützen, kraft deren sie befähigt waren, Erhebungen in den Adelsstand vorzunehmen, uneheliche Kinder zu legitimieren sowie Ämter, Titel und andere Ehren zu verleihen. Durch diese herrschaftlichen Kompetenzen konnten sie ihren Einfluss bis in den letzten Winkel des Heiligen Römischen Reiches hinein geltend machen, da selbst die meisten Reichsfürsten nicht befugt waren, Nobilitierungen vorzunehmen, sondern dem Kaiser lediglich Vorschläge unterbreiten konnten, wer nach ihrem Dafürhalten geadelt werden sollte. Als selbstbestimmte und selbstregulierende Körperschaften konnten die Stände zwar entscheiden, wen sie in ihre Reihen aufnehmen wollten, aber sie waren doch von den Habsburgern abhängig, wenn es darum ging, jemanden überhaupt erst in den Adelsstand zu erheben. Auch kam es allein dem Erzhaus zu, bestehenden Rittern zu höheren Ehren zu verhelfen und verschiedene Einflussrechte über die Kirche und die Kronstädte auszuüben. Im Verlauf des 16. Jahrhunderts starb eine ganze Reihe von österreichischen Adelsfamilien aus, was weitere Möglichkeiten eröffnete, den Anteil loyaler Katholiken unter den Adligen zu erhöhen. So wurden zum Beispiel zwischen 1560 und 1620 insgesamt 40 neue, überwiegend aus Italien stammende Familien in den innerösterreichischen Adelsstand erhoben; immerhin 16 von ihnen gelang auch die Aufnahme unter die Landstände.
Weiterhin versuchte man, den Katholizismus wieder attraktiver zu machen, indem zum Beispiel ein besser ausgebildeter, disziplinierterer und zahlreicherer Klerus angestrebt wurde – tatsächliche Seelsorger, die größere Aufmerksamkeit auf die spirituellen Bedürfnisse der einfachen Gläubigen richten sollten. Papst Gregor ließ sich zur Unterstützung des Vorhabens überreden und begann, auch andere Herrscher zur Teilnahme zu ermuntern. Der Bischof Germanico Malaspina, ein langjähriger Verfechter der tridentinischen Reformbemühungen, wurde zum neuen Nuntius für Innerösterreich ernannt und sollte die dortigen weltlichen wie geistlichen Herren dazu bringen, ihre Zankereien über Zuständigkeiten einzustellen. Malaspina war zwar ein fähiger Diplomat, aber alle Streitigkeiten konnte auch er nicht schlichten – nicht zuletzt deshalb, weil die meisten Bischöfe sich obendrein noch mit ihren Domkapiteln zerstritten hatten. Immerhin schloss 1583 der Fürsterzbischof von Salzburg ein Konkordat mit dem bayerischen Herzog, dem neun Jahre darauf ein österreichisches Abkommen mit dem Fürstbischof von Passau folgte, das eine ganz neue Ära verbesserter Beziehungen zwischen den Landesfürsten in der Region einläutete. Der neue Salzburger Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau kehrte von einer Romreise 1588 völlig begeistert zurück: Er hatte sich vom Feuer der Gegenreformation inspirieren lassen. Auch die vier von Salzburg abhängigen Eigenbistümer bekamen nun stärker reformorientierte Bischöfe, unter denen vor allem Martin Brenner zu nennen ist, der 1585 Bischof von Seckau wurde.
Es dauerte jedoch eine Weile, bis das „Münchner Programm“ Wirkung zeigte, und die neu gefundene Einigkeit unter den Landesherren währte nur kurz. Sie zerbrach, als ein voreiliger Versuch Karls von Habsburg, die protestantische Religionsausübung in seinen Kronstädten zu untersagen, im Dezember 1580 Widerstand provozierte. Karls Verbündete befürchteten, nun werde ein großer Aufstand losbrechen, bekamen kalte Füße und verweigerten ihm ihre militärische Unterstützung. Der Mangel an Truppen und Führungspersonal verhinderte jegliche Umsetzung von Karls Absichten vor Ort. So war der Erzherzog gezwungen, seine restriktive Religionspolitik auf die Stadt Graz zu beschränken, seine Residenz, wo er einen Kreis loyaler Berater um sich scharte und das dortige Jesuitenkolleg zur Universität erhob, um mehr Priester und Verwaltungsbeamte ausbilden zu können. Schon 1587 fühlte er sich stark genug, die kleineren Provinzstädte zum Ziel seiner Reformvorhaben zu machen; dort erwartete man geringeren Widerstand. Karl berief sich auf das ius reformandi, das ihm als Reichsfürsten nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 zustehe, und richtete eine Reformkommission unter der Leitung des Bischofs Brenner ein, die, beschützt von einer Militäreskorte, durchs Land ziehen sollte, um neue Gemeindepriester einzusetzen, protestantische Schulen zu schließen und sämtliche Magistrate unter katholische Kontrolle zu bringen. Nach außen wurden diese Maßnahmen als moderat und vernünftig dargestellt: Der Erzherzog wolle doch lediglich Frieden und Versöhnung unter seinen Untertanen stiften – er greife zu diesen Mitteln allein, um den katholischen Glauben zu verteidigen und katholischen Kirchenbesitz vor protestantischem Vandalismus zu beschützen! Der Adel befürchtete, man werde ihm die Kommission als Nächstes auf seine Landgüter schicken, und schritt deshalb kaum ein, als seine stadtbürgerlichen Verbündeten nach und nach ihrer Ämter enthoben wurden. Als Erzherzog Karl im Mai 1590 schwer erkrankte, war Brenners Kommission so weit nur auf passiven Widerstand gestoßen. Dann zwangen heftige Ausschreitungen in Graz die dortige Obrigkeit, einen inhaftierten protestantischen Studenten freizugeben. Die Unzufriedenen spürten eine obrigkeitliche Schwäche, und der Aufruhr griff bald auch auf andere Städte über – vor allem nachdem Karl im Juli gestorben und ihm sein zwölfjähriger Sohn Ferdinand als neuer Erzherzog von Innerösterreich nachgefolgt war. Die innerösterreichischen Stände pochten auf ihr traditionelles Recht, für die Zeit der Unmündigkeit des Prinzen einen Regenten zu bestimmen, lehnten jedoch die bayerische Verwandtschaft des Knaben als ungeeignet ab und legten die Regierungsverantwortung stattdessen in die Hände des Erzherzogs Ernst, dem nicht nach einer weiteren Konfrontation zumute war.
Erzherzog Ferdinand Als Ferdinand 1595 für volljährig erklärt wurde, schien es alles andere als wahrscheinlich, dass er den an die Stände verlorenen Boden würde gutmachen können – geschweige denn, dass er einer der mächtigsten Männer seiner Zeit werden sollte. Der spätere Kaiser hat in der Forschung ein gemischtes Echo gefunden, besonders unter englischsprachigen Historikern, deren Darstellungen von der zeitgenössischen protestantischen Einschätzung geprägt scheinen, Ferdinand sei „nichts als ein törichter Jesuitenzögling“ – „but a silly Jesuited soule“ – gewesen. Seine Mutter, Maria von Bayern, hatte ihn in der Tat schon im März 1590 an das Jesuitenkolleg von Ingolstadt geschickt, um ihn protestantischen Einflüssen zu entziehen; der Tod seines Vaters Karl zwang dessen jungen Nachfolger dann, seine Studien vor der Zeit abzubrechen und nach Graz zurückzukehren. Ferdinand war klein für sein Alter (was seine Schüchternheit erklären mag), und seine Familie machte sich schon bald Sorgen um seine Gesundheit, zumal bereits zwei seiner Brüder jung gestorben waren. Solche Befürchtungen sollten sich als unbegründet erweisen: Ferdinand wuchs zu einem körperlich gesunden Jungen heran, wurde ein vorzüglicher Reiter und begeisterter Jäger. Anders als sein Vetter Rudolf begegnete Ferdinand seinen Mitmenschen stets freundlich und mit Wohlwollen, ein Eindruck, den wohl seine gesunde Gesichtsfarbe sowie – in späteren Jahren – zunehmende Leibesfülle noch verstärkten. Tatsächlich wurde Ferdinand alles andere als ein Kostverächter, er liebte vor allem Wildbret und üppige Fleischgerichte, die ihm neben seinem Übergewicht wohl auch eine Asthmaerkrankung bescherten. Anders als viele seiner Standesgenossen trank er Alkohol jedoch nur in Maßen, und sein Beichtvater verkündete stolz, der Erzherzog empfange Damenbesuch niemals allein. Angeblich trug Ferdinand vor seiner Hochzeit sogar ein härenes Büßerhemd, um alle sinnlichen Begierden gleich im Keim zu ersticken, und hielt es als Witwer genauso. Der päpstliche Nuntius in Wien, Carlo Carafa, berichtete später:
„Abends zehn Uhr legt er [Ferdinand], nach deutscher Gewohnheit, sich nieder; früh um vier Uhr, oft noch früher, ist er schon wieder auf den Beinen. … Jeden Tag pflegen Seine Majestät zwei Messen zu hören, eine für die Seele Ihrer ersten Gemahlin, Schwester des Herzogs von Bayern, die, obwohl wankender Gesundheit, von dem Kaiser zärtlich geliebt wurde. Ist’s ein Festtag, so empfängt er nach diesen Messen die heilige Kommunion, zu welchem Zwecke er sich in die Kirche begibt und dort eine deutsche Predigt anhört. Gewöhnlich wird sie von einem Jesuiten gehalten und dauert eine Stunde. Nach der Predigt wohnt er dem Hochamte bei, was bei ausgesuchter Musik gewöhnlich anderthalb Stunden erfordert. … An solchen Tagen, die nicht Festtage sind, bringt der Kaiser, nachdem er zwei Messen gehört (wovon er niemals abgeht), den Rest des Vormittags, häufig auch einen Teil des Nachmittags in der Ratssitzung zu.“49
Von den üppigen Mahlzeiten, der Regierungsarbeit, der Jagd und stundenlangen Gebetssitzungen in zugigen Kirchen sollte Ferdinand nicht mehr ablassen, solange er lebte. Bei seiner Autopsie wunderten sich die Ärzte, dass der Kaiser überhaupt so lange gelebt hatte.
Ferdinand nahm sich ab 1595 zwar nacheinander drei Jesuiten zum Beichtvater, war selbst jedoch eher fromm als ein Fanatiker. Sein tiefes Verlangen, dem Katholizismus zum Sieg zu verhelfen, wurde durch einen ebenso tiefen Respekt vor Gesetz und Herkommen abgemildert; gegen diese „Verfassung“, wie er sie verstand, wollte er nicht verstoßen. Während er den Ständen von Innerösterreich gegenüber erklärte, er sei ein „absoluter Fürst“, lehnte er die Vorstellung einer Staatsräson à la Machiavelli strikt ab – glaubte er doch fest daran, dass politischer Erfolg auf christlichen Prinzipien beruhen müsse. Sein Glaube an die göttliche Vorsehung wurde durch eigene Erfahrungen anlässlich der Grazer Ausschreitungen im Sommer 1590 gestärkt, als ein heftiges Gewitter die Protestanten auseinandergetrieben und so – dessen waren die Katholiken sich sicher – ein unmittelbar bevorstehendes Blutbad verhindert hatte.50 Der Erfolg seiner späteren Reformbemühungen festigte Ferdinands Überzeugungen, gerade weil die meisten seiner Berater ihm prophezeit hatten, dass sie in einem allgemeinen Aufstand enden würden. Und doch blieb dem Erzherzog die Befürchtung, Gott werde ihn im Stich lassen, sobald er einen Fehler mache; sie war der Grund für seine Vorsicht und sein stetes Bemühen, umfassenden Rat einzuholen, bevor er zur Tat schritt.
Seine Absichten machte Ferdinand bereits deutlich, als er bei seinem Antritt als Erzherzog zu dem alten Antrittseid zurückkehrte, der 1564 abgeändert worden war, um die Protestanten nicht unnötig zu reizen. Auch lehnte er es ab, das Brucker Libell als Teil der innerösterreichischen Grundgesetze anzuerkennen. Vonseiten der Stände suchte jedoch niemand die Konfrontation, und so nahm man Ferdinands Schweigen als Zustimmung; 1597 wurde er vom innerösterreichischen Landtag als Erzherzog anerkannt. Nach Ferdinands Verständnis bedeutete die Unterwerfung der Landstände unter seine Autorität, dass er die 1578 gewährten Privilegien ungeniert würde abschaffen können, sobald er stark genug dazu war. Seine politischen Berater drängten zur Vorsicht – sie jedenfalls hatten das Scheitern des Erzherzogs Karl noch nicht vergessen –, aber der Fürstbischof von Seckau, Martin Brenner, und sein Amtskollege aus Lavant, Georg Stobäus von Palmburg, hielten dagegen und ermunterten Ferdinand, allein seinem Gewissen zu folgen. Nachdem er eigens nach Rom gereist war, um den Papst um Rat zu bitten, und nach langen Diskussionen, die das gesamte erzherzogliche Beraterteam „ins Boot holen“ sollten, rief Ferdinand schließlich im April 1598 die Reformkommission seines Vaters ins Leben zurück. Sorgfältige Vorbereitungen sollten eine Wiederholung der Proteste von 1580 und 1590 verhindern. Alle drei innerösterreichischen Ständekurien wurden zeitgleich, aber getrennt voneinander einberufen – so waren sie beschäftigt, konnten aber keine vereinte Opposition bilden. Die Kurien wurden gezwungen, jeweils einen katholischen Geistlichen in ihr Leitungsgremium aufzunehmen, der umgehend jegliches gegen die erzherzogliche Obrigkeit gerichtete Vorgehen unterband. Ferdinand schreckte auch vor Gewalt nicht zurück: Zwei Ständevertreter wurden festgenommen und so lange gefoltert, bis sie einwilligten, die wichtigste Schule von Graz in katholische Hand zu geben. Die Grazer Garnison kam in ihrer gesamten regulären Stärke von 800 Mann zum Einsatz, um die Reformkommission zu schützen; wenn ein Bürger protestierte, quartierte man Soldaten bei ihm ein. 1599 dann kam die Operation voll in Schwung, als Fürstbischof Brenner nacheinander sämtliche steirischen Städte besuchte, protestantische Lehrer und Pastoren ihrer Ämter enthob und katholische Priester an ihre Stelle setzte. Wenn die Gemüter sich beruhigt hatten, kehrte die Reformkommission zurück und ordnete weitere provokante Maßnahmen an: schloss die protestantische Schule, ließ den protestantischen Friedhof einebnen und die protestantische Kirche abreißen. Letzteres geschah bisweilen als spektakuläres Exempel: In dem Ort Eisenerz bei Leoben etwa wurde sie gesprengt. Brenner hatte sich auf diese Weise bald den Beinamen „der Ketzerhammer“ verdient – und er ließ wirklich keine Gelegenheit aus, seine Widersacher zu erniedrigen, zu demütigen und alles, was ihnen heilig war, in den Dreck zu treten:
„Die Leiber der [protestantischen] Gläubigen hat man ausgegraben, hat sie den Hunden gegeben und vor die Säue geworfen, hat deren Särge auch genommen und sie am Wege hingestellt und etwelche angebrannt, dass es ein barbarisches und unmenschliches Werk war. Auch hat man auf den Grabstätten der Gläubigen Galgen und Richtplätze errichtet, dass man die Frevler dort richte. Und wo vorher die protestantischen Kirchen gestanden, wo die Kanzel gewesen oder der Taufstein, da hielt man stets die unflätigsten und die abscheulichsten Spektakula.“51
Als Brenner 1600 im Triumph nach Graz zurückkehrte, um dort der „feierlichen“ Verbrennung von 10 000 protestantischen Büchern beizuwohnen, gingen die Ereignisse ihrem Höhepunkt entgegen. Ferdinand feierte, indem er Maria Anna von Bayern zur Frau nahm, die fromme und pflichtbewusste älteste Tochter Herzog Wilhelms V. von Bayern. Die Hochzeitsfeierlichkeiten im April zogen sich über acht Tage hin. Anschließend wurden alle verbliebenen protestantischen Pastoren und Lehrer der Stadt verwiesen, ebenso alle Grazer Bürger, die sich weigerten, zum katholischen Glauben zu konvertieren. Insgesamt verließen zwischen 1598 und 1605 rund 11 000 Glaubensflüchtlinge die innerösterreichischen Länder, entweder weil sie vertrieben wurden oder weil sie sich mehr oder minder freiwillig ins Exil begaben. Viele siedelten in protestantische Territorien des Reiches über, etwa nach Württemberg, dessen Herzog sogar das programmatisch benannte Freudenstadt gründete, um die Vertriebenen willkommen zu heißen.
Die ganze Zeit über hatte Ferdinand sich im Rahmen seiner eigenen – zugegebenermaßen recht engen – Rechtsauffassung bewegt. Zumindest offiziell sollte die Reformkommission nicht das Luthertum bekämpfen, sondern die „Ketzerei“, und erst 1609 wurde ein katholisches Bekenntnis auch formal zur Voraussetzung bei der Ämtervergabe. Auch hatte Brenner nur solche lutherischen Einrichtungen und Strukturen angegriffen, die nicht ausdrücklich privilegiert worden waren, wodurch der private Glaube unangetastet blieb. Besondere Zugeständnisse wurden gegenüber den innerösterreichischen Bergleuten gemacht, weil man ansonsten wirtschaftliche Beeinträchtigungen und Steuerausfälle befürchtete. Bereits 1599 hatten die Landstände die gegenreformatorische Kampagne ihres Erzherzogs dadurch gekontert, dass sie ihm Steuern vorenthielten und überdies beim Kaiser Beschwerde einlegten. Als Ferdinand weitere derartige Beschwerden untersagte, unterzeichneten 238 Adlige eine Petition, in der sie ihm mit ihrer Emigration drohten, falls er nicht augenblicklich die freie Religionsausübung wiederherstelle. Ferdinand setzte darauf, dass sie nur pokerten – und gewann: Die meisten blieben, wo sie waren; ein zweiter Steuerstreik brach 1604 in sich zusammen.
Böhmen Die Auswirkungen des innenpolitischen Bebens in den Jahren um 1600 waren sogar in Böhmen zu spüren, wo Kaiser Rudolf sich weiterhin in seiner Burg abschottete. Wie in Österreich auf die Kronstädte, so zielte die Gegenreformation auch in Böhmen auf die Königsstädte als die schwächsten Glieder des ständisch-protestantischen Netzwerks. Im utraquistischen Konsistorium erlangten katholische Sympathisanten eine Mehrheit, indem sie die radikaleren Anhänger der Brüderunität als „fünfte Kolonne“ der Calvinisten darstellten. Mit der Unterstützung der offiziellen und etablierten Kirchenhierarchien, der katholischen wie der utraquistischen, begann die habsburgische Regierung, in den Königsstädten linientreue Vögte einzusetzen. Dadurch gelang es, überall prohabsburgische Magistrate zu erhalten – und das, obwohl von all diesen Städten allein Pilsen (Plzeň) und Budweis (České Budĕjovice) eine mehrheitlich katholische Bevölkerung hatten. 1592 wurde in Prag der Fronleichnamsumzug wieder eingeführt; andere Städte folgten und verpflichteten ihre Würdenträger zur Teilnahme an der Prozession. Die Krone profitierte auch von dem Aussterben zahlreicher böhmischer Adelsfamilien, deren Besitz sie entweder einzog oder erwarb; auf diese Weise vergrößerte sich bis 1603 der Anteil von unmittelbarem Kronbesitz an der Gesamtfläche Böhmens von zuvor rund einem Prozent auf über zehn Prozent. Der Anteil des von der Kirche und den Königsstädten – mittelbar also ebenfalls von der Krone – besessenen Landes stieg auf neun Prozent, wodurch die böhmische Krone insgesamt rund ein Fünftel des Königreiches unter ihre Kontrolle bringen konnte. In Mähren, wo die Kirche größere Besitzungen hatte bewahren können, war der entsprechende Anteil sogar noch höher. Das große Gewicht dieser katholischen Vermögenswerte und der Einfluss, den ihre Besitzer ausüben konnten, wurden durch die Schwäche der böhmischen Wirtschaft – die deutlich unterkapitalisiert war – eher noch verstärkt.
Auch der Charakter des böhmischen Katholizismus veränderte sich. Zwischen 1597 und 1611 starben sieben der großen böhmischen Grundbesitzerfamilien aus, und ihr Reichtum fiel überwiegend in die Hände verdienter Militärs – oder solcher, die es werden wollten. Wilhelm Slavata, der, als wir ihm zuletzt begegneten, gerade Hals über Kopf aus einem Fenster des Hradschin geflogen war, hatte 1604 den Besitz der Herren von Neuhaus (Jindřichův Hradec) geerbt, deren Geschlecht seine Frau Lucie Ottilie entstammte. In den 1590er-Jahren erwarb Karl von Liechtenstein den umfangreichen Besitz der mährischen Herren von Boskowitz. Viele Angehörige dieser neuen Generation von „Glücksrittern“ waren Konvertiten; zu ihnen zählten auch die Männer, die bei Ausbruch des Böhmischen Aufstandes die Machtpositionen im Land innehatten. Liechtenstein, der später Statthalter von Böhmen werden sollte, war im Glauben der Böhmischen Brüder erzogen worden, genau wie sein jüngerer Bruder Gundaker, der 1602 zum Katholizismus konvertierte und 1620 Hofkammerpräsident und 1624 kaiserlicher Obersthofmeister wurde. Der Niederösterreicher Michael Adolf von Althan ließ sich 1598 von dem frischgebackenen Wiener Bischof Khlesl zum Katholizismus bekehren, bevor er 1606 zum Gouverneur im ungarischen Gran ernannt und 1610 in den Reichsgrafenstand erhoben wurde. Ein niederösterreichischer Landsmann Althans, Franz Christoph von Khevenhüller, war nach seiner Konversion kaiserlich-habsburgischer Gesandter am spanischen Hof. Nach seiner Rückkehr schrieb er die Annales Ferdinandei, vordergründig eine Biografie Ferdinands II., in Wahrheit jedoch eine materialreiche Abhandlung zur gesamten Zeitgeschichte. Der steirische Lutheraner Johann (Hans) Ulrich von Eggenberg wurde in den 1590er-Jahren ebenfalls katholisch und war bis 1597 zu einem der engsten Berater Ferdinands geworden. Ein anderer Steirer, Maximilian von Trauttmansdorff, der zum führenden Staatsmann der Habsburgermonarchie aufsteigen sollte, war gleichfalls im lutherischen Glauben erzogen worden, schloss sich aber seinen Eltern an, die während der Tätigkeit von Brenners Reformkommission zum Katholizismus konvertierten. Slavata war aus persönlicher Überzeugung konvertiert, während er sich als junger Mann zum Studium in Siena aufhielt; andere waren noch jünger gewesen, als man sie zum Übertritt bewegte. Peter Pázmány zum Beispiel, der spätere Primas von Ungarn, fand im Alter von zwölf Jahren in die Arme Roms – unter jesuitischem Einfluss. Pázmány wurde 1616 Nachfolger des Grafen Franz (Ferenc) Forgách (auch er ein Konvertit!) als Kardinalerzbischof von Gran; er sollte die katholische Reform in Ungarn vorantreiben. Unter anderem durch Konversionen stieg bis 1610 der Anteil der Katholiken am oberösterreichischen Adel auf rund zehn Prozent an; in Böhmen waren 20 Prozent der Adligen katholisch, in Niederösterreich rund 25 Prozent.
Die Anhäufung von Reichtum und Ämtern verlieh den militanten Katholiken das nötige Selbstbewusstsein, Protestanten von der Regierung auszuschließen. Der päpstliche Nuntius in Prag überzeugte den labilen Kaiser Rudolf, ausgerechnet am 24. August 1599 – dem 27. Jahrestag der blutigen Bartholomäusnacht – den Katholiken Zdenko von Lobkowitz zum Oberstkanzler von Böhmen zu ernennen. Der wiederum drängte, inspiriert von seiner Lektüre spanisch-katholischer Staatsdenker der Spätscholastik, den Kaiser dazu, seine protestantischen Berater zu entlassen, was Rudolf dann 1600 auch tat, und das kaiserliche Verbot der Böhmischen Brüder zu erneuern. Freie Kirchenämter besetzte man mit neuen Männern voller Elan und Tatendrang. Das Amt des Fürstbischofs von Olmütz (Olomouc) und Metropoliten von Mähren ging 1598 an Franz Seraph von Dietrichstein, einen Absolventen des jesuitischen Collegium Germanicum in Rom, dem schon als junger Mann ein Dreizehntel der Gesamtfläche Mährens gehörte. Der streitbare Wolfgang Selender von Prossowitz wurde zum Abt des Benediktinerklosters Braunau (Broumov) in Böhmen ernannt, während Klostergrab (Hrob) mit den dazugehörigen Prämonstratenserstiften Tepl und Strahov dem Erzbischof Jan Lohelius anvertraut wurde, der in Prag eine Synode zur Förderung der tridentinischen Reformen einberief. Hatten sich noch 1594 sämtliche wichtigen Regierungsämter Mährens in den Händen von Protestanten befunden, war die Verwaltung des Landes nun – kaum zehn Jahre später – durch und durch katholisch.
Auf den ersten Blick schien die Lage für den militanten Katholizismus zu Beginn des neuen Jahrhunderts vielversprechend. Das „Münchner Programm“ war in Innerösterreich durchaus mit Erfolg umgesetzt worden, in Ober- und Niederösterreich mit etwas geringerem Erfolg, in Böhmen und Mähren begann es gerade erst, Frucht zu tragen. Jedoch stießen seine Richtlinien zahlreiche Protestanten vor den Kopf, die zuvor dem habsburgischen Herrscherhaus gegenüber noch loyal gewesen waren – und das zu einer Zeit, in der die Katholiken noch mit mindestens drei zu eins in der Unterzahl waren (zumindest außerhalb von Kroatien und Tirol). Ob sich der gegenreformatorische Vorstoß auch weiterhin würde aufrechterhalten lassen, hing vor allem von der inneren Einigkeit des Hauses Habsburg ab, dessen baldiges Auseinanderbrechen sich allerdings schon deutlich abzeichnete. Rudolf II. jedenfalls war vollkommen unfähig, seine Führungsrolle als Familienoberhaupt angemessen auszufüllen. Grundsätzlich befürwortete er zwar eine Stärkung des Katholizismus, gehörte seiner ganzen Vorstellungswelt nach jedoch eher dem moderaten Milieu der 1570er-Jahre an als der polarisierten, von konfessionellen Gegensätzen geprägten Gegenwart um 1600. Kaum hatte man den Kaiser mit Schmeicheleien dazu gebracht, radikale Maßnahmen zu autorisieren, da hieß er an seinem Hof auch schon den Astronomen Johannes Kepler willkommen, einen Lutheraner, den Erzherzog Ferdinand gerade erst aus dem steirischen Graz hatte ausweisen lassen. Während der politische Druck von allen Seiten zunahm, verzettelte Rudolf sich in Nichtigkeiten, brachte etwa Monate damit zu, eine neue Kaiserkrone zu entwerfen, obwohl die bestehende Krone, die in Nürnberg sicher verwahrt wurde, eigentlich keine Wünsche offenließ.52 Inzwischen kühlten die Beziehungen unter Rudolfs jüngeren Brüdern und sonstigen Verwandten rapide ab, während das Habsburgerreich in einen langen Krieg gegen die Türken hineingezogen wurde, der nach 1606 schließlich eine tiefe Staatskrise auslöste.