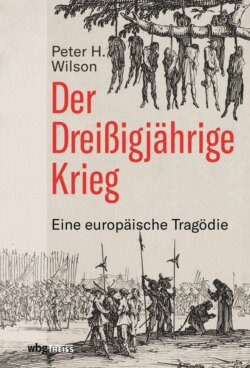Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Peter H. Wilson - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Stände und Konfession
ОглавлениеDie Stände der Frühen Neuzeit waren aus dem Mittelalter überkommene, repräsentative Körperschaften, die sich in allen habsburgischen Ländern und vielen deutschen Territorien des Heiligen Römischen Reiches fanden. Und ganz so, wie die weltlichen und geistlichen Fürsten, die Herren und die Freien Städte des Reiches sich als Reichsstände und damit als Teilhaber der kaiserlichen Macht verstanden, so setzten sich aus den bedeutendsten Adligen, Kirchenfürsten und Bürgern der Territorien deren jeweilige Landstände zusammen. Die Sozialstruktur und politische Rolle der Stände ist in der Vergangenheit sehr unterschiedlich gesehen worden. In Texten des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts erscheinen sie nicht selten als Hindernisse guter Regierung und Bollwerke biederer Partikularinteressen – ein spätes Echo auf die Klagen der Landesherren im 17. Jahrhundert.
Von liberaler Seite hingegen stellte man die Stände als Vorläufer des modernen Parlamentarismus dar. Demnach hätten sie es tapfer mit selbstsüchtigen, rücksichtslosen Herrschern aufgenommen, denen Leben und Besitz ihrer Untertanen einerlei gewesen seien auf ihrer Jagd nach persönlichem Ruhm. Tschechische und ungarische Historiker gaben dieser Perspektive eine besondere Qualität, indem sie die Stände ihrer Länder zu Hütern der nationalen Traditionen erklärten, die ansonsten der deutsch-habsburgischen Aggression anheimgefallen wären. Von marxistischer Seite wurden jegliche Interessenkonflikte zwischen Landesherren und Ständen heruntergespielt; schließlich hätten sowohl die Monarchen als auch die größtenteils adligen Stände derselben feudalen Klasse angehört, die gemeinsam das bäuerliche „Landproletariat“ ausgebeutet habe.39
Hinter all diesen Interpretationen steht die Frage, auf welche Weise sich die verschiedenen habsburgischen Länder am besten zu einem modernen Staat hätten integrieren lassen: als zentral geführte Monarchie – oder doch mithilfe des Ständesystems? Eine solch übertriebene Konzentration auf das Problem der „Modernisierung“ ist jedoch wenig hilfreich, denn die europäischen Zeitgenossen des 17. Jahrhunderts kümmerte es herzlich wenig. Fraglos leisteten die Stände einen positiven Beitrag zur Entwicklung der Habsburgermonarchie, boten sie der Dynastie doch ein Forum, um sich mit ihren einflussreichsten Untertanen zu treffen und auszutauschen. Die Fortentwicklung der habsburgischen Ständeordnung trug auch zur Abschwächung jener Gewalt bei, die das späte 15. Jahrhundert geprägt hatte – vor allem in Österreich, wo der ansässige Adel seinen Landesherrn 1461 sogar in dessen Familienresidenz, der Wiener Hofburg, belagerte. Wie schon bei der „Verrechtlichung“ der Reichspolitik durch eine Weiterentwicklung des Reichstages, so verlagerte sich nun das Gewicht in der inneren Politik der habsburgischen Länder weg von der bewaffneten Konfrontation und hin zu einer Diskussion der juristischen Details und genauen Bedeutung eines wachsenden Korpus von Privilegien, Stiftungsbriefen und anderen Verfassungsurkunden.
Reichs- wie Landstände vertraten gesellschaftliche Gruppierungen, nicht Individuen, und spiegelten die hierarchische Gliederung der frühneuzeitlichen Gesellschaft wider, die sich entlang funktionaler Grenzen in drei große Geburtsstände aufteilte. Der Klerus, dessen Aufgabe darin bestand, für die Seelen aller Gläubigen zu beten, stand an erster Stelle, denn er war Gott am nächsten. Dann kamen der (kriegerische) Adel als zweiter sowie Bürger und Handwerker als dritter Stand; sie sorgten für den Schutz beziehungsweise den materiellen Wohlstand der Gesellschaft. Repräsentation erfolgte in der Regel indirekt: Bischöfe, Äbte und andere Vorsteher religiöser Einrichtungen vertraten die Masse des Klerus, der insgesamt kaum mehr als zwei Prozent der Bevölkerung ausmachte. Beim Adel bedurfte es eines bestimmten Herrschaftsbesitzes, der mit Sitz und Stimme in der Ständeversammlung, dem Landtag, verbunden war. Adlig war rund ein Prozent aller Österreicher, während der Anteil in Böhmen etwas höher lag und in Ungarn immerhin fünf Prozent erreichte. Dennoch sprachen und handelten diese Minderheiten kollektiv für „das Land“ und vertraten dabei auch ihre abhängigen Pachtbauern und Leibeigenen, denen jede direkte Partizipation verwehrt blieb. Zugang zum dritten Stand hatten nur die Einwohner der Kronstädte, die unmittelbar der habsburgischen Herrschaft unterstanden; die Bewohner all jener Städte und Dörfer hingegen, die sich im Hoheitsgebiet einer weltlichen oder geistlichen Zwischeninstanz befanden, waren davon ausgeschlossen. Nur in Tirol gab es ein etwas höheres Maß an politischer Repräsentation der breiten Bevölkerung, denn dort besaßen zahlreiche Dörfer das Recht, einen gewählten Vertreter zu den Tiroler Landständen zu entsenden (wahlberechtigt waren männliche Haushaltsvorstände, die einen bestimmten Besitz vorweisen konnten).
Von allen habsburgischen Ständeversammlungen entsprach allein jene der Grafschaft Görz dem klassischen Dreikammermodell von Klerus, Adel und drittem Stand. Anderswo unterteilte sich der Adel in „Herren“ und „Ritter“. Diese saßen in den innerösterreichischen Ländern in einer gemeinsamen Kammer zu Rate, während sie in Ober- und Niederösterreich getrennt tagten, genauso in Ungarn und den Ländern der böhmischen Krone. Im Jahr 1618 hatten rund 200 Herren und 1000 Ritter Anrecht auf einen Platz im böhmischen Landtag – gegenüber 90 beziehungsweise 189 Anwärtern in Mähren. In Niederösterreich waren 87 standesherrliche und 128 ritterschaftliche Familien im Landtag vertreten, aber daneben gab es stets auch Adlige, denen es an dem erforderlichen Grundbesitz mangelte und die deshalb auch keinen Sitz im Landtag erhielten. In Oberösterreich standen 300 adligen Familien, die nicht im Landtag vertreten waren, gerade einmal 43 Standesherren und 114 Ritter gegenüber, die dort Sitz und Stimme hatten. In Schlesien wurde die Situation dadurch verkompliziert, dass die Fürsten und Herzöge von Jägerndorf, Troppau, Liegnitz und anderen Territorien zusammen über rund ein Drittel des Gesamtherzogtums herrschten. Sie beanspruchten den Vorrang vor allen Fürsten Böhmens und spekulierten darauf, dank einiger dynastischer Heiraten bald in den Rang von Reichsfürsten aufzurücken und somit auch in den Reichstag einzuziehen. Das Fortbestehen ihrer Herrschaften hielt den Niederadel und die Städte Schlesiens größtenteils aus der Politik fern; die schlesische Ständeversammlung zählte deshalb nur 40 Delegierte, darunter den Fürstbischof von Breslau.
In Tirol existierte neben den Städten der bereits erwähnte vierte Stand von Bauerngemeinden; Klerus und Adel waren hier vergleichsweise schwach. In Vorarlberg fehlten die letztgenannten beiden völlig, die kleinen Vorarlberger Landstände setzten sich allein aus Bürgern und Bauern zusammen. In den anderen Ländern der Tiroler Habsburger besaß der dritte Stand großen Einfluss, was den in sich gekehrten Charakter der dortigen Ständeversammlungen, die sich für die „große Politik“ jenseits ihrer beschaulichen Täler kaum interessierten, noch verstärkte. Überall sonst waren Klerus und Städte mit eigenen Ständen vertreten, außer in Böhmen, wo der Klerus sein Mitspracherecht im Hussitenaufstand verwirkt hatte. Allerdings mangelte es den geistlichen Ständen an Zusammenhalt, was auch am Fehlen starker Bischöfe jenseits von Wien, Prag, Breslau, Olmütz und Gran lag. Durch ein päpstliches Konkordat sicherten sich die Habsburger im 15. Jahrhundert weitreichende Macht über den österreichischen Klerus; 1568 richtete Maximilian II. ein Aufsichtsgremium für die Klöster in den habsburgischen Territorien ein, den fünfköpfigen Klosterrat. Der Klerus in den betroffenen Gebieten saß also gewissermaßen in der Klemme – zwischen der politischen Aufsicht der Habsburger auf der einen Seite und der geistlichen Jurisdiktion von Bischöfen, die in der Regel zur Reichskirche gehörten und jenseits der österreichischen Grenze in Passau, Freising, Bamberg, Regensburg oder Salzburg residierten, auf der anderen. Die Position der Städte in den Ständeversammlungen war sogar noch schwächer, da allein die Städte im unmittelbaren Besitz der Habsburger (Kammergut) dort vertreten waren. Patrimonialstädten, die sich auf dem Territorium weltlicher oder geistlicher Herren befanden, blieb die Standschaft verwehrt. In Mähren etwa waren 100 Städte von der Ständeversammlung ausgeschlossen; ganze sechs „königliche Städte“ waren darin vertreten. In Böhmen spielten die Städte noch eine größere Rolle, und 32 von ihnen waren im böhmischen Landtag vertreten (darunter die vier selbstständigen Städte, die zusammen die Stadt Prag bildeten). Nur in Ungarn tagten die Vertreter der königlichen Freistädte und der freien Bergstädte zusammen mit den Vertretern des niederen Adels. Ihnen stand ein Oberhaus aus Angehörigen des höheren Adels und hohen Klerus gegenüber, sodass die Ständeversammlung des Königreichs Ungarn eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Zweikammersystem des britischen Parlaments aufwies. Überall im habsburgischen Herrschaftsbereich jedoch blickte der Adel auf die Stadtbewohner hinab – nicht nur aufgrund des gesellschaftlichen Rangunterschieds, sondern auch, weil die adligen Standesherren den Städtern mit ihrem engen Verhältnis zum Haus Habsburg misstrauten.
Die habsburgische Verwaltung Wie in den deutschen Ländern bildeten sich auch die Landstände der habsburgischen Territorien im 15. Jahrhundert heraus, um ihren Herrschern beratend zur Seite zu stehen. Als Vertreter begüterter und körperschaftlich organisierter Gruppen sprachen sie in Fragen von allgemeinem Interesse für das ganze Land und nahmen dabei für sich in Anspruch, zugleich unvoreingenommener und besonnener zu urteilen als unterwürfige Höflinge oder auswärtige Berater. Jedoch waren es die Habsburger bald leid, sich von den Vertretern der Stände unbequeme Wahrheiten sagen zu lassen, und richteten eigene Beratergremien ein, mit deren Hilfe sie die Regierung ihrer zahlreichen Territorien besser koordinieren konnten. Den grundlegenden Verwaltungsrahmen hierfür schuf Ferdinand I., dem sein abwesender älterer Bruder Karl V. bereits 1522 die Regierung Österreichs übertragen hatte. Ferdinand richtete 1527 einen neuen „Geheimen Rat“ ein, dessen Mitglieder er nach Begabung und Abstammung berief, und gründete zudem eine böhmische und eine österreichische Hofkanzlei, die den Schriftverkehr und sonstige Verwaltungsangelegenheiten zwischen Wien und den diversen Provinzen bestreiten sollten. Daneben entstanden noch weitere Fachstellen, namentlich die Hofkammer – eine zentrale Finanzbehörde – und der Hofkriegsrat. Diese sollten in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen die Detailfragen behandeln und dem Geheimen Rat darüber hinaus mit fachkundigem Rat zur Seite stehen. Jedoch darf man sich nicht täuschen: Die habsburgische Verwaltung kennzeichnete auch weiterhin eine geradezu atemberaubende Lässigkeit. Im August 1620 ernannte Ferdinand II. den 40-jährigen Gundaker von Liechtenstein zum Hofkammerpräsidenten, der sich einige Tage darauf über Post wundern musste, die an den (vormaligen) „Hofkammerpräsidenten Seyfried Christoph von Breuner“ adressiert war, während seine Untergebenen allesamt glaubten, ihr neuer Vorgesetzter sei Gundaker von Polheim.40 Trotz ihrer kaiserlichen Stellung fiel es den Habsburgern offenkundig schwer, kompetente und erfahrene Kräfte an sich zu binden. Dies überrascht jedoch kaum, stellt man ihren fürchterlichen Ruf als Dienstherren in Rechnung: Als Kaiser Rudolf II. 1612 starb, schuldete er seinen Beamten und Bediensteten sage und schreibe 2,5 Millionen Gulden an ausstehenden Lohnzahlungen.
Auch blieben die Möglichkeiten der habsburgischen Zentralorgane, auf die Verhältnisse vor Ort einzuwirken, eng begrenzt. Zwar konnten die Habsburger für ihre Länder, sofern sie nicht von einem dort ansässigen Erzherzog regiert wurden, einen Statthalter ernennen, mussten jedoch die Landstände um ihre Zustimmung bitten, sobald es an die Berufung eines Landeshauptmanns (in Niederösterreich: Landmarschalls) nebst Stellvertreter ging, die gemeinsam das Landesaufgebot befehligten. Die habsburgischen Herren konnten in den Städten ihres Kronguts auch Vögte ernennen beziehungsweise auf ihrem ländlichen Besitz Verwalter zur Regelung ihrer wirtschaftlichen Angelegenheiten einsetzen – aber dieses Kammergut machte doch selten mehr als fünf Prozent der Landesfläche aus. Der weit überwiegende Anteil der örtlichen Verwaltung befand sich in der Hand des ansässigen Adels. In Böhmen zum Beispiel kontrollierte der Adel das Landgericht, das inneradlige Streitigkeiten schlichtete, Verordnungen erließ und die Gerichtsbarkeit über die gesamte Landbevölkerung ausübte. In Ungarn, wo gut die Hälfte aller Dörfer sich im Besitz von gerade einmal 50 Adelshäusern befand (während der Rest meist einer der 5000 niederadligen Familien gehörte), war die Situation noch extremer: Allein die königlichen Freistädte fielen unter habsburgische Jurisdiktion, aber selbst deren größte, Debrezin, hatte weniger als 20 000 Einwohner. Der König konnte nicht einmal einen Statthalter ernennen – der in Ungarn „Palatin“ genannt wurde –, sondern schlug den Ständen lediglich Kandidaten vor. Die Adelsvertreter trafen dann die Wahl, wer in der Abwesenheit des Monarchen dessen königliche Prärogative ausüben sollte.
Da die Mehrzahl der habsburgischen Untertanen außerhalb der österreichischen Kernländer der Donaumonarchie lebte, wurden die Stände der umliegenden Territorien zu einem unverzichtbaren Bindeglied zwischen der Dynastie der Habsburger und ihrem großen, bevölkerungsstarken Reich. Ohne die Hilfe oder auch nur das Einverständnis der Stände ließ sich wenig bewirken. Insbesondere an die Erhebung von Steuern war ohne ihre Mithilfe kaum zu denken, und die Einkünfte aus dem habsburgischen Kammergut deckten nur einen Bruchteil der Gesamtausgaben der Monarchie. Im Mittelalter hatte man von Monarchen erwartet, dass sie „von ihrem Eigen leben“ und den Besitz ihrer Untertanen nur in Krisensituationen antasten würden, also etwa im Falle einer Invasion oder einer Naturkatastrophe. Das mitteleuropäische Ständesystem bildete sich im 15. Jahrhundert auch dazu heraus, die Bewilligung solcher (eigentlich „außerordentlichen“) Steuern zu erleichtern. Dies geschah zu einer Zeit, in der die Herrscher immer umfassendere Zuständigkeiten übernahmen, deren Erfüllung ja auch irgendwie finanziert werden musste. Die zunehmende Verstetigung der Königsherrschaft sowie die steigende Komplexität der Probleme, mit denen die Monarchen sich konfrontiert sahen, führten schließlich zu immer häufigeren Versammlungen, wodurch die unregelmäßige Besteuerung von einst Schritt für Schritt in eine regelmäßige, jährliche Steuererhebung verwandelt wurde. Die Stände sahen sich genötigt, ihre eigenen Institutionen zu schaffen: ständige Kommissionen etwa, die auch dann Kontakt zum Herrscher hielten, wenn die Ständeversammlung gerade nicht tagte, oder ein zentrales Sekretariat, das die Aufzeichnungen über alle Regierungsgeschäfte führte und aufbewahrte und die Steuererhebung und -vergabe verwaltete. Die Wiener Hofkammer empfing die Steuerzahlungen der Stände aus der ganzen Habsburgermonarchie, dazu die Erträge, die von den Verwaltern des königlichen Kammerguts überwiesen wurden. Der Umfang und die Regelmäßigkeit ihrer Steuerzahlungen bestimmten die Bonität der Stände; stand es um diese gut, konnten sie Kredite über weitere Summen erhalten und einen Teil der habsburgischen Schulden übernehmen. Im Gegenzug wurde ihnen dann die Erlaubnis erteilt, zusätzliche Steuern zu erheben, um beides abzubezahlen.
Auf diese Weise entstand parallel zum Herrschaftssystem der Habsburgermonarchie eine zweite Regierungs- und Verwaltungsstruktur, wobei die Stände nur geringes Verlangen danach trugen, die politische Macht für sich zu reklamieren. Ihre Vorstellung einer monarchia mixta beließ die Regierungsinitiative in der Hand des Monarchen, insbesondere was die Außen- und die Krisenpolitik anging. Sich selbst sahen die Stände in der Rolle von Hütern der bestehenden Ordnung, die dem Gemeinwohl am besten dienten, wenn sie den Herrscher davon abhielten, sich auf allzu halsbrecherische oder gar unrechtmäßige Abenteuer einzulassen. Ihre Rechte und Freiheiten hatten sie über Jahrhunderte hinweg mit einer ganzen Reihe von Herrschern ausgehandelt; nun betrachteten die Stände es als ihre Pflicht, diese Rechte und Freiheiten zu verteidigen und zu mehren. Gegen neue Gesetze, die mit der angestammten Rechtsüberlieferung brachen, erhoben sie bitteren Widerspruch. Wenn bestimmte Maßnahmen nicht auf ihre Zustimmung stießen, taten sie alles, um deren Umsetzung zu behindern. Und doch ergab das alles in der Summe noch kein modernes parlamentarisches System, da die Stände letztlich nur Vehikel für Partikular-, ja sogar Individualinteressen darstellten. Nirgends wird dies deutlicher als in der Kampagne für Religionsfreiheit, mit der die Ausbreitung der Reformation auf das Territorium der Habsburger einherging: Da wurde der Protestantismus nämlich am Ende zur Chiffre für ständische Privilegien – und nicht für individuelle Freiheit.
Der Protestantismus breitet sich aus Allen protestantischen Hoffnungen zum Trotz, dieser oder jener Erzherzog könnte den neuen Glauben annehmen, blieben die Habsburger ausnahmslos katholisch. Dem Protestantismus fehlte auf habsburgischem Boden deshalb jener politische Rückhalt, der in den anderen Gebieten des Heiligen Römischen Reiches protestantische Landeskirchen hervorgebracht hatte. Die Anhänger der Reformation im Habsburgerreich sahen sich gezwungen, mit dem Aufbau ihrer kirchlichen Strukturen gewissermaßen bei null anzufangen, wodurch nicht dem Herrscherhaus, sondern dem Adel die führende Rolle zukam. Der Adel war es schließlich, der in weiten Teilen der Habsburgermonarchie die niedere Gerichtsbarkeit ausübte, und dazu gehörte eben oft das Recht, als Patron und „Kirchherr“ die Gemeindepfarrer und Lehrer für seine ansässigen Pachtbauern zu „präsentieren“ (vorzuschlagen) beziehungsweise zu berufen. Die geistliche Gerichtsbarkeit lag zwar noch immer bei dem jeweiligen Ortsbischof; nur residierte der in der Regel weit entfernt und war sogar darauf angewiesen, dass die Grundbesitzer ihre Geistlichen selbst bezahlten. Diese Schwäche der Kirche spiegelte sich auch in den Ständeversammlungen wider, wo der Klerus sich dem Adel unterordnete. In Anbetracht der wichtigen Rolle, die den Ständen bei der Durchsetzung moralischer und gesellschaftlicher Normen zukam, befand sich der Adel also in einer hervorragenden Position, um nicht allein die Reformation des Wortes, sondern auch die „zweite Reformation“ der Besserung des Lebens voranzutreiben. Ganz unabhängig von den persönlichen Überzeugungen einzelner Adliger war der Protestantismus zudem geeignet, bestehende Herrschaftsstrukturen zu festigen, indem er das (geistliche) Patronatsrecht mit anderen (weltlichen) Eigentumsrechten verschmolz. In den Worten eines prominenten niederösterreichischen Adligen: „Alles Geistliche ist unser, so haben wir beschlossen: Wir sind auf unseren Gütern Herren und Bischöfe zugleich. Wir setzen die Pfaffen ein und ab und sind alleinige Herren, denen sie zu gehorchen haben.“41 Waren lutherische Adlige in einer bestimmten Provinz vertreten, führte dies bald zu einem Phänomen, das als „Auslauf“ bezeichnet wurde: Bauern und Bürger der benachbarten katholischen Landgüter und Städte strömten über die Grenzen, um an den protestantischen Gottesdiensten teilzunehmen. Die entscheidende Rolle des Adels zeigt sich auch am Beispiel Tirols, wo der neue Glaube in der allgemeinen Wahrnehmung stark mit der Erfahrung seiner radikalen Spielarten im frühen 16. Jahrhundert verbunden blieb, während die Attraktivität des Katholizismus nach der Entsendung von Kapuzinermissionaren durch Kardinal Borromäus eher wieder zunahm. Der Tiroler Adel jedenfalls blieb stramm katholisch, und die Tiroler Landstände stellten sich geschlossen hinter den Erzherzog, als dieser 1585 die Tiroler Protestanten vor die Wahl stellte, entweder zu konvertieren oder das Land zu verlassen.
Zu jener Zeit war der Katholizismus in den anderen Ländern des Habsburgerreiches bereits stark unter Druck geraten. Neun von zehn Angehörigen des niederösterreichischen Adels hatten sich dem Luthertum angeschlossen, ebenso 85 Prozent des Adels von Oberösterreich, wo zudem drei Viertel der Stadtbevölkerung und gut die Hälfte der Bauern protestantisch geworden waren. Auch in Innerösterreich hatten sich rund 70 Prozent der Bevölkerung von Rom losgesagt; im Herzogtum Steiermark waren nur fünf von 135 Adligen katholisch geblieben. Die überwiegend „windische“ (slowenische) Bauernschaft des Herzogtums lehnte zwar die – von ihnen als „deutsche Religion“ empfundene – neue Lehre ab; von den 22 steirischen Kronstädten waren jedoch bis 1572 ganze 16 – und damit gut zwei Drittel – zum Luthertum übergetreten.42 Die zum Protestantismus konvertierten Adligen begannen umgehend, sich in ihren jeweiligen Landtagen für die offizielle Anerkennung ihrer Religion durch die Habsburger einzusetzen. Und da die Anzahl von Katholiken in den Ständeversammlungen immer weiter abnahm, blieb dem Erzhaus keine andere Wahl, als mit den Protestanten Kompromisse einzugehen. Nur so konnten die Habsburger sich deren fortgesetzte Unterstützung bei der Bewältigung ihrer horrenden Staatsschulden sichern. Die Dreiteilung der habsburgischen Länder 1564 zwang die nun getrennt regierenden Linien, jede für sich mit ihren jeweiligen Landständen zu verhandeln. Den Ständen von Ober- und Niederösterreich gelang es 1568 beziehungsweise 1571, sich eine „Assekuration“ genannte Anerkennung ihrer lutherischen Konfession zu sichern, wodurch allen Herren, Rittern und Pachtbauern der betreffenden Territorien die freie Religionswahl zugestanden wurde. Im Gegenzug mussten die Stände habsburgische Schulden in Höhe von 2,5 Millionen Gulden begleichen. Diese Privilegien wurden 1574 dahingehend erweitert, dass lutherische Adlige nun auch in ihren Stadtpalais Gottesdienst halten durften – wodurch diese de facto zu protestantischen Kirchen auch inmitten von (katholischen) Kronstädten wurden, namentlich in Wien. Die innerösterreichischen Landstände übernahmen 1572 eine weitere Million Gulden Schulden und erhielten dafür vergleichbare Privilegien. Sechs Jahre später, 1578, wurden diese Privilegien durch die Brucker Religionspazifikation (das sogenannte Brucker Libell) noch ausgebaut; im Gegenzug sagten die Stände zu, regelmäßige Steuerzahlungen zum Unterhalt der Grenzbefestigungen gegen die Türken zu leisten. Bis 1600 hatten die Innerösterreicher schließlich 1,7 Millionen Gulden für die Schuldentilgung aufgewandt, während sich die Zahlungen für den Unterhalt der Grenze zwischen 1588 und 1608 auf zusätzliche 2,93 Millionen Gulden beliefen.43 Letztlich war es die einfache Bevölkerung, die einen hohen Preis dafür zahlte, dass der österreichische Adel sich – gleichsam auf dem Rücken des „gemeinen Mannes“ – seine eigene Variante derjenigen Religionsfreiheiten erkaufen konnte, die den deutschen Fürsten im Frieden von Augsburg gewährt worden waren.
Anders stellte sich die Situation in Böhmen dar, wo man bereits 1436 und 1485 Vereinbarungen getroffen hatte, in denen der sogenannte Utraquismus dem Katholizismus gleichgestellt wurde. Beim Utraquismus handelte es sich um eine gemäßigte Spielart des Hussitentums; ihren Namen hatten seine Anhänger daher erhalten, dass sie auf dem Empfang der Eucharistie in beiderlei Gestalt (sub utraque specie), also in Form von Brot und Wein, bestanden. (In anderen Konfessionen blieb der Wein dem Priester vorbehalten, der die Messe feierte.) Die Gottesdienste der Utraquisten wurden in der tschechischen Volkssprache gehalten, und ihre Kirchen lagen außerhalb der bischöflichen Jurisdiktion. Kompromissbereitschaft zeigte die utraquistische Seite, indem sie einwilligte, ihre Priester in Venedig weihen zu lassen. Die Habsburger bestätigten diese Privilegien, als Böhmen 1526 unter ihre Herrschaft kam – nicht zuletzt, weil die utraquistische Bewegung in jener Zeit an Schwungkraft verloren hatte und die meisten Katholiken hofften, ihre Anhänger würden schon bald wieder in den Schoß der römischen Kirche zurückkehren. Allerdings hatte sich bereits eine radikale Splittergruppe der Utraquisten abgespalten, aus der schließlich die „Brüderunität“ (Unitas Fratrum, auch „Böhmische“ beziehungsweise „Mährische Brüder“) hervorging, die eine Unterordnung unter die Autorität des Papstes oder auch die Aufgabe des spezifisch hussitischen Sozialprogramms strikt ablehnte. Insbesondere die enge Bindung des Utraquismus an die böhmischtschechische Volkskultur und Sprache sorgte dafür, dass die Verbreitung des Luthertums in Böhmen sich auf die deutschsprachige Stadtbevölkerung und einen Teil des Adels beschränkte. Als der böhmische Adel sich 1547 weigerte, an der Seite der Habsburger in den Schmalkaldischen Krieg zu ziehen, ging Ferdinand I. mit harter Hand gegen die radikalen „Brüder“ vor und läutete eine groß angelegte Rekatholisierungskampagne ein. In Prag wurde 1556 ein Jesuitenkolleg eröffnet, 1561 auch ein neuer Erzbischof von Prag eingesetzt – nach einer Sedisvakanz von annähernd 150 Jahren!
Das Wiedererstarken des Katholizismus veranlasste die anderen Konfessionen dazu, enger zusammenzurücken. Durch Vermittlung und auf Betreiben der protestantischen Stände Böhmens kam 1575 die Confessio Bohemica zustande, eine Bekenntnisschrift, die mit ihrer bewussten Verharmlosung der theologischen Differenzen zwischen Lutheranern, Utraquisten und Böhmischen Brüdern als Fundament zur Errichtung einer gemeinprotestantischen „Kompromisskirche“ gedacht war. Allerdings folgte dem kein politischer Handel, der dem österreichischen Privilegien- und Schuldentausch vergleichbar gewesen wäre. Maximilian II. sah überhaupt keinen Grund, die habsburgische Anerkennung reformatorischer Strömungen über den Kreis der Utraquisten hinaus auszudehnen, und folglich lehnten die Stände das Ansinnen seines Nachfolgers ab, sie sollten die Schulden der böhmischen Krone in Höhe von fünf Millionen Gulden übernehmen. Die Brüderunität spaltete sich daraufhin auf; viele Brüder kehrten in die Reihen der gemäßigten Utraquisten zurück (wovon sie sich obrigkeitlichen Schutz erhofften), während sich andere dem Calvinismus anschlossen, den Pfälzer Einwanderer und adlige Scholaren, die vom Studium an deutschen Universitäten heimkehrten, in den 1580er-Jahren nach Böhmen mitgebracht hatten. Das Luthertum konnte allein in Schlesien und den Lausitzen Fuß fassen, wobei unter den schlesischen Fürsten und gebildeten Stadtbürgern im frühen 17. Jahrhundert auch der Calvinismus Boden gewann.
Das religiöse Spektrum in den Ländern der böhmischen Krone war vielfältiger als in Österreich. Katholiken machten in Böhmen gerade noch 15, in Mähren immerhin 35 Prozent der Bevölkerung aus; den großen Rest stellten hauptsächlich Utraquisten, „Brüder“ und Lutheraner. Zum Calvinismus bekannten sich gerade einmal drei Prozent der Gesamtbevölkerung, doch besaß diese Minderheit einen überproportional großen politischen Einfluss, denn die Calvinisten gehörten oft der gesellschaftlichen Elite an. Insgesamt blieb die Situation aber im Fluss, da die Stände an ihrer Einschätzung festhielten, die Religion sei eine Gottesgabe, über die bloße Sterbliche nicht nach Gutdünken bestimmen könnten. Die Beziehung der Stände zu ihrem Herrscher beruhte auf einer beiderseitigen Achtung vor den Interessen der Gegenseite, weshalb bei allen Verhandlungen die ernste Absicht verfolgt wurde, einen sicheren, dauerhaften Kompromiss zu erzielen. Diese überlieferte Haltung war tief in das Geflecht einer Gesellschaft eingewoben, in der es durchaus nicht selten war, dass in ein und derselben Familie verschiedene konfessionelle Strömungen vorkamen. Verständlicherweise sahen die meisten Adligen davon ab, ihren persönlichen Glauben öffentlich zu bekennen, insbesondere in Mähren, wo die Brüderunität noch immer Zulauf fand und sich selbst Wiedertäufergemeinschaften halten konnten. Viele Adlige versammelten Bücher ganz gemischter konfessioneller Ausrichtung in ihren Privatbibliotheken, und tatsächlich scheinen die meisten von ihnen, was sie persönlich betraf, einem überkonfessionellen, „erasmischen“ Christentum den Vorzug gegeben zu haben. Gewiss, es gab Spannungen – aber kein Vorgefühl einer drohenden Krise.
In Ungarn, wo das Luthertum beinahe schon traditionell als „zu deutsch“ galt, hatte der Calvinismus leichteres Spiel. Weniger als ein Fünftel der magyarischen Bevölkerung war zum Luthertum konvertiert, und diese Minderheit konzentrierte sich noch dazu in abgelegenen Bergdörfern, in die der Arm der adligen Grundherrschaft kaum reichte. Auch unter den Slowaken im oberungarischen Nordosten des Königreiches fiel die lutherische Lehre auf fruchtbaren Boden, ebenso bei den Südslawen Kroatiens und Sloweniens. Allerdings entschied sich fast die Hälfte des Adels für den Calvinismus, ganz wie ein großer Teil der magyarischen Bauernschaft. Nur einer von zehn magyarischen Adligen blieb Rom treu, und 1606 gab es im gesamten habsburgischen Ungarn gerade einmal 300 katholische Priester, die sich zum größten Teil in den Gebieten um die Bischofssitze Gran (Esztergom), Raab (Győr) und Neutra (das heute slowakische Nitra) konzentrierten. Kroatien und die drei slowenischen Kernländer blieben vorwiegend katholisch, was hauptsächlich daran lag, dass der ansässige Adel zu seinem Lebensunterhalt auf Posten an der Militärgrenze angewiesen war und dabei die Konkurrenz des innerösterreichischen lutherischen Adels fürchtete.
Soziale Spannungen Die Ausbreitung der konkurrierenden Konfessionen war vom Verhalten des örtlichen Adels bestimmt. Obwohl sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Katholiken überall im Habsburgerreich in der Minderheit befanden – mit Ausnahme Kroatiens und Tirols –, war es doch keiner der protestantischen Strömungen gelungen, uneingeschränkte Akzeptanz zu erlangen. Ihre rechtliche Anerkennung beruhte einzig und allein auf den Zugeständnissen, die den Habsburgern durch das Drehen der Stände am Geldhahn abgenötigt worden waren. Noch konnten diese Rechte keineswegs als angestammt gelten; ihr Fortbestand hing ganz davon ab, inwiefern diejenigen, die von ihnen profitierten, auch andere von ihrer Notwendigkeit überzeugen konnten. Der protestantische Adel sah sich nicht nur erheblichen internen Widerständen seitens seiner verbliebenen katholischen Standesgenossen gegenüber, sondern musste erkennen, dass die Unterstützung anderer ständischer Gruppen, auch angesichts einer krisenhaften wirtschaftlichen Gesamtentwicklung, immer schwerer zu erreichen war.
Der Wohlstand des Adels entstammte einer überwiegend agrarisch geprägten Ökonomie, beruhte gleichsam auf Roggen, Hafer, Weizen und Gerste. In Tirol und Teilen von Innerösterreich spielte auch der Bergbau eine gewisse Rolle, jedoch befand sich dieser hauptsächlich in habsburgischer Hand. In Oberösterreich, Böhmen und Westmähren expandierte die Textilproduktion, während in anderen Gegenden Mährens und in Ungarn der Pferdezucht große Bedeutung zukam. All diese Wirtschaftsaktivitäten erforderten Land und Arbeitskräfte – und beide Faktoren waren Bestandteil der feudalen Herrschaftsrechte. Wie die Habsburger, so verwalteten auch die meisten niederen Grundherren ihren Besitz nur zu einem kleinen Teil direkt (als Domanialgut); den größeren Rest überließen sie – gegen Zahlung eines bestimmten Pachtzinses – an abhängige Pachtbauern und Hintersassen. Im späteren 16. Jahrhundert machte eine steigende Inflationsrate dieses Modell zunehmend unattraktiver; und da die Pächter oft mehreren Grundherren zugleich einen Zins schuldeten und ihre Herren gegeneinander auszuspielen wussten, war es sehr schwer, sie zur Zahlung einer höheren Pacht zu zwingen. Auch weiteten die Habsburger das gerichtliche Beschwerderecht auf den Stand der Bauern aus, was ihnen ein probates Mittel schien, um als Schlichter zwischen Grundherren und Pachtbauern auf dem Land zu intervenieren und so politische Macht an sich zu ziehen. Nur die ungarischen Stände verhinderten 1556 die Einführung dieses Rechts. Das stetige Wachstum der Städte im Nordwesten Europas kurbelte die Getreidenachfrage an, wodurch sich den ost- und mitteleuropäischen Großgrundbesitzern im Verlauf des 16. Jahrhunderts neue und expandierende Absatzmärkte öffneten. Sie erweiterten ihren Grundbesitz durch Zukauf, Zwangsvollstreckung – oder sie vertrieben einfach die bisherigen Bewohner. Zugleich kam es zu einer Stärkung der Feudalgerichtsbarkeit, durch deren Druck die abhängigen Pachtbauern zum Dienst für ihre Grundherren gepresst werden sollten.
Man hat diese Entwicklung und ihre Folgen als „zweite Leibeigenschaft“ beschrieben, denn sie erfolgte gerade zu der Zeit, als die mittelalterliche Leibeigenschaft sich anderswo in Europa auf dem Rückzug befand. Besonders deutlich trat die „zweite Leibeigenschaft“ in Polen, Ungarn, Böhmen, Teilen Österreichs und dem Nordosten des deutschsprachigen Raums auf, doch sollte die griffige Bezeichnung nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um ein ziemlich vielgestaltiges Phänomen handelte – und noch dazu um eines, das selbst da, wo es auftrat, nicht zwangsläufig die vorherrschende Form grundherrlicher Ausbeutung darstellte.44 Dennoch brachte die Ausweitung solcher gutswirtschaftlichen Strukturen – die nun einmal zeitgleich mit Inflation, demografischen und ökologischen Wandlungsprozessen erfolgte – eine auf die Dauer immer größere Belastung der Landbevölkerung mit sich und stand zudem für die einsetzende Kommerzialisierung der ländlichen Lebenswelt. Die Grundherren begannen, Wälder und andere Wirtschaftsgüter auf neue Weise wirtschaftlich zu nutzen, etwa indem sie von ihren Pächtern Geld für das Feuerholz verlangten, das diese im Wald sammelten, oder für das Recht, ihre Schweine dort zur Futtersuche hineinzutreiben. Solche und andere Veränderungen sorgten mitunter auch für Spannungen innerhalb der adligen Oberschicht, weil manche Grundherren zur Nutzung der neuen Möglichkeiten besser aufgestellt waren als andere. Am extremsten war die Lage in Ungarn, wo rund 50 Magnatenfamilien über die Jahre 41 Prozent des gesamten Landbesitzes an sich gezogen hatten. Dadurch genossen sie nicht nur die Größenvorteile – in der heutigen Wirtschaft würde man sagen: die Skaleneffekte – einer derartigen Betriebsorganisation, sondern gewannen auch ständig neue Klienten und Parteigänger hinzu, denn durch ihren großen Reichtum konnten sie es sich leisten, „Privatarmeen“ zu unterhalten, die das Banditentum bekämpften und sich sogar den Türken in den Weg stellten. Dem Niedergang des ungarischen Kleinadels gegenüber diesen Magnaten entsprach eine ganz ähnliche Entwicklung in Böhmen, dessen Ritterschaft in den fünf Jahrzehnten vor 1618 um annähernd ein Drittel schrumpfte. Der Reichtum des Adels konzentrierte sich auf immer weniger Familien, bis schließlich elf mächtige Adelshäuser ein gutes Viertel des böhmischen Grundbesitzes auf sich vereinten.
Der Zorn der Bauern entlud sich zuerst 1595 in Oberösterreich und griff im Jahr darauf in die westlichen Gegenden Niederösterreichs über. Unmittelbarer Auslöser der Unruhen war der wenig feinfühlige Versuch gewesen, einigen protestantischen Gemeinden katholische Pfarrer aufzuzwängen, doch die wahren Gründe reichten tiefer, und bald richtete der Protest der Bauern sich auch gegen die lutherischen Adligen, die die Landstände dominierten. Die Aufständischen verlangten nach der „Schweizer Freiheit“, sie wollten in den Ständeversammlungen vertreten sein und die zuletzt eingeführten Steuern und Abgaben auf dem schnellsten Wege aufgehoben wissen. Als Kopf der Habsburgerdynastie und Erzherzog von Österreich bemühte sich Kaiser Rudolf II. um eine gütliche Einigung, verärgerte jedoch beide Seiten durch ungeschickte Versuche, seine Vermittlerrolle zur Stärkung des Katholizismus zu gebrauchen. Angesichts einer neuerlichen Welle der Gewalt im Herbst 1596 übertrug Rudolf die Gesprächsführung seinem jüngeren Bruder Matthias, den er im Jahr zuvor bereits zum Statthalter in Österreich ernannt hatte. Matthias verband effektivere militärische Gegenmaßnahmen mit einer aufrichtigen Erforschung der bäuerlichen Klagepunkte. Es war dieselbe Strategie, die sich im Kielwasser des deutschen Bauernkrieges von 1525 so hervorragend bewährt hatte. Ungefähr 100 Anführer der Aufständischen wurden hingerichtet; mehreren Tausend anderen schnitt man Nasen und Ohren ab, um die Unrechtmäßigkeit ihrer Rebellion zu betonen. Unterdessen war im Juni 1598 der Protest durch die „ordnungsgemäßen“ Kanäle der habsburgischen Verwaltung erfolgreich, indem die Dienstpflicht der Bauern auf den Gütern ihrer Grundherren per Dekret auf zwei Wochen im Jahr beschränkt wurde.
Die Krisensituation des Bauernaufstands offenbarte die unverminderte Abhängigkeit des Adels von dem habsburgischen Herrscherhaus, nicht zuletzt, weil die Landesaufgebote der einzelnen Provinzen sich als unfähig erwiesen hatten, gegen die aufständischen Bauern vorzugehen. Außerdem wurde deutlich, dass sich die diversen Spaltungen in der ständischen Gesellschaft nur schwerlich überwinden ließen, um ein breites Bündnis zu schaffen. Selbst da, wo sie demselben Glauben anhingen, standen sich Adel, Stadtbürger und Bauernschaft in erbitterter Opposition gegenüber. Die Städter verachteten die Bauern und beteiligten sich nicht selten an deren Ausbeutung, etwa indem sie verschuldeten Landpächtern Kredite zu Wucherzinsen gewährten oder deren Familien in der gerade aufkommenden Textilindustrie für Hungerlöhne Stückarbeit leisten ließen. In den Städten sah man wenig Grund, die Forderung der Bauern nach einer ständischen Repräsentation auch der Landbevölkerung zu unterstützen. Noch grundlegender war jedoch, dass alle Gemeinschaften, ob auf dem Land oder in der Stadt, von Gräben tiefer Ungleichheit durchzogen wurden, denen gegenüber die nachbarschaftliche Nähe eines geteilten Lebensumfelds meist in den Hintergrund trat. Diese Gräben sorgten dafür, dass die Gemeinschaften vor allem dann gespalten blieben, wenn sie eigentlich hätten zusammenstehen müssen: in der Konfrontation nämlich mit den Forderungen Außenstehender, seien es Grundherren oder andere. Obwohl jede Gemeinschaft ihre eigenen Angelegenheiten im Großen und Ganzen selbst regelte, hatte nur eine Minderheit von Begüterten dabei ein Mitspracherecht. Die arme Mehrheit blieb ohne Stimme, ja oft sogar ohne ein festes Wohn- und Aufenthaltsrecht, vor allem in den Städten. Zur Aufstockung ihrer unregelmäßigen oder saisonalen Arbeitseinkünfte waren diese weitgehend Mittellosen in der Regel auf die Nutzung von Gemeingütern angewiesen, etwa von gemeinschaftlich genutzten Weiden (Allmenden), auf denen sie ihre wenigen Nutztiere halten konnten. Reichere Bauern versuchten, zusätzliche Steuer- und Dienstlasten auf ihre ärmeren, in keinem dörflichen Gremium vertretenen Nachbarn abzuwälzen, nur um gleichzeitig – unter Verweis auf eine Erosionsgefahr durch Übernutzung – deren Zugang zu den überlebenswichtigen Gemeingütern einzuschränken. Die Religion brachte die Menschen nicht nur nicht näher zusammen, sondern säte – durch den Kampf der Konfessionen, der über soziale wie wirtschaftliche Gräben hinweg geführt wurde – neue Zwietracht. Die Frage, wie man die gemeinsamen Ziele am besten erreichen solle, löste immer wieder bitteren Streit aus, da manche auf das Versprechen der Obrigkeit setzten, Missstände auf rechtlichem Wege abzustellen, während andere der Meinung waren, der gewaltsame Protest sei die einzig verbliebene Wahl. Der Adel respektierte bis zu einem gewissen Grad die religiösen Überzeugungen der Bauern – jedenfalls solange diese mit seinen eigenen übereinstimmten. Der Bauernaufstand zeigte allerdings auch, dass sich religiöse und politische Freiheit nur schwer verbinden ließen, denn schon 1596 taten sich lutherische Adlige mit ihren katholischen Standesgenossen zusammen, warben Söldner an und unterstützten den Erzherzog Matthias.