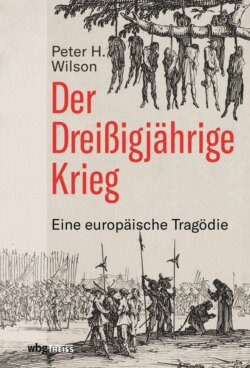Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Peter H. Wilson - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Der Türkenkrieg und seine Folgen Die Türkengefahr
ОглавлениеRudolf II. trat der Herausforderung durch das Osmanische Reich, der sich seine Länder ab 1593 gegenübersahen, mit Selbstbewusstsein entgegen, und zog sehenden Auges in den Konflikt, der als „Langer Türkenkrieg“ der Jahre 1593–1606 für beide Seiten zum Fiasko werden sollte. Dieser 13-jährige Krieg leistete seinen Beitrag zu einer ganzen Kette von Problemen, die das Osmanische Reich aus dem Dreißigjährigen Krieg heraushielten, und bescherte Ungarn auf diese Weise eine Phase relativer Ruhe. In der Rückschau war dies für die Habsburger zweifellos von Vorteil, denn so konnten sie sich ganz auf die inneren Probleme des Heiligen Römischen Reiches sowie auf den Kampf gegen ihre Feinde im Westen und Norden konzentrieren. Zur damaligen Zeit konnte das jedoch noch nicht klar sein, und so blieben Türkenfurcht und Türkengefahr eine beständige Quelle der Sorge für eine ganze Generation. Und was noch schlimmer war: Der Türkenkrieg bewirkte schließlich den finanziellen wie politischen Bankrott der Habsburger und trug so schließlich doch zum erneuten Ausbruch eines großen Krieges im Jahr 1618 bei.
Die Geißel Gottes Der Türkenkrieg und seine Folgen haben in der Geschichtswissenschaft bislang nicht die Beachtung gefunden, die ihnen eigentlich zukäme. Folglich bleibt das Osmanische Reich in den meisten Darstellungen des Dreißigjährigen Krieges nichts als ein Schatten, eine schemenhafte Gestalt im Hintergrund des Geschehens. Dabei war das Reich der Osmanen die Weltmacht der Frühen Neuzeit und erstreckte sich auf 2,3 Millionen Quadratkilometern über drei Kontinente. Die osmanischen Sultane geboten über mindestens 22 Millionen Untertanen; das waren mehr als dreimal so viele Menschen, wie im Habsburgerreich lebten.53 Gewiss, die ursprüngliche Dynamik der osmanischen Expansion hatte nach dem Tod Sultan Süleymans des Prächtigen im Jahr 1566 merklich nachgelassen, aber es wäre doch falsch, schon die Zeit unmittelbar danach als Anfang vom Ende des Osmanischen Reiches zu beschreiben. Die Türken blieben der Schrecken Europas, und Protestanten wie Katholiken erblickten in ihnen eine „Geißel Gottes“, mit der die sündige Menschheit gestraft werden sollte, weshalb man mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Abscheu auf sie schaute.54 Das Osmanische Reich expandierte durchaus noch, vor allem im Osten, wo die (sunnitischen) Osmanen zwischen 1576 und 1590 Georgien und Aserbaidschan eroberten, die vorher beide zum Reich der persischen (und schiitischen) Safawiden-Dynastie gehört hatten. Das beunruhigte die Habsburger immerhin so sehr, dass sie im November 1590 geradezu entwürdigende Bedingungen akzeptierten, um eine achtjährige Verlängerung des Waffenstillstandes zu erreichen, der am Ende des letzten Türkenkrieges 1568 geschlossen worden war. Trotz der damit verbundenen hohen Kosten unterhielt der Kaiser eine ständige Gesandtschaft in Konstantinopel, während der Sultan es verschmähte, sich mit den Ungläubigen überhaupt zu beschäftigen, und nur selten Gesandte an christliche Höfe schickte. Die österreichischen Diplomaten in Konstantinopel hatten ihre liebe Not, zuverlässige Informationen über den osmanischen Hof zu sammeln, der sich in jeder Hinsicht als würdiger Nachfolger der Kaiserhöfe des mittelalterlichen Byzanz erwies, an denen ja sprichwörtlich „byzantinisch-verworrene“ Zustände geherrscht hatten. Wochenlang ließ man sie warten, und wenn es dann einmal zu einer Audienz mit den Beamten der Hohen Pforte kam, gaben diese ihnen nur ausweichende oder gar widersprüchliche Antworten auf ihre Fragen. Die gleichzeitige Anwesenheit niederländischer, englischer, französischer, venezianischer und anderer christlicher Gesandtschaften in der Stadt bot weiteren Grund zur Sorge, denn alle diese Mächte galten als Feinde des römisch-deutschen Kaisers.
Die beschriebene Schwierigkeit, sich ein klares Bild vom Stand der osmanischen Politik und Regierung zu machen, verhinderte, dass den Außenstehenden die wachsenden inneren Probleme des Osmanischen Reiches bewusst wurden. Das Fehlen einer allgemein anerkannten Thronfolgeregelung sorgte immer wieder für blutige Familienfehden und brachte jeden neuen Sultan dazu, taubstummen – und also diskreten – Schergen die Erdrosselung seiner Brüder und Schwestern zu befehlen. Interne Intrigen schwächten das zunehmend orientierungslose Sultanat ausgerechnet zu einer Zeit, in der sein ärgster Feind im Osten, Persien, unter der Dynastie der Safawiden einer neuen Machtblüte entgegenschritt. Selbst die Eroberungen im Kaukasus brachten nicht die erforderliche Beute ein, um diejenigen Gruppen zufriedenzustellen, von denen das Schicksal des Osmanischen Reiches abhing. Das war zunächst die Armee, die einst der mächtigste Pfeiler der Sultansherrschaft gewesen war – und die sich jetzt, mit desaströsen Folgen, in die Politik einzumischen begann. Vor allem die Janitscharen, die Elitetruppe der osmanischen Infanterie, waren es gewohnt, von jedem neuen Sultan mit üppigen Sonderzahlungen entlohnt zu werden. Nun aber fingen sie an, die Sultane zu erpressen: Flossen keine Gelder, so drohten sie, dem Herrscher ihre Gefolgschaft aufzukündigen. Das ging so weit, dass 1622 der junge Sultan Osman II. von seinen eigenen Soldaten ermordet wurde, was einen Präzedenzfall schuf, dem 1648 sowie im späteren 17. Jahrhundert weitere Attentate folgten.55
Die inneren Probleme ihres Reiches machten die Osmanen immer unberechenbarer, was ihr außenpolitisches Handeln betraf. Die ohnehin schon labile Situation im Südosten Europas, wo das Osmanische Reich mit dem Habsburgerreich im Westen sowie dem polnisch-litauischen Wahlkönigreich im Osten zusammentraf, wurde so noch gefährlicher. Der Krieg, der 1593 ausbrach, war im Grunde ein Kampf um die Vorherrschaft zwischen zweien dieser Mächte, die ihre Herrschaft auf die umstrittene Kontaktzone ausdehnen und ihren Rivalen den Zugang strikt verwehren wollten. Ungarn im Westen war bereits in eine habsburgische und eine osmanische Einflusssphäre aufgeteilt worden: Der römisch-deutsche Kaiser kontrollierte den Norden und den Südwesten des Landes sowie Kroatien, während der Sultan über Mittelungarn und den Südosten des Landes herrschte. In der Region weiter im Osten hatte keine der beiden Großmächte eine feste Machtbasis. Hier sind vier Herrschaftsbereiche zu nennen, die nominell alle der türkischen Oberherrschaft unterstanden, de facto jedoch, mit unterschiedlichen Graden von Autonomie, ihre eigenen Ziele verfolgten. Die Gegend entlang der Nordküste des Schwarzen Meeres besaßen die Krimtataren, jene Nachfahren Dschingis Khans, die dem Sultan seit dem späten 15. Jahrhundert Tribut gezahlt hatten. Sie lieferten der osmanischen Armee im Bedarfsfall wertvolle Hilfstruppen; ansonsten ließ man sie weitgehend unbehelligt, da sie in ihrem Heimatgebiet einen „Puffer“ zwischen dem Osmanenreich und jenem der russischen Zaren bildeten, das weiter im Nordosten gelegen war. Nördlich und westlich der Tatarengebiete lagen die drei christlichen Fürstentümer Moldau, Walachei und Siebenbürgen. Auch sie waren dem Sultan tributpflichtig, zeigten sich aber offener gegenüber polnischer und österreichischer Einflussnahme. Die Polen wiederum suchten Zugang zum Schwarzen Meer zu erlangen, indem sie durch das zwischen Moldau und Krim gelegene Podolien nach Süden vorstießen. Der polnische Einfluss im Fürstentum Moldau wurde während der 1590er-Jahre deutlich sichtbar, und auch in der Innenpolitik Siebenbürgens und der Walachei spielten polnische Intrigen eine gewisse Rolle.
Siebenbürgen Von den drei genannten Fürstentümern ist Siebenbürgen das für unsere Geschichte wichtigste, und eine Betrachtung seiner innenpolitischen Verhältnisse lässt vieles erkennen, was auch für Moldau und Walachei typisch war. Das Fürstentum Siebenbürgen war in den 1540er-Jahren aus den Trümmern des alten Königreichs Ungarn hervorgegangen und stellte einen Flickenteppich aus vier größeren und mehreren kleineren Teilgebieten dar. Neben Bevölkerungsinseln von türkischen Bauern und Ostslawen gab es orthodoxe Rumänen, calvinistische Magyaren (ethnische Ungarn), lutherische deutsche Einwanderer (die Siebenbürger Sachsen) und schließlich noch die Bevölkerungsgruppe der Szekler, die im waldreichen Osten des Fürstentums siedelten, sich selbst regierten und auch nach der Reformation katholisch geblieben waren.56 Der Fürst hielt sich an der Macht, indem er Übereinkünfte zwischen diesen Gruppen aushandeln half, insbesondere zwischen den drei ständischen „Nationen“ Siebenbürgens, die auf den Landtagen des Fürstentums vertreten waren: dem magyarischen Adel, den siebenbürgisch-sächsischen Städten und den Szeklerdörfern. Das Gleichgewicht zwischen den dreien war 1568 im Toleranzedikt von Thorenburg (Torda) festgeschrieben worden, das neben Katholiken, Lutheranern und Calvinisten auch den radikalen Unitariern gleiche Rechte einräumte (Letztere lehnten die Dreifaltigkeitslehre ab und bestritten deshalb auch, dass Christus göttlicher Natur gewesen sei). Eigene Toleranzdekrete des Fürsten galten der jüdischen und der beträchtlichen rumänischen Bevölkerung des Fürstentums.
In einer Zeit, in der sich die Menschen anderswo in Europa im Namen Gottes gegenseitig abschlachteten, war dies ein Arrangement, das überraschend gut funktionierte. Alle beteiligten Parteien erkannten, wie schutzlos und schwach das Fürstentum war, und wollten auswärtigen Räubern und Abenteurern deshalb keine Gelegenheit zur Einmischung bieten. Mit der Zeit wurde die Toleranz ein integraler Bestandteil der politischen Kultur und Gesellschaft Siebenbürgens, was die Machtposition des Fürsten stärkte, denn dieser konnte als der Verteidiger aller Glaubensrichtungen auftreten, der noch dazu die Freiheiten der unterschiedlichen Gruppen gegen den Absolutismus und Konfessionalismus der Habsburger beschützte. Für die auswärtigen Beziehungen des Fürstentums konnte die konfessionelle Vielfalt Siebenbürgens jedoch auch hinderlich sein, insbesondere nachdem der Fürst 1604 zum Calvinismus konvertiert war. Während damit 90 Prozent des siebenbürgischen Adels nun die Konfession ihres Fürsten teilten, waren die meisten Bauern doch katholisch oder orthodox, die meisten Stadtbürger Lutheraner. Andere christliche Fürsten, die nach Siebenbürgen blickten, sahen dort nur den Landesherrn und hielten das Fürstentum dementsprechend (und fälschlicherweise) für ein Bollwerk des reinen Protestantismus, eine calvinistische Macht, die ihnen selbst womöglich in einer Notsituation beistehen würde. Zwar mochte es bisweilen im Interesse des Fürsten sein, diesem Außenbild entsprechend aufzutreten; er vergaß jedoch nie, dass seine Herrschaft ganz davon abhing, die Balance zwischen den verschiedenen ethnischen und konfessionellen Gruppierungen Siebenbürgens zu sichern.
Zudem bestanden ganz beträchtliche materielle Hindernisse, die Siebenbürgen davon abhielten, auf der europäischen Bühne eine größere Rolle zu spielen. Mehr als die Hälfte des Fürstentums war dicht bewaldet; nur auf etwa einem Fünftel seiner Fläche wurde Ackerbau betrieben. Die Bevölkerung konzentrierte sich in vereinzelten Ballungsräumen, die durch Urwälder und Bergketten weitgehend voneinander getrennt waren. Ein stehendes Heer nach westlichem Vorbild zu unterhalten, war unter diesen Bedingungen unmöglich – und was hätte man mit ihm auch anfangen sollen, wo doch überall Bäume und Berge im Weg waren? Wie auch die unmittelbaren Nachbarterritorien verließ sich das Fürstentum Siebenbürgen auf seine leichte Kavallerie, die bis zu 35 Kilometer am Tag zurücklegen konnte, unterstützt von kleineren Trupps mit Musketen bewaffneter Freischärler, die weit verstreute Grenzposten besetzten. In einer offenen Feldschlacht hatten Truppen wie diese kaum eine Chance, weil es ihnen an Durchhaltevermögen mangelte. Sie vermieden deshalb die direkte Konfrontation mit dem Feind und brachen dessen Willen zum Widerstand, indem sie im Hinterland Zivilisten und Nutzvieh zusammentrieben und verschleppten. Diese Taktik wurde jedoch ausgebremst, wenn der Feind in befestigten Städten oder Burgen Zuflucht suchte, denn den Siebenbürgern fehlten die Artillerie und die disziplinierte Infanterie, die eine erfolgreiche Belagerung erst möglich machen. Auch war es ihnen unmöglich, ihre Kampagnen über mehr als ein paar Monate am Stück zu führen, denn bevor sie im Frühjahr losziehen konnten, musste genug Gras für ihre Pferde gewachsen sein – und bevor die sengende Sommerhitze alles wieder ausgedörrt hatte, mussten sie mit ihrer Beute heimkehren.
Strategie und Logistik Dieselben logistischen Probleme, denen letztlich alle Konfliktparteien unterworfen waren, fanden sich auch anderswo im Donauraum und insbesondere auf den weiten Ebenen der ungarischen Puszta, wo die Sommer glühend heiß und die Winter bitterkalt waren. Die umliegenden Gebirge versanken vom Herbst bis zum Frühling unter dichten Schneedecken. Wenn dann endlich die Schneeschmelze einsetzte, schwollen selbst kleinste Bergbäche rasch zu reißenden Strömen an, in der Ebene traten die Flüsse über ihre Ufer und überschwemmten für den Großteil des verbleibenden Jahres ein Drittel der Landfläche – Mückenplagen und Malaria waren die Folge. Ungarn lag am nordwestlichen Rand des osmanischen Weltreichs, gut 1100 Kilometer vom europäischen Verwaltungszentrum der Osmanen in Adrianopel (Edirne) entfernt. Ein Heer von 40 000 Fußsoldaten und 20 000 Berittenen benötigte am Tag 300 Tonnen Brot und Futter.57 Dabei waren die Ernteerträge im östlichen Europa nur etwa halb so hoch wie in Flandern oder anderen Ackerbauregionen des Westens, die zehnmal mehr „Nicht-Produzenten“ im Sinne der Landwirtschaft ernähren konnten. Selbst Polen, das rasch zur Kornkammer der Städte Westeuropas wurde, exportierte im späten 16. Jahrhundert gerade einmal zehn Prozent seines landwirtschaftlichen Nettoertrags. Im unteren Donaubecken aber war es oft geradezu unmöglich, Proviant und Futter vor Ort zu requirieren, vor allem weil die Bevölkerung sich, wie in Siebenbürgen, meist in einzelnen, voneinander getrennten Siedlungsräumen ballte. Im Konfliktfall waren die Türken gezwungen, dem Verlauf des Flusses zu folgen, was ihren Vormarsch auf 15 Kilometer am Tag verlangsamte. Wenn sie im April loszogen, konnten sie Wien nicht vor Juli erreichen. Es überrascht daher kaum, dass die osmanischen Heerführer sich nach Ausbruch des Krieges vor allem auf Belgrad verließen, das – als erste größere Stadt an der Donau westlich des Eisernen Tores – schon auf zwei Dritteln des Weges zur Front gelegen war: Das Eiserne Tor bei Orschowa (Orșova) markiert den Durchbruch der Donau zwischen den Gebirgszügen der Südkarpaten und der Serbischen Karpaten sowie den nördlichen Ausläufern des Balkangebirges im heutigen Bulgarien.
Diese strategischen und logistischen Faktoren zwangen dem türkischen Vorgehen eine gewisse Routine auf. Die Kampagne begann gemächlich, mit dem Zusammenziehen von Truppen aus allen Teilen des Osmanischen Reiches in Adrianopel oder Belgrad. Der Hauptteil des Heeres erreichte die Front im Juli, sodass zum Erringen tatsächlicher militärischer Erfolge nur wenige Monate verblieben, bevor ab September der Herbstregen einsetzte; traditionell beendete der Sultan die Kampagne am 30. November, pünktlich zum Winterbeginn.
Groß angelegte Feldzüge waren die Ausnahme. Meist beschränkten die Kampfhandlungen sich auf Überraschungsangriffe im Grenzgebiet, die wegen der dortigen politischen, ideologischen und sozialen Rahmenbedingungen so klein aber auch bleiben mussten. Die Region lag am äußersten Ende des Osmanischen Reiches wie des Königreichs Polen, und obschon sie dem Machtzentrum der Habsburger auf der Landkarte näher liegen mochte, trennten sie politisch von diesem doch Welten. Alle Großmächte waren auf die Kooperation der örtlichen Grundherren und ihrer Privatheere angewiesen, denn diese verfügten über die Ressourcen, über die Loyalität und den Respekt der verstreut lebenden Bevölkerung. Die Magnaten Ungarns und Siebenbürgens waren zwar reich, hatten zuletzt aber neue und kostspielige Gepflogenheiten übernommen: mit üppigen Landsitzen, Universitätsstudien im Ausland und Kavalierstouren durch ganz Europa für die Söhne und Erben. Bei all dem Aufwand konnten sie sich nicht auch noch ein großes stehendes Heer leisten, um die Grenze zum Osmanischen Reich zu schützen; außerdem wollten auch ihre ärmeren Klienten versorgt sein, die sich mit kleinen Raubzügen ihre kärglichen Einkommen aus Viehhaltung, Pferdezucht und Ackerbau aufbesserten. Im Zentrum der Macht akzeptierte man diesen Status quo als die einzige Möglichkeit, die widerspenstigen Grundherren der Grenzregion bei Laune und Loyalität zu halten. Und ganz nebenbei konnte man mit der „wilden Grenze“ seine internationalen Rivalen unter Druck setzen. Als säkulare Repräsentanten konkurrierender Weltreligionen konnten weder der Kaiser noch der Sultan einen dauerhaften Friedensschluss akzeptieren, ohne damit implizit auch das Existenzrecht der jeweils anderen Kultur anzuerkennen. Das Fehlen fester Grenzen ermöglichte eine Politik der schleichenden Expansion, die durch immer neue Übergriffe, kleine Vorstöße und Gebietsverletzungen vorangetragen wurde. Egal, welche Seite gerade die Nase vorn hatte: Der momentan Stärkere nutzte die Anfälligkeit des Schwächeren aus und sicherte sich zügig – bevor es ein anderer tun konnte – die Kontrolle über einige tributpflichtige Grenzdörfer. Der Grenzverlauf im Gelände wurde vor- und zurückgeschoben wie Sand im Spiel der Gezeiten, während die größeren, befestigten Städte wie Felsen in der Brandung standen, denen erst der offene Krieg mit seinen Mörsern und Kanonen beikommen mochte.
Derartige Festungen wurden ab den 1530er-Jahren ausgebaut, als sowohl die Osmanen wie auch die Habsburger ihre Präsenz in Ungarn verstärkten. Den Türken kamen kürzere Defensivlinien im Inneren zugute, denn mit ihren Stellungen entlang der mittleren Donau sowie im südwestlich gelegenen Bosnien waren sie kompakt positioniert. Das Rückgrat ihrer Verteidigung bildeten 65 relativ große Burgen, deren Besatzungen zusammen rund 18 000 reguläre Soldaten zuzüglich Hilfstruppen umfassten, während in den Lücken zwischen diesen Festungen 22 000 Milizionäre patrouillierten, welche die Feldherren des Sultans unter dessen überwiegend christlichen Untertanen in der Region rekrutiert hatten. Die Habsburger hingegen sahen sich gezwungen, im Norden und Westen davon einen 850 Kilometer langen Gebietsbogen zu verteidigen, der von den Ländern Österreichs und Böhmens teils durch Gebirgszüge abgeschnitten war. Die „seitliche“ Bewegungsfreiheit war stark eingeschränkt, da sämtliche Flüsse der türkisch besetzten ungarischen Tiefebene im Osten zuströmten. Jedes der Länder Österreichs und Böhmens verfügte über ein militärisches Aufgebot, dessen Mobilisierung jedoch von der Zustimmung der jeweiligen Landstände abhängig war; diese wiederum wollten ihre militärischen Kräfte vorrangig zur eigenen Landesverteidigung einsetzen. Die osmanische Belagerung Wiens im Jahr 1529 war ein Schock, dem dort in den Jahren 1531–67 die Errichtung neuer, mit Bastionen versehener Festungsanlagen im italienischen Stil folgte. Pläne zur Modernisierung dieser Befestigungen mussten 1596 auf Eis gelegt werden, was einerseits Geldmangel, andererseits den Bauernaufständen in Ober- und Niederösterreich geschuldet war. In der Folge war die Hauptstadt der Habsburger nur schwach verteidigt, als 1619 die Böhmen und Siebenbürger angriffen. Die Wiener Bürgerwehr war zwar 1582 zum „kaiserlichen Fähnlein“, 1618 gar zum Regiment befördert worden, zählte aber letztlich nur 500 Mann.58
Die Militärgrenze Um die Türken in Schach zu halten, reaktivierten beziehungsweise stärkten die Habsburger vormalige und bestehende ungarische Verteidigungsmaßnahmen entlang der Grenze zum Osmanischen Reich und schufen damit die später so genannte Militärgrenze.59 Diese rund 50 Kilometer tiefe, umfassend militarisierte Zone erstreckte sich entlang der gesamten Grenze zwischen den beiden Machtbereichen und beruhte im Wesentlichen auf zwölf großen Festungen und etwa 130 kleineren befestigten Posten mit insgesamt mehr als 22 000 Mann Besatzung in den 1570er-Jahren. Ausbau und Unterhalt der Militärgrenze wurden maßgeblich vom Reichstag finanziert, der zwischen 1530 und 1582 acht Beihilfen mit einem nominellen Gesamtvolumen von rund zwölf Millionen Gulden bewilligte, dazu noch eine gute weitere Million an Mitteln zum Festungsbau. Mindestens vier Fünftel der Gesamtsumme wurden auch ausgezahlt, den konfessionellen Spannungen innerhalb des Reiches zum Trotz, weil die Osmanen als Bedrohung für die gesamte Christenheit galten.60 Tatsächlich wurden die beiden größten Summen ausgerechnet in den Jahren 1576 und 1582 bewilligt, zu einer Zeit also, in der nach Auffassung vieler Historiker der konfessionelle Gegensatz sich verschärfte. Allerdings sorgten Meinungsverschiedenheiten dafür, dass es bei Auslaufen der letzten Zahlungsvereinbarung im Jahr 1587 nicht sofort zu einer Neuauflage kam. Die Abhängigkeit der Habsburger von der Bereitschaft der Landstände, Steuern zur Verteidigung „ihrer“ Grenzabschnitte zu bewilligen, nahm dadurch zu. Nur etwa die Hälfte der Grenztruppen konnte zugleich aus ihren Garnisonen abgezogen werden, was den Spielraum für Offensivoperationen stark einschränkte. Bei einem großen Heer von etwa 55 000 Mann rechnete man mit Kosten von mindestens 7,4 Millionen Gulden pro Kampagne – eine Summe, die die tatsächlichen Einnahmen der Habsburgermonarchie weit überstieg.
Derartige finanzielle Erwägungen brachten die Habsburger dazu, die Verteidigung weiter Grenzabschnitte in die Hände lokaler Autoritäten zu legen. Die südliche oder Meergrenze um das an der Adriaküste gelegene Senj wurde von einem Zusammenschluss von Freischärlern gehalten, die als Uskoken bekannt waren (von einem slawischen Wort für „Flüchtling“). Allerdings konnte die karge Berggegend an der Küste die wachsende Zahl von tatsächlichen Flüchtlingen nicht ernähren, die eigentlich von der Regierung im fernen Wien bezahlt werden sollten, damit sie die Grenze zum osmanischen Bosnien verteidigten. Wegen ihrer chronischen Überschuldung sahen sich die Habsburger gezwungen, ein Auge zuzudrücken, wenn die Uskoken sich stattdessen als Wegelagerer und Piraten ein Zubrot verdienten. Den nächsten Grenzabschnitt in Richtung Norden bildete die kroatische Grenze um die Festung Karlstadt (das heutige Karlovac), die 1579 erbaut und nach dem innerösterreichischen Erzherzog Karl II. benannt wurde. Die dafür benötigten Mittel hatten die Landstände Innerösterreichs im Austausch für die im Brucker Libell gewährten Freiheiten bewilligt. Die Festung Karlstadt sicherte den Zugang zum Oberlauf der Save und verhinderte so einen osmanischen Einfall nach Krain. Die slawonische Grenze um Warasdin (Varaždin) an der oberen Drau wurde ebenfalls von den innerösterreichischen Ständen subventioniert, da sie das Herzogtum Steiermark schützte. Etwa die Hälfte der kleineren Posten an der Militärgrenze war in diesen beiden Sektoren konzentriert und mit Kolonisten besetzt, die auf Kronland siedeln durften und als Gegenleistung Milizdienst leisteten. Aus der habsburgischen Staatskasse erhielten sie nur wenig Unterstützung; vielmehr erwartete man von ihnen, dass auch sie die mageren Erträge ihrer Landwirtschaft durch gelegentliche Raubzüge jenseits der Grenze aufbesserten.
Die ungarische Grenze war in drei Abschnitte geteilt. Der südlichste erstreckte sich von der Drau bis zur Südspitze des Plattensees (Balaton) und umfasste unter anderem die bedeutende Festung Kanischa (Nagykanizsa). Der mittlere Abschnitt verlief vom Plattensee nach Norden bis zur Donau und schwang sich dann in östlicher Richtung um den osmanischen Vorposten Gran herum, wo der Flussverlauf im beinah rechten Winkel nach Süden, und damit in Richtung Buda und Pest, abknickt. Dieser Teil der Grenze war der am schwersten umkämpfte, weil das Donaubecken beiden Parteien besten Zugriff auf das feindliche Territorium bot. Den Osmanen war daran gelegen, Buda als den Sitz ihrer Regierung und Verwaltung für Ungarn zu schützen – und als ein weit vorgeschobenes Hauptquartier für den Vorstoß nach Wien. Um solches zu vereiteln, ließen die Habsburger am östlichen Ende der Großen Schütt, einer riesigen, von zwei Flussarmen umschlossenen und daher nicht selten überfluteten Donauinsel, die Festung Komorn erbauen. Deren Schwesterfestung errichtete man bei Raab, etwa 40 Kilometer südwestlich von Komorn; so konnte der einzig praktikable Zugang nach Niederösterreich südlich der Großen Schütt bewacht werden. Die kleinere Festung Neuhäusel sicherte die Nordflanke Komorns, indem sie die Passage über den Fluss Neutra (Nitra) versperrte. Der letzte Abschnitt der ungarischen Grenze schließlich erstreckte sich ostwärts bis zur Theiß und der Grenze nach Siebenbürgen. Die wichtigste Festung in diesem Grenzabschnitt war Erlau (ungarisch Eger), das die Straße in Richtung des nordwärts gelegenen Mátra-Gebirges und damit den Zugang nach Oberungarn abriegelte sowie die Kommunikation zwischen Österreich und Siebenbürgen sicherte. Auch hier deckten die zentral bewilligten Mittel gerade einmal die Kosten der wichtigsten Garnisonen; die Grenzabschnitte dazwischen wurden von ungarischen Magnaten verteidigt, die auf eigene Kosten große Kontingente irregulärer Fußsoldaten unterhielten, die „Heiducken“ genannt wurden. Die Heiducken waren ursprünglich nomadische Viehhirten in den weiten Räumen der ungarischen Tiefebene gewesen, hatten sich nach der Teilung Ungarns indes gezwungen gesehen, wenigstens halbsesshaft zu werden: als Grenzwächter, die in eigenen Dörfern unter dem Kommando gewählter Anführer lebten und ihren unregelmäßigen Sold zwischen zwei Kriegszügen mit Räuberei und Viehdiebstahl aufstockten.